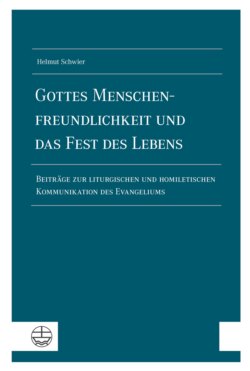Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Engagierte Lektüreformen: Rezeption als »Interesse« und Veränderung
ОглавлениеWährend die wissenschaftliche Textauslegung identitätsoffen und applikationsfern geschieht, zielen die »engagierten Lektüreformen«28 auf Identitätsbegründung und Applikation sowie auf eine Veränderung der Praxis. Die drei Spannungen aus Gal 3,28 (Jude und Grieche, Sklave und Freier, Mann und Frau) zeigen die wichtigsten engagierten Lektüreformen, die feministische, die befreiungstheologisch-materialistische und die aus dem christlich-jüdischen Dialog erwachsene Lektüre;29 auch die psychologisch-therapeutische Auslegung ließe sich hier nennen. Gemeinsam ist ihnen die Hervorhebung der Parteilichkeit der Bibel; gleichzeitig nehmen sie im Unterschied zur fundamentalistischen Lektüre Methoden und Erkenntnisse der historisch-kritischen Exegese auf und das Recht zur Sachkritik in Anspruch.
Nun lässt sich nicht bestreiten, dass trotz mancher Extrempositionen die genannten Lektüreformen nicht nur von der Exegese und ihren Methoden Gebrauch gemacht haben, sondern dass sie wiederum ihrerseits die wissenschaftliche Exegese außerordentlich stark anregen und befruchten konnten. Vieles aus der neuen Jesus- und Paulusforschung ist in diesem Kontext zu sehen, und auch die Apostolin Junia aus Röm 16,7 war in den wissenschaftlichen Textausgaben zunächst nicht erkennbar.
Was ist die Stärke der engagierten Lektüren? Einmal die Betonung der Parteilichkeit der Bibel und ihrer frühen Emanzipationspotentiale, dann aber auch konkreter ihre Fragekategorien von Herrschaft, Patriarchat, Androzentrismus und Gender, von Herrschaft, Unterdrückung, Befreiung30 und Eurozentrismus, von implizitem und expliziten Antijudaismus, von Heil und Heilung, Bild und Symbol. Auch hier gibt es also ein Bultmannsches »Woraufhin der Befragung«. Dies ist notwendig, wenn es ein ›offenes Vorverständnis‹ bleibt bzw. wird. Deutlich und eine Stärke ist weiter, dass hier der Leser31 oder Rezipient im Vordergrund steht – nicht so offen und individualistisch wie in manchen Spielarten der Rezeptionsästhetik, wohl aber hinsichtlich gemeinsamer Lektüren und Wahrnehmungen sowie, spezifischer, hinsichtlich der Erwartung individueller, sozialer, kirchlicher und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Die Rezeption setzt also ein ›Interesse‹ voraus, stärkt und vertieft es.
In der kirchlichen und theologischen Praxis knüpfen bekanntlich zahlreiche Formen des Bibelgebrauchs hier an, wobei das »Jahr der Bibel 2003« diese Fülle kultureller, wertebezogener und missionarischer Anliegen im Umgang mit der Bibel durchaus öffentlichkeitswirksam zeigte.32 Homiletisches Beispiel: Der von Uta Pohl-Patalong entwickelte Bibliolog33 eignet sich als Verkündigungsform in bestimmten Gottesdiensten und nimmt manche Anregungen der feministischen, israelbezogenen und therapeutischen Lektüren integrativ auf. Auch viele narrative Predigten gehören in dieses Feld, während nach meinem Eindruck die Frage der ethischen und politischen Predigt erst wiederentdeckt und neu bearbeitet werden muss. Dabei sind alte Fehlformen gesetzlich-vorschreibenden, pathetisch-appellierenden oder liberal-anempfehlenden Redens zu vermeiden, ohne gleichzeitig die unbequeme Parteilichkeit der Bibel und des biblischen Gottes zu ignorieren.34