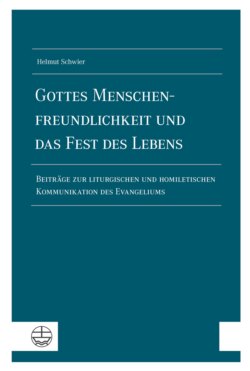Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zum Geleit
Оглавление»Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens« – der Titel dieses Bandes nimmt eine Formulierung Helmut Schwiers aus einer Predigt zur Osternacht 2011 auf. Wie in einem Nukleus sind darin die wesentlichen Elemente seines praktisch-theologischen Denkens eingeschlossen, die sich auch in den Abteilungen dieses Bandes spiegeln: Bibel, Ostern, Predigt und Liturgie. Ihren inneren Zusammenhang haben sie allesamt im christlichen Gottesdienst. H. Schwiers Praktische Theologie ist konzipiert als Theologie des Gottesdienstes als dem exemplarischen aber keineswegs exklusiven Ort der »Kommunikation des Evangeliums«. Im Gottesdienst begegnet der Mensch unter den Bedingungen seiner Räumlichkeit, Leiblichkeit und Zeitlichkeit dem auf Raum, Zeit und Leib bezogenen Gott. Von hier aus erschließen sich auch die übrigen kirchlichen Handlungsfelder. Die auffällige und prominente Stellung der Bibel innerhalb der Praktischen Theologie H. Schwiers ist dabei nicht nur dem akademischen Werdegang des Jubilars und dem ungewöhnlichen interdisziplinären Zuschnitt seines Heidelberger Lehrstuhls zu verdanken, sondern in der Sache selbst begründet. Sie markiert das besondere Profil seines theologischen Denkens. Praktische Theologie als »Wahrnehmungswissenschaft« beginnt mit der Wahrnehmung der Bibel.
Die in diesem Band versammelten Aufsätze wurden zwischen 1996 und 2018 publiziert und dokumentieren die Arbeit des Jubilars über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg. Sie sind verstreut an zahlreichen Orten in heute z. T. nur noch schwer erreichbaren Publikationen erschienen. Schon allein darum lohnt u. E. ihre gesammelte Veröffentlichung – freilich nicht im Sinne einer »Werkausgabe«, sondern allenfalls als eine Art Zwischenbilanz.
Der 60. Geburtstag H. Schwiers ist dazu willkommener Anlass. Die abgedruckten Aufsätze mögen Lust wecken auf mehr – bei den Lesern ebenso wie beim Autor. Chronologisch gelesen zeichnen sie Entwicklungslinien und Dimensionen der Theologie H. Schwiers nach, die geprägt sind durch seinen akademischen Werdegang vom Neuen Testament hin zur Praktischen Theologie; als Sammlung machen sie zugleich den inneren Zusammenhang seines Denkens erkennbar. Daher sei zunächst an die wichtigsten biographischen Stationen seiner akademischen Laufbahn erinnert.
Wegmarken
Geboren wurde Helmut Schwier am 23. Dezember 1959 in Minden/Westfalen. Er besuchte das dortige Herder-Gymnasium und begann nach dem Abitur (1978) das Studium der Evangelischen Theologie, zunächst in Bethel, dann in Heidelberg. Im Herbst 1984 legte er bei der Evangelischen Kirche von Westfalen das Erste Examen ab. Gut drei Jahre später wurde er an der Universität Heidelberg im Fach Neues Testament promoviert mit einer Arbeit über die theologischen und ideologischen Faktoren der Tempelzerstörung im ersten jüdisch-römischen Krieg.1 Die Arbeit wurde von Gerd Theißen betreut.
Von 1988–1991 war H. Schwier zweieinhalb Jahre als Vikar im Kirchenkreis Herford und nach dem Zweiten Examen fünf Jahre als Gemeindepastor tätig; regional engagierte er sich für die Jugendarbeit und die ökumenische Zusammenarbeit im Rahmen der ACK. Im Jahr 1996 wechselte er als Wissenschaftlicher Assistent für Praktische Theologie an die Kirchliche Hochschule Bethel (Lehrstuhl Prof. Dr. Traugott Stählin). Parallel übernahm er einen Lehrauftrag für Liturgik an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford. An der Kirchlichen Hochschule Bethel habilitierte er sich im Jahr 2000 im Fach Praktische Theologie. Seine Habilitationsschrift behandelt die Entstehung und Konzeption des Evangelischen Gottesdienstbuches, der ersten gemeinsamen Agende lutherischer und unierter Kirchen in Deutschland und Österreich.2
Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit einem Jahr in der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Union (EKU) in Berlin tätig und Geschäftsführer des Sekretariats der Leuenberger Kirchengemeinschaft (heute: Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, GEKE). Unter anderem war er mit der Herausgabe des Lehrdokuments »Kirche und Israel« betraut, das 2001 auf der Vollversammlung der Leuenberger Kirchengemeinschaft in Belfast einstimmig angenommen worden war und erstmals einen europaweiten evangelischen Konsens zum Verhältnis von Kirche und Israel formulierte.3
2001 folgte H. Schwier dem Ruf auf einen Lehrstuhl für Neutestamentliche und Praktische Theologie an der Universität Heidelberg. Zwei Jahre später wurde er dort in das kirchliche Amt des Universitätspredigers an der Heidelberger Peterskirche gewählt. Mit dem Lehrstuhl verbunden ist ein Lehrauftrag am Predigerseminar der Evangelischen Landeskirche in Baden.
2005 übernahm H. Schwier die Leitung der in den 1970er Jahren von Rudolf Bohren gegründeten Predigtforschungsstelle und sorgte für deren institutionelle Verankerung als »Abteilung für Predigtforschung« innerhalb des Praktisch-Theologischen Seminars der Theologischen Fakultät. So hat er das Erbe Bohrens aufgenommen und in eigenständiger Weise weitergeführt, auch in der Verbindung zur societas homiletica und im Vorstand des »Ökumenischen Vereins zur Förderung der Predigt«. Predigtforschung, Homiletik und Predigtanalyse bilden in diesen drei ursprünglich von Rudolf Bohren gegründeten Einrichtungen ein homiletisches Dreieck, das Empirie, Theorie und Praxis verbindet.
Gottesdienst
Im Zentrum der Praktischen Theologie H. Schwiers steht der Gottesdienst. »Gottesdienst als Feier und Kommunikation des Evangeliums ist ein ebenso vielfältiges wie bezugreiches und ein, rezeptionsästhetisch gesehen, offenes Kunstwerk.«4 An dessen Komplexität arbeitet sich die Praktische Theologie H. Schwiers in immer neuen Anläufen ab. Das Ergebnis ist nicht eine in sich geschlossene systematische Darstellung, sondern eine Beschreibung, die empirische Wahrnehmung, interdisziplinäre Zugänge und theologische Reflexion in immer neuen Anläufen verbindet. Homiletische und rituelle Kommunikation stellen in ihrem wechselseitigen Zusammenspiel wie bei einer Ellipse die Brennpunkte dieses Beziehungs- und Kommunikationsgeschehens dar. Es lässt sich mit Hilfe unterschiedlicher »Codes« (ritueller, rhetorischer, dramaturgischer etc.) »lesen« und funktioniert als ausbalanciertes Verhältnis in der Vielfalt und im Zusammenspiel der einzelnen gottesdienstlichen Elemente. Die Komplexität dieses Geschehens in seinen Grundvollzügen fordert geradezu eine multiperspektivische Betrachtung. H. Schwier interpretiert es mit Hilfe hermeneutischer, historischer, sprechakt- und ritualtheoretischer, rezeptionsästhetischer Überlegungen und theaterwissenschaftlicher Ansätze, so dass sich vielfältige Impulse für die Praxis nicht nur des Gottesdienstes ergeben.
Mit dem Verständnis des Gottesdienstes als »Kommunikation des Evangeliums« positioniert H. Schwier sich innerhalb der gegenwärtigen praktischtheologischen Forschung,5 freilich in eigenständiger Weise, in dem er die besondere Bedeutung der Bibel für dieses Kommunikationsgeschehen herausarbeitet.6 Grundlegend ist die Einsicht, dass die Christusbegegnung nicht unmittelbar, sondern grundsätzlich medial vermittelt geschieht. Insofern kommt der Bibel als erstem Medium des Wortes Gottes eine zentrale Bedeutung zu. In einer Interpretationsgemeinschaft, die weiter als die Kirche reicht, ist die Kommunikation des Evangeliums auf den hermeneutischen Streit der Ausleger ebenso angewiesen wie auf die gemeinschaftliche Feier im Gottesdienst. Die Differenzierung unterschiedlicher Funktionen und Zugangsweisen zur Bibel ermöglichen einen Sprachgewinn und Reflexionsimpulse, wobei die methodische Pluralität in Exegese und Lektüreformen nicht als Verhängnis, sondern als Chance begriffen und ideologiekritisch zur Geltung gebracht wird. Identitätsoffene und applikationsferne wissenschaftliche Lektüren werden nicht gegen engagierte Lektüreformen ausgespielt, die auf Identitätsbegründung und Veränderung der Praxis zielen, sondern befruchten einander gegenseitig. Dabei ermöglicht die Vielfalt biblischer Sprachformen, Gattungen und Motive im Anschluss an Paul Ricoeur nicht nur eine zielgerichtete und theologisch pointierte Reflexion des Bibeltextes, sondern bietet auch Handhabe zur sprachlichen Gestaltung der Predigt. Exemplarisch hat H. Schwier dies für die biblische Gattung der prophetischen Rede anhand der Predigten Hans Walter Wolffs vorgeführt.
In der durch Interpretation und Gebrauch der Bibel eröffneten (gottesdienstlichen) Kommunikation des Evangeliums erfolgt die Begegnung mit Gott. Helmut Schwier geht es um die Verbindung unserer Wirklichkeit mit der Wirklichkeit Gottes. Der Gottesdienst ist kein heiliger, vom Alltag abzugrenzender Raum, sondern ein kommunikatives Geschehen, das Gottesdienst und Lebensalltag beieinander hält – eben als »Fest des Lebens«. Das unterscheidet Schwiers Zugang von einem mystagogischen Ansatz, der den Gottesdienst als »Weg im Geheimnis« begreift (M. Nicol, M. Josuttis), aber auch gegenüber einem kulturhermeneutischen Verständnis von Religion als Deutung (W. Gräb) und Sinnstiftung menschlicher Existenz. H. Schwier widersteht einer Abtrennung des Gottesdienstes vom Alltag ebenso wie seiner hermeneutischen Auflösung in den Alltag. Gottes Menschenfreundlichkeit im Evangelium und der Gottesdienst als Fest des Lebens bringen zusammen, was aufeinander zu beziehen aber doch zu unterscheiden ist: die Wirklichkeit Gottes und die Lebenswirklichkeit der Menschen, Gottesdienst und Alltag; das biblische und unser Reden von Gott, Gottes Wort und menschliche Erfahrung, homiletische und rituelle Kommunikation.
H. Schwier plädiert dabei für die Wiederentdeckung der österlichen Dimension in Kirche und Protestantismus. Er wehrt sich dagegen, eine an der Passion Christi orientierte theologia crucis – am Ende gar in konfessioneller Frontstellung – gegen eine österliche theologia gloriae auszuspielen. Die österliche Perspektive begründet vielmehr den Festcharakter des Gottesdienstes, von dem eine den Alltag transformierende Kraft ausgeht. In der Metapher des »Risses« wird nicht nur die Brüchigkeit unserer Alltagsontologie erkennbar, sondern lassen sich österliche Transzendenzerfahrungen umschreiben und erschließen, wie sie sich durch den Gottesdienst vermitteln.
Predigt
So wie Gottesdienst und Predigt bezogen sind auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, so ist Praktische Theologie bezogen auf die kirchliche Praxis. »Empirisch« sind auf je eigene Weise beide. Programmatisch beginnt H. Schwier seine homiletische Selbstvorstellung mit dem Satz: »Exegese und Empirie bilden die beiden wesentlichen Bezugsgrößen meiner homiletischen Lehre und Forschung.«7 Das ist nicht nur methodisch zu verstehen, sondern theologisch bedeutsam. Praktische Theologie ist gleichermaßen als Wahrnehmungswissenschaft und Handlungstheorie zu verstehen, die einen deskriptiven Ansatz mit einem auf die kirchliche Praxis ausgerichteten theologisch-normativen Anspruch verbindet.
Das betrifft die materiale Homiletik und den bei jeder Predigt neu auszubalancierenden Zusammenhang von Text- und Situationsbezug. Es betrifft aber auch den praktischen Vollzug der Predigt als Kommunikationsgeschehen. Predigt und Liturgie sind ausgerichtet auf Orientierung, Vergewisserung und Erneuerung der hörenden und feiernden Gemeinde. Die ästhetische Wende in der Praktischen Theologie hat daher zu Recht ein einseitig kerygmatisches pastorales Selbstverständnis in Frage gestellt und die Rolle des Predigthörers ins Zentrum gerückt. Auf innovative Weise hat Helmut Schwier selbst in zwei groß angelegten Studien die Predigtrezeption untersucht.8 Nicht wie Predigten verstanden, sondern wie sie gehört werden stand im Mittelpunkt des Interesses beider Studien, deren Besonderheit in der synchronen bzw. »ablaufsimultanen« Erfassung der unmittelbaren Hörerreaktionen lag. Die Ergebnisse dieser Studie geben Anlass darüber nachzudenken, was eine »gute Predigt« auszeichnet, die die Kommunikation des Evangeliums ermöglicht, weil sie mit der aktiven Rolle der Predigthörerinnen und -hörer rechnet und deren Erwartungen und mögliche Reaktionen mit bedenkt.
Das gilt analog auch für den Gottesdienst als Ganzen und für die Liturgie. Auch hier ist die Kritik an pastorenzentrierten Gottesdiensten theologisch begründet und wird zugleich empirisch konkret. Der Gottesdienst wird nicht von Pfarrerinnen und Pfarrern gehalten, sondern von und mit der Gemeinde gefeiert. Helmut Schwier hat immer wieder auf die grundlegende Bedeutung des ersten Kriteriums des Evangelischen Gottesdienstbuchs (EGb) aus dem Jahr 19999 hingewiesen. Mit Verweis auf das Priestertum aller Gläubigen heißt es dort: Der Gottesdienst wird unter der Verantwortung und Beteiligung der ganzen Gemeinde gefeiert. Auch das ist eine Gestaltungsaufgabe, wie sich an den Fehlformen leicht zeigen lässt. Die Beteiligung der Gemeinde darf nicht zur »Mitspielshow« verkommen.
Dazu bedarf es Kriterien und Leitsätzen, wie sie z. B. im EGb formuliert werden. Sie nehmen die theologischen und theoretischen Diskurse auf und erschließen sie für die Praxis im Sinne der berühmten Schleiermacherschen »Kunstregeln«. So betont auch H. Schwier die Nähe zur Kunst, ohne handwerklicher Nachlässigkeit das Wort zu reden. Ausgangspunkt liturgischer Überlegungen zur Gottesdienstgestaltung sind bei H. Schwier darum immer wieder die Agenden, allen voran das EGb. Als Agende neuen Typs ist es Regulativ und Gestaltungsangebot für die gottesdienstliche Feier im Spannungsfeld von Tradition und Situation. Das erklärt H. Schwiers Wertschätzung für das EGb als »Werkbuchagende«, sein Plädoyer für »traditionskontinuierliche Gottesdienste« ebenso wie seine Offenheit für neue Gottesdienstformen. An die Stelle verordneter Einheit tritt eine zu gestaltende Vielfalt, zu der Agenden anleiten und helfen sollen. Im Zentrum steht eine komplexe Integrationsaufgabe, die liturgisch traditionsbewusst und situationsgerecht agiert, die in der Predigt das Wechselverhältnis von Bibel- und Lebensbezug im Blick behält und im Gottesdienst auf ein balanciertes Verhältnis von Vielfalt und Einheit gottesdienstlicher Elemente achtet. All das ist ausgerichtet auf eine »Kommunikation des Evangeliums«, welche auf die innere und äußere Partizipation, der den Gottesdienst feiernden Menschen zielt und Orientierung, Vergewisserung und Erneuerung durch das Evangelium ermöglicht.
In diesem Horizont lässt sich liturgische Qualität beschreiben und kann benannt werden, was eine »gute Predigt« oder einen gelungenen Gottesdienst ausmacht. Die Arbeit an und mit den Kriterien gottesdienstlichen Handelns gelingt aber nur im permanenten wechselseitigen Austausch von Theorie und Praxis. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen für die praktische Ausbildung, wobei Schwier besonders die Lese- und Deutungskompetenzen für die unterschiedlichen rituellen und rhetorischen Codes in Liturgie und Predigt betont, für liturgische Mehrsprachigkeit und biblische Vielstimmigkeit in der Predigt eintritt. Es geht um liturgische und homiletische Gestaltungskompetenz, die empirisch sensibel für die eigene Person, für die jeweilige Situation und für die feiernde Gemeinde ist und sich zugleich theologisch reflektiert an der Aufgabe der Kommunikation des Evangeliums immer wieder neu ausrichtet.
Praktische Theologie und theologische Praxis
H. Schwiers Theologie entsteht und bildet sich auf der Grenze und im Zusammenspiel von kirchlicher Praxis, akademischer Forschung und pastoraler Ausbildung. Das gilt auch für ihn selbst. Sein Wirken lässt sich einzeichnen in das Dreieck von Fakultät, Predigerseminar und Universitätskirche und reicht in seiner kirchlichen und akademischen Verbundenheit weit darüber hinaus. Eine Grenzziehung zwischen dem Professor, dem Prediger und dem Liturgen ist kaum möglich. Akademische Lehre und pastorale Ausbildung bilden bei ihm ebenso eine Einheit, wie praktisch-theologische Forschung und gottesdienstliche Praxis im Amt des Universitätspredigers. Getragen durch eine große Liebe zur Kirchenmusik von Bach bis Jazz, im unermüdlichen Einsatz für die Gestaltung des Kirchenraums der Peterskirche, im Engagement des Universitätspredigers im kulturellen Großraum seiner Universität bewährt und bildet sich sein ganzheitliches und multiperspektivische Gottesdienstverständnis. All das vollzieht sich praktisch in ganz unterschiedlichen Formaten, angefangen bei den fast schon intimen akademischen Morgenandachten im kleinen Kreis über die von Helmut Schwier mit ins Leben gerufene »Akademische Mittagspause« im Dialog mit anderen Wissenschaften weiter zu den sonntäglichen Universitätsgottesdiensten der Hochschulgemeinde bis hin zur medialen Öffentlichkeit von Fernsehgottesdiensten.10 Solche Zusammenhänge markieren einen weiten Horizont, lassen sich in einem Buch wie dem vorliegenden aber kaum abbilden. Wenigstens einige Predigten durften nicht fehlen, um die Konvergenz und Zusammengehörigkeit von theologisch-akademischer und kirchlich-pastoraler Existenz erkennbar zu machen, die die Praxisnähe seiner Theologie ausweist ohne in theorievergessene Pragmatik umzuschlagen.
Das Genus eines Sammelbandes bringt es mit sich, dass eine gewisse Redundanz und Überschneidung zwischen den einzelnen Beiträgen nicht zu vermeiden ist. Als Herausgeber haben wir dies zugunsten einer möglichst breiten Auswahl an Beiträgen in Kauf genommen. So wird erkennbar, wie wiederkehrende Grundeinsichten perspektivisch variiert und in unterschiedlichen Zusammenhängen weiterentwickelt und exemplarisch vertieft werden. In den einzelnen Abteilungen sind die Aufsätze chronologisch angeordnet, beginnend jeweils mit dem jüngsten Beitrag. Der Abdruck erfolgt unverändert, lediglich Querverweise innerhalb der Erstpublikationen wurden soweit notwendig redaktionell ergänzt bzw. angepasst und Abkürzungen vereinheitlicht. Auf eine vollständige Bibliographie des Jubilars wurde verzichtet; sie ist bequem abrufbar über die Homepage des Heidelberger Lehrstuhls.
Die Herausgeber verdanken dem Jubilar viel. Wir sind H. Schwier in unterschiedlichen Zusammenhängen begegnet und auf vielfältige Weise mit ihm verbunden. Gemeinsam schätzen wir seine theologische Leidenschaft für Gottesdienst und Predigt, sein großes Engagement für die Gemeinde, seinen kritischen Blick auf unsere Kirche, seine Liebe zur Peterskirche, zu J.S. Bach11 und zur Kunst, aber auch seinen Humor und seine Großzügigkeit. Wir sind dankbar für den kollegialen Austausch in zahllosen Gesprächen und Begegnungen über viele Jahre hinweg, dankbar auch für alle freundschaftliche Begleitung und Ermutigung, für alle konstruktiv-kritischen Beiträge und die vielen anregenden Hinweise in der gemeinsamen theologischen Arbeit.
H. Schwier ist ein akademischer Lehrer, dessen Wirken nicht im klassischen Sinne als »schulbildend« zu bezeichnen ist, der aber doch einen großen Kreis an Studierenden, Doktoranden und Habilitanden, Kolleginnen und Kollegen um sich geschart hat. Viele haben durch seine Lehr- und Forschungstätigkeit wichtige Impulse für ihre eigene akademische und kirchliche Arbeit bekommen. Auch in der Evangelischen Kirche wurden und werden seine Impulse geschätzt. Ein Zeichen hierfür sind die Druckkostenzuschüsse seitens der EKD und aus den Landeskirchen, mit denen H. Schwier in besonderer Weise verbunden ist. Wir danken der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche der Pfalz, der Evangelischen Landeskirche in Baden und der Evangelischen Kirche von Westfalen für ihre großzügige Unterstützung.
Unser Dank gilt darüber hinaus all denen, die zum Erscheinen dieses Buches beigetragen haben. Verlage und Herausgeber der Erstpublikation haben ausnahmslos und gerne dem Wiederabdruck der Originalbeiträge zugestimmt – oftmals in Verbindung mit einem Ausdruck der besonderen Wertschätzung für den Jubilar.
Die Fertigstellung des Manuskriptes für den Druck wäre ohne die Mithilfe und Unterstützung von Mathias Balzer, Dr. Christine Wenona Hoffmann, Annemarie Kaschub, Julia Nigmann und Helge Pönnighaus nicht möglich gewesen. Jessica Jaworski sei gedankt für die Hilfe bei der technischen Erstellung und Einrichtung des Druckmanuskriptes.
Der Evangelische Verlangsanstalt danken wir für die umsichtige und sorgfältige Begleitung dieses Projekts. Namentlich gilt unser Dank in besonderer Weise dabei Dr. Annette Weidhas in der Verlagsleitung und Herrn Stefan Selbmann aus dem Lektorat.
Mit dem Erscheinen dieses Buches verbinden wir die Hoffnung auf die Fortsetzung des Gesprächs und des Austauschs mit H. Schwier. Vor allem aber wünschen wir ihm Kraft und Leidenschaft diesen Weg noch viele Jahre weiterzugehen. Für den vorliegenden Sammelband hoffen wir auf eine große Leserschaft – nicht nur im akademisch-wissenschaftlichen Bereich, sondern auch im weiteren Kreis all jener, »unter der[en] Verantwortung und Beteiligung« in unserer Kirche Gottesdienst gefeiert wird.
Hannover, Plankstadt, Mannheim und Mainz/Herborn im August 2019 Martin Hauger, Jürgen Kegler, Jantine Nierop und Angela Rinn