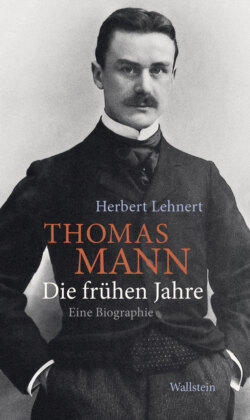Читать книгу Thomas Mann. Die frühen Jahre - Herbert Lehnert - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Brüder kommen sich näher:
Der Frühlingssturm!
ОглавлениеBald nach dem Tod des Vaters befiel Heinrich eine akute Tuberkulose. Er brauchte Sanatoriumsaufenthalte, während derer er sein Ziel, Schriftsteller zu werden, weiter verfolgte. An seinem Interesse für Hermann Bahr und Paul Bourget ließ er jetzt auch den Bruder teilnehmen. Im Mai und Juni 1893 kam er nach Lübeck, weil die Mutter der Brüder ihren Haushalt in Lübeck aufgab, um in München ein neues Leben zu beginnen. Heinrich musste sein Zimmer räumen, das seine Bibliothek und Manuskripte enthielt. Über diese Zeit schreibt er Ewers, er habe wenig an seinem Roman gearbeitet, stattdessen die Ferien mit seinem Bruder verbummelt.[42]
Heinrich wird des Bruders Schwärmerei für Mitschüler als Pubertätserscheinung abgetan und sich bemüht haben, des Bruders heterosexuelles Begehren zu stärken. Wie seinem Freund Ewers dürfte Heinrich damals dem Bruder den Weg zu einer Prostituierten gezeigt haben. In einem Brief an Ewers hatte Heinrich dem Freund eine Pension in Lübeck empfohlen, deren Bewohnerin ihm »die ersten normalen sinnlichen Seligkeiten verschaffte«. Das Haus, dessen Adresse er ungenau in Erinnerung hat, habe ein »blankmessingnes Stiegengeländer«.[43] Dass Heinrich auch seinem Bruder Thomas das gleiche Haus beschrieb oder 1893 zeigte, geht daraus hervor, dass das Haus durch ein blitzendes »Geländer aus Messing« erkennbar wird, sowohl in der Empfehlung für Ewers als auch im Doktor Faustus. Leverkühn erwähnt es, als er Zeitblom von seinem Besuch eines Bordells in Leipzig berichtet (10.I, 208).
Thomas wollte im Juli mit der Mutter nach München ziehen, er musste das zehnte Schuljahr, die Unterprima, wiederholen, um die Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Dienst in der kaiserlichen Armee zu erhalten.[44] Eine Schülerzeitschrift, die er mit Schulfreunden schrieb und redigierte, sollte das negative Urteil seiner Lehrer über ihn widerlegen. Das Blatt erhielt den Titel Der Frühlingssturm!. Als Herausgeber zeichnete Paul Thomas; Paul war ein zweiter Vorname Thomas Manns. Die Monatsschrift für Kunst und Literatur (so der Untertitel des Doppelhefts) gilt als die erste deutsche Zeitschrift, die von Jugendlichen für Jugendliche produziert wurde.[45] Sie entstand wohl großenteils in der Zeit, die Heinrich in Lübeck zubrachte.
Das Programm, von Thomas Mann in einem Leitartikel formuliert, klingt jugendlich-kämpferisch, progressiv. Wie ein Frühlingssturm wollen die Autoren in »Gehirnverstaubtheit«, »Ignoranz« und »bornierte[s] aufgeblasene[s] Philistertum« hineinfahren (14.I, 18). Von dem verlorenen ersten Heft aus dem Mai 1893 sind Bruchstücke in der Form von Zitaten aus Arthur Eloessers Biographie Thomas Mann. Sein Leben und sein Werk (Berlin, S. Fischer, 1925) bekannt (14.II, 11 f.). Aus dem ersten Heft ist nur ein vollständiger Text erhalten, ein erzählendes Gedicht, Zweimaliger Abschied, das zu einigen biographischen Vermutungen Anlass gibt, auf die wir noch kommen werden. Zwei Gedichte Thomas Manns lassen seinen Pessimismus erkennen: Das eine, Nacht, will in einer freien Verssprache mit der Ankündigung des Morgenrots trösten (3.I, 133). Das andere, Dichters Tod, nimmt den Tod als endgültiges Ende (3.I, 134). Die Erinnerungen eines Mitschülers aus dem Jahr 1925 nennen eine Besprechung von Ibsens Drama Baumeister Solness und zitieren nur einen Satz daraus: Der Schüler Thomas Mann hat das »robuste Gewissen«, das Hilde Wangel, einer Figur in Ibsens Drama, eigentümlich ist, auf seine vernachlässigten Schul-Aufgaben bezogen (14.I, 19). Ibsens Drama war im Januar 1893 im Berliner Lessingtheater zum ersten Mal aufgeführt worden und im gleichen Jahr auf Deutsch erschienen (14.II, 18). Baumeister Solness kritisiert den rücksichtslosen Kapitalismus; das Stück weckt Zweifel am Fortschrittsgedanken und an Nietzsches humanistischem Glauben an eine Höherentwicklung des Menschen. Ibsen wirbt jedoch nicht für eine Rückkehr zur alten Metaphysik, wenn er den Individualismus der Moderne in Frage stellt, sondern will nur auf das Problematische der neuen Weltanschauung aufmerksam machen. Die neue Welt vertritt Hilde Wangel mit ihrem Glauben an Solness’ Größe, mit dem sie allerdings seinen Tod verursacht. Sie tritt dem Leser aber nicht als Mörderin, sondern als liebenswerte, junge, reizvolle Frau entgegen. Ein solches Spiel mit Wert-Ambivalenzen entsprach schon früh Thomas Manns modernem Wertepluralismus.
Das erhaltene Exemplar des Doppelheftes Der Frühlingssturm! für Juni und Juli 1893 enthält die Skizze Vision (2.I, 11–13), die Neuformung eines langen ungereimten Gedichtes Die Hand, das Heinrich 1892 in einer Sammlung Deutsche Lyrik von 1891 veröffentlicht hatte.[46] Eine Liebesgeschichte spricht sich in wechselnden Farben aus. Thomas Mann macht ein Prosagedicht aus den thematischen Anregungen in Heinrichs lyrischer Strophe. Farben, getroffen von den gespiegelten Strahlen der untergehenden Sonne, wecken eine vergangene unterdrückte erotische Leidenschaft als imaginierte Erinnerung eines erzählenden Ichs. Thomas Mann widmet seinen Text »Dem genialen Künstler Hermann Bahr«.
Wahrscheinlich gab es eine frühere Version von Vision unter dem Titel Farbenskizze, die Thomas der Lübecker Eisenbahnzeitung einreichte und mit einem witzigen Rat des Feuilleton-Redakteurs zurückerhielt: »Wenn sie öfters solche Einfälle haben, sollten Sie etwas dagegen tun«. Er hat die Anekdote in einer autobiographischen Vorlesung 1940 in Princeton (On Myself ) erzählt mit der Bemerkung, er sei, als er noch zur Schule ging, mit der Wiener Schule Hermann Bahrs »in Berührung« gewesen (GW XIII, 132 f.). Dass sein Bruder ihn auf Bahr brachte und dass er einen Text Heinrichs bearbeitete, erwähnt Thomas Mann nicht.
Dass Thomas Mann schon 1893 Grundzüge von Nietzsches Perspektivismus kannte, beweist sein Aufsatz Heinrich Heine, »der Gute« in Der Frühlingssturm! Der junge Thomas Mann will die Größe des geliebten Dichters Heinrich Heine für übermoralisch erklären, indem er Dr. Konrad Scipio angreift, dessen langer Artikel im März und April 1893 in der Feuilleton-Beilage des Berliner Tageblatts erschienen war. Scipio war kein Pseudonym, vielmehr der wirkliche Name eines liberalen Pastors aus Stettin, von dem Thomas Mann nur dessen Artikel kannte. Scipio hob Heines bürgerliche Seiten hervor, um ihn gegen antisemitische Angriffe zu verteidigen. Heine habe Luther positiv dargestellt und sei in einem allgemein religiösen, nicht strikt konfessionellen Sinn »durch und durch Protestant« gewesen. Er habe Deutschland kritisch geliebt, so dass ihm Patriotismus zugebilligt werden konnte. Zwar missbilligt Scipio Heines lockeres Leben; aber er habe es wenigstens nicht scheinheilig verborgen.[47] Der junge Thomas Mann weiß es besser: Der Dichter passt nicht in eindeutige Rollen. »Heine […] bewunderte Luther, trotzdem er kein Protestant war«, »Heine […] bewunderte Napoleon, trotzdem er ein geborener Deutscher war« (14.I, 22). Nietzsches perspektivisches Denken führt der Schüler in seiner Einleitung vor: Die Begriffe »gut« und »schlecht« seien lediglich »soziale Aushängeschilder«. »Ein absolutes ›gut‹ oder ›schlecht‹, ›wahr‹ oder ›unwahr‹, ›schön‹ oder ›hässlich‹« gebe es in der Theorie ebenso wenig, »wie es im Raum ein oben und unten gibt« (14.I, 21). Wenn der junge Thomas Mann »gut« und »schlecht« als Gegensätze nimmt, statt des üblichen »gut« und »böse« dann folgt er Nietzsches Zur Genealogie der Moral. Dessen »Erste Abhandlung« unterscheidet »Gut und Böse« und »Gut und Schlecht« (KSA 5, 257–289). Die richtige Perspektive auf Heine, meint der junge Thomas Mann, sei seine Größe als Dichter. Die perspektivische Wertung verzichtet auf einen allgemein gültigen Wertmaßstab. Heine ist weder moralisch gut, noch ist die Schönheit seiner Dichtungen der gültige Maßstab für seine Größe. Vielmehr bezieht sich das Urteil »groß« lediglich auf seine Dichtung.
Über das Thema der Religion Heinrich Heines hat sich Thomas Mann wahrscheinlich aus Georg Brandes’ Die Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts (1872–1891) unterrichtet,[48] dessen sechster Band Das junge Deutschland 1891 erschienen war. Heinrich wird sein Exemplar nach Lübeck mitgebracht haben, und Thomas hat begierig darin gelesen. Über Heines Taufe fand er: »Er [Heine] wechselte die Religion, nicht aus Überzeugung von der Wahrheit des Christentums, im Gegenteil voll Abneigung gegen die Staatsreligion und voll Scham über den Schritt, den er unternahm; er wollte den Versuch machen, sich der demütigenden und drückenden Abhängigkeit von seinem Onkel zu entziehen und konnte unter keinen anderen Umständen Einnahmen, Lebensstellung oder ein Amt erlangen.«[49]
Ostern 1894 verließ Thomas Mann seine Heimatstadt mit dem Zeugnis der mittleren Reife so schnell er konnte.[50]