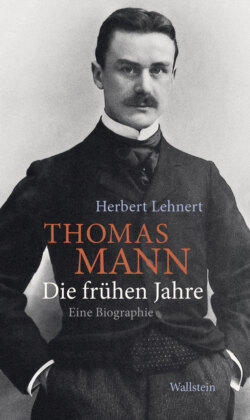Читать книгу Thomas Mann. Die frühen Jahre - Herbert Lehnert - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Selbstbildung
ОглавлениеEnde 1895 beantwortete Thomas Mann einen Vordruck mit Fragen nach seiner Bildung, worum Ilse Martens, eine Freundin der Familie, ihn gebeten hatte. Im Jahr 1895 stand Thomas Mann noch am Anfang seiner Selbstbildung. Auf die Frage nach seinen Lieblingsschriftstellern nannte er »Heine, Goethe, Bourget, Nietzsche, Renan«. Seine »Lieblingscharaktere in der Poesie« seien »Hamlet, Tristan, Faust und Mephisto, Parsifal«. In dem Interesse an Bourget ist der Einfluss des Bruders Heinrich noch spürbar. Das gleiche gilt für Renans Das Leben Jesu. Allerdings wurde Renan damals allgemein diskutiert, auch Nietzsche beschäftigte sich mit ihm. Thomas Manns lebenslanges Interesse für Shakespeares Hamlet schlägt sich hier, schon Ende 1895, nieder. Dramen Friedrich Schillers hatte er schon in der Schule gelesen. Goethes Dichtung und Wahrheit, woraus er oft zitiert, dürfte er auch bereits während der Schulzeit gelesen haben.
Auf die Frage: »Lieblingshelden in der Geschichte« ist »Christus« die Antwort. Thomas Mann hatte sich 1895 Nietzsches Der Antichrist angeschafft. Darin fand er einen Jesus, der sich gegen die jüdische »Kirche«, die jüdische Sekte der Jünger Jesu, absetzte. Deren Lehren von Gott als strafendem Richter, die Begriffe Sünde, Schuld und Strafe überhaupt, erkannte Nietzsche nicht als Lehren Jesu an, sowie »jedwedes Distanz-Verhältnis zwischen Gott und Mensch« (KSA 6, 205). Das Himmelreich gehört den Kindern; es besteht aus liebevollem Handeln. »Die evangelische Praktik allein führt zu Gott, sie eben ist Gott« (KSA 6, 206). Jesus habe gelebt und sei gestorben, »um zu zeigen, wie man zu leben hat […]. Er widersteht nicht, er verteidigt nicht sein Recht […]. Und er bittet, er leidet, er liebt mit denen, in denen, die ihm Böses tun …« (KSA 6, 207). Das Christentum der Jünger und das des Paulus sieht Nietzsche als auf krude Weise missverstanden. »[I]m Grunde gab es nur einen Christen, und der starb am Kreuz.« (KSA 6, 211)
Bourgets Programm-Roman Le Disciple hat Thomas Mann damals wohl im französischen Original gelesen. Im frühesten erhaltenen Notizbuch hat er sich 1894 die Einleitung zu Le Disciple in französischer Sprache notiert. Im Februar 1896 berichtet er Grautoff, er lese Bourgets Physiologie de l’amour moderne. (21, 73). Eine Notiz aus dem Jahr 1896 belegt die Lektüre von Bourgets La Terre Promise (Nb.I, 51). In der Antwort auf eine französische Rundfrage von Ende 1903, wie französische Literatur auf ihn gewirkt habe [Der französische Einfluss] (14.I, 73–75),[93] schränkt er diese Wirkung erheblich ein, vermutlich um Heinrichs Anleitung zu verbergen. Ähnlich schreibt er an den französischen Professor Joseph-Émile Dresch im Oktober 1908: »Ich verehre Maupassant und namentlich Flaubert von ganzem Herzen, glaube jedoch, dass ich von den großen Romanciers germanischen und slawischen Stammes mehr gelernt habe als von ihnen (Dickens, Tolstoi, Turgenjew, Jakobsen [sic], Andersen, selbst Reuter)« (21, 394). Thomas Mann teilte sicher das große Interesse moderner Schriftsteller der Zeit an Gustave Flaubert; die Zeugnisse dafür sind jedoch eher gering.[94] Eine Äußerung über die Lektüre der Briefe Flauberts an George Sand findet sich in einem französischen Zitat aus einem Brief vom Sommer 1904 an Katia Pringsheim (21, 299). An Louis Leibrich schreibt er 1953, er habe Flauberts L’Éducation sentimentale im Original gelesen.[95] Madame Bovary war das Muster eines modernen Romanes, dessen Hauptfigur nicht um die Sympathie der Leser wirbt. 1907 im Versuch über das Theater nimmt Thomas Mann Flauberts Madame Bovary in eine Reihe bedeutender Romane auf (14.I, 133). An Philipp Witkop schreibt er am 27. April 1933 recht widersprüchlich, er habe Flaubert wie Balzac und Zola »erst ziemlich spät kennen gelernt, […] einer eigentlichen Beeinflussung« sei er sich »nicht bewusst«, jedoch gehöre »die streng künstlerische Haltung Flauberts« zu den »Bildungserlebnissen« seiner »späteren Jugend« (Briefe I, 331).
Am Anfang seiner Rezension eines unbedeutenden Buches für die Zeitschrift Das Zwanzigste Jahrhundert findet Thomas Mann zwei Figuren mit gegensätzlicher Weltanschauung in Bourgets Roman Cosmopolis »prachtvoll« einander gegenübergestellt (14.I, 40).[96] Damals, 1896, war der Einfluss Heinrichs, den Thomas 1895 in Rom besucht hatte, noch voll lebendig, jedoch zeigt sich auch schon kritische Distanz. Denn Heinrich hatte 1894 eine längere Rezension von Bourgets Roman Cosmopolis (HMEP I, 52–67) unter dem Titel Bourget als Kosmopolit in einer modern-liberalen Zeitschrift veröffentlicht. Erst gegen Ende seines Artikels war er auf den gläubigen Montfanon zu sprechen gekommen, die Gegenfigur zu dem kosmopolitischen Schriftsteller Dorsenne, auf den Bourget seine eigenen früheren schriftstellerischen Intentionen überträgt. Heinrich hatte gezögert, Bourgets konservative Entwicklung festzustellen. Thomas dagegen macht die reaktionäre Haltung einer wichtigen Figur Bourgets ganz deutlich, obwohl Bourget gar nicht das Thema seiner Rezension war. 1896 war die konservativ-katholische Wendung Bourgets bekannt geworden, denn er hatte sich in Paris der Anti-Dreyfus-Partei angeschlossen. 1901 wird Bourget zu seiner Kirche zurückkehren.
In einem Brief an Grautoff erwähnt Thomas Mann 1896 die Lektüre von Novellen von Maupassant im französischen Original (21, 66). Einige von diesen vermittelten dem jungen Thomas Mann die französische Perspektive des deutsch-französischen Krieges von 1870 /71. Maupassant stellt die Gefühle der Besiegten dar, zeigt die rücksichtslose Arroganz der Offiziere der Besatzungsarmee, erwähnt jedoch Grausamkeiten sachlich auch auf beiden Seiten. Der Krieg, von Maupassant dargestellt, erscheint als destruktiv und sinnlos. Diese Lektüre weckte Widerstand gegen den deutschen kriegerischen Nationalismus, wie er in Thomas Manns Schule gepflegt wurde. Maupassant lässt seine eignenen Meinungen aus der Beschreibung der Umstände hervortreten, worin Thomas Mann ihm oft folgte.[97] Zu Kirche und Religion wahrt Maupassant ironische Distanz. Seine Weltanschauung und sein Gesellschaftsbild sind ebenso pessimistisch wie die des jungen Thomas Mann.
Thomas Mann las viel, statt sich seinen Schulaufgaben zu widmen. Wenn er in seinem Aufsatz Heinrich Heine, der »Gute« in Der Frühlingssturm! Heines Bibel-Lektüre auf Helgoland erwähnt (14.I, 22), dann beweist das, dass er Heines Ludwig Börne / Eine Denkschrift (1840) kannte. Das zweite Buch der Börne-Denkschrift besteht aus Briefen, die Heine auf Helgoland schrieb. In diesem Buch spricht Heine als freigeistiger »Hellene« gegen Börnes engere Weltanschauung, die Heine dem Typus des »Nazareners« zuordnet.
Heines Die romantische Schule sei ein Buch gewesen, das er »von jeher besonders geliebt« habe, bekennt Thomas Mann viel später im amerikanischen Exil (Briefe II, 97). Heine kritisiert die quietistische Seite der deutschen Romantik: Deren Neigung zu Witz und Ironie sei »ein Zeichen unserer politischen Unfreiheit«, sie sei »der einzige Ausweg, welcher der Ehrlichkeit noch übrig geblieben« sei.[98] Heines politische Ansichten widersprachen denen, die Thomas Mann in der wilhelminischen Schule gelehrt wurden. Die Perspektive des Napoleon-Verehrers auf die »Befreiungskriege« von 1813 und 1814 muss den jungen Schüler amüsiert haben:
Als Gott, der Schnee und die Kosaken die besten Kräfte des Napoleon zerstört hatten, erhielten wir Deutsche den allerhöchsten Befehl, uns vom fremden Joche zu befreien und wir loderten auf in männlichem Zorn ob der allzulang ertragenen Knechtschaft und wir begeisterten uns durch die guten Melodien und schlechten Verse der Körnerschen Lieder und wir erkämpften die Freiheit; denn wir tun alles, was uns von unseren Fürsten befohlen wird.[99]
Im gleichen ironischen Sinn argumentiert Thomas Mann in einem Brief an Grautoff vom 27. Februar 1896, als dieser sich nationalistisch geäußert hatte:
Ich stehe den »Freiheitskriegen« [–] wie der »nationalen Bewegung« seit 1870 – nach wie vor wenig sympathisch gegenüber und schmeichle mir, darin viele nicht ganz unbeträchtliche Männer, wie Goethe, Hegel, Heine, Nietzsche etc. auf meiner Seite zu haben – auf ihrer Seite zu stehen vielmehr. Das waren eben alles gute Europäer und literarische Menschen, und: das literarische Empfinden – es ist nicht anders – war in Deutschland von jeher das Gegenteil vom nationalen Empfinden und wird es auch wohl immer bleiben. Wenn du dir jetzt das letztere angewöhnst, so tust du vielleicht sehr recht daran, denn es ist furchtbar modern. In dieser Beziehung bin ich leider noch etwas zurück.[100]
In Die Entstehung des Doktor Faustus heißt es: »Ich las viel Heine nach um diese Zeit, die Feuilletons über deutsche Philosophie und Literatur« (19.I, 489). »Diese Zeit« war das Frühjahr 1945, als das Ende des Nationalsozialismus nahte und Thomas Mann seine Rede Deutschland und die Deutschen zu schreiben begann, in der er die Romantik als Sünde des deutschen Bildungsbürgertums anklagt, seine eigene Neigung nicht ausschließend. Mit Heines »Feuilletons« meint Thomas Mann die Abhandlungen Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland und Die romantische Schule. Er las Heine »nach«, will sagen, er frischte seine Kenntnis auf, die er in seinem Selbststudium während der Schulzeit erworben hatte. Heines Freigeistigkeit, seine humorvolle oder ironische Weise, deutsche Religiosität, Philosophie und Literatur den Franzosen nahezubringen, nahm sein Schüler als eine sympathische Art von Bildung auf.
Wie Heine betrachtete Thomas Mann die deutsche literarische Landschaft als protestantisch geprägt. Heine pries Kant als den »große[n] Zerstörer im Reich des Gedankens«,[101] der aus Güte für seinen Diener Lampe die Existenz Gottes durch die praktische Vernunft verbürgen lässt.[102] Diese Ironie Heines führt Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen an (13.I, 632).[103] Obwohl Heine die romantische Lyrik schätzt – produzierte er doch selber Lyrik in romantischem Stil –, kritisiert er ihre reaktionären Tendenzen. Heine denkt in Widersprüchen – wie Thomas Mann.
Heinrichs Aneignung Goethes, Heines, Fontanes, Storms und Brandes’ ist in seinen Briefen an Ewers dokumentiert. Thomas orientierte sich lange an dem großen Bruder. Er war ebenso wie Heinrich von den Gedichten Heines und Storms angetan. Die Gedichte August von Platens liebte er »von jung auf« (GW X, 887; 1926) wohl mehr als Heinrich, der die Homoerotik verachtete. Er besaß eine zweibändige Ausgabe von Platens Werken von 1895 (Essays III, 446).
Schon in Thomas Manns erster überlieferter Erzählung Gefallen sind die Szenen der Gespräche des Ich-Erzählers mit seinem Kollegen Rölling in der Art von Fontanes leichtem Konversations-Stil geschrieben. Effi Briest hat Thomas Mann 1895 im Jahr des Erscheinens der Buchausgabe gelesen (21, 73).[104] Er blieb lebenslang ein Verehrer Fontanes, über den er einige Essays schrieb.[105]
Erst aus dem Vorwort zu Conrad Ferdinand Meyers Der Heilige von 1930 erfahren wir, dass Liebe und Bewunderung für den Schweizer Dichter in Thomas Manns früher Jugend (GW XIII, 425) begonnen hat. Meyers Prosa vereinigt greifbare Vergegenwärtigung mit Eindringen in die Psyche seiner Figuren, ein Schreibstil auch Thomas Manns. In Meyers Lyrik gibt es Stellen, von denen man vermuten kann, dass sie den jungen Thomas Mann angesprochen haben: die Michelangelo-Gedichte, darunter In der Sistina, oder die Todessymbolik in Im Spätboot. Auf Gottfried Keller wurde er erst später aufmerksam (21, 403).
Thomas Mann hat in der Jugend viel Lyrik gelesen. In der Zeit seines autodidaktischen Studiums in den 90er-Jahren wird er sich mit der deutschen Lyrik der Moderne bekannt gemacht haben. Stefan George erwähnt er in seinen Essays aus Distanz. Von Aufmerksamkeit schon für die frühe Dichtung Rilkes zeugt ein Brief vom 10. April 1905 an Richard Schaukal. Der Exil-Germanist Wolfgang Michael hat mir erzählt, dass Thomas Mann, als er ihn in Kalifornien besuchte, eine Reihe von Rilke-Gedichten auswendig rezitierte. Hugo von Hofmannsthal schickte Thomas Mann die Sammlung seiner Gedichte zu Weihnachten 1908, nachdem dieser Hofmannsthal in Rodaun besucht hatte (21, 401, 746).
Ibsen und Wagner nennt Thomas Mann 1928, in einem kleinen Aufsatz unter diesem Titel, »die beiden großen Kundgebungen, die der nordisch-germanische Kunstgeist« dem französischen, russischen und englischen Roman und der französischen impressionistischen Malerei als »ebenbürtige Schöpfungen« an die Seite gestellt habe, beide seien kennzeichnend für die Größe der Epoche des 19. Jahrhunderts, »ihrer titanischen Morbidität« (GW X, 227).
Das Lübecker Theater war dem Senatoren-Haus benachbart. Erinnerungen Thomas Manns aus dem Jahr 1930 sprechen davon, dass er häufig das Theater besuchte, »erlaubter- oder unerlaubterweise« (GW XI, 418). Ein Brief von 1917 erzählt von dem Eindruck, den Schillers Don Carlos sowie eine französische Ehebruchs-Komödie auf den Sechzehnjährigen machte.[106] Die Lübecker Aufführung von Ibsens Nora oder Ein Puppenheim durch eine Gastspiel-Truppe wird er besucht haben. Nora gehört zu einer Gruppe von gesellschaftskritischen naturalistischen Dramen von Ibsen, zusammen mit Stützen der Gesellschaft, Gespenster und Ein Volksfeind, die alle 1877–1881 entstanden, oft in deutscher Übersetzung aufgeführt wurden und einen großen Eindruck hinterließen. Thomas Mann spielte 1895 die Rolle des alten Werle in der deutschen Erstaufführung des Dramas Die Wildente mit dem »Akademisch Dramatischen Verein«, einer ehemaligen Studentenverbindung. Er hatte die Wahl des Dramas »warm befürwortet« (21. 43).
Jens Peter Jacobsens Roman Niels Lyhne (1880) wurde in den 90er-Jahren in Deutschland rezipiert. Eine Übersetzung erschien 1889 im Reclam Verlag. Thomas Mann hat Niels Lyhne sehr wahrscheinlich in den 90er-Jahren gelesen, vielleicht schon in Lübeck, vielleicht auf der Reise nach Dänemark.[107] Die Beschreibung einer homoerotischen Liebe in Niels Lyhne dürfte Thomas Manns Interesse geweckt haben:
Gibt es wohl in allen Gefühlsverhältnissen des Lebens ein zarteres, edleres und innigeres, als die leidenschaftliche und doch schüchterne Liebe eines Knaben zu einem anderem? Solch eine Liebe, die niemals spricht, sich niemals in einer Liebkosung, einem Blick, einem Worte Luft zu machen wagt, solch eine sehende Liebe, die tief trauert über einem Mangel oder einem Fehler bei dem, den sie liebt, die Sehnsucht und Bewunderung und Selbstvergessen, Stolz, Demut und ruhig atmendes Glück ist![108]
Dieses Gedicht in Prosa musste Thomas Mann ermutigen, von homoerotischen Freundschaften wie derjenigen zwischen Kai Graf Mölln und Hanno Buddenbrook und zwischen Tonio Kröger und Hans Hansen zu erzählen. Niels Lyhne dürfte Thomas Mann zudem angesprochen haben aufgrund der ambivalenten Gottlosigkeit des Dichters: Niels »nahm Partei – so weit er es konnte – gegen Gott, aber wie ein Vasall, der gegen seinen rechtmäßigen Herrn zu den Waffen greift, denn er glaubte noch und konnte den Glauben nicht forttrotzen.«[109] Niels’ »Idee«, dass der Mensch ohne Furcht vor der Hölle und ohne Hoffnung auf das Himmelreich seine wahre Freiheit gewinnen und liebend für die Erde sorgen wird, stellt sich die Einsicht entgegen, das Ergebnis des Atheismus sei »eine desillusionierte Menschheit«.[110] Am Ende bleibt Niels gottlos: Schwer verwundet im deutsch-dänischen Krieg von 1864 und unter Schmerzen hält er an seiner Überzeugung fest.
Die psychologische Einsicht einer Figur zitiert Thomas Mann in Tonio Kröger: »Wo Menschen lieben […] da muss immer der sich demütigen, der am meisten liebt.« (2.I, 246) Das ist ein fast wörtliches Echo aus Jacobsens Erzählung Frau Fönß.[111] 1903 schrieb Thomas Mann einem dänischen Autor, der eine Einleitung zu Buddenbrooks schreiben sollte: »vielleicht ist es J. P. Jacobsen, der meinen Stil bis jetzt am meisten beeinflusst hat« (21, 233). Er meint wohl den Stil einer skeptischen Moderne.
In seinem Aufsatz über Knut Hamsun Die Weiber am Brunnen schrieb Thomas Mann Ende 1921: »Ich habe ihn immer geliebt, von jung auf. Ich fühlte früh, dass weder Nietzsche noch Dostojewski im eigenen Land einen Schüler dieses Ranges hinterlassen haben.« Schon der junge Thomas Mann war empfänglich für Hamsuns Romane Hunger (1891), Mysterien (1894), Pan (1895) und Victoria (1899) (15.I, 472 f.). Diese Texte handeln alle von Außenseitern, die sich nicht in die Gesellschaft der anderen einpassen wollen.[112]
Seit 1890 hatte Heinrich sich für Edgar Allan Poes Erzählungen interessiert.[113] Dieses Interesse hat er an seinen Bruder weitergegeben, der in Buddenbrooks Kai, den Schulfreund Hannos, sich für die Erzählung von dem Untergang des Hauses Usher begeistern lässt (1.I, 789). Außer für die Erzählungen Poes hat Heinrich, soweit ich sehe, sich wenig für englischsprachige Literatur interessiert. Auch Thomas scheint lange keine englischen Autoren studiert zu haben, allerdings abgesehen von Shakespeare. Anfang 1901, Buddenbrooks war im Druck, schrieb er »Dickens, Thackeray« in sein Notizbuch 4 (Nb.I, 195 f.) wahrscheinlich als Autoren, die er kennen sollte. 1922 nannte er Charles Dickens und William Thackeray unter den Autoren, die Einfluss auf Buddenbrooks genommen hatten, zusammen mit den Norwegern Kielland und Lie, Tolstoi und dem Roman Renée Mauperin der Brüder Goncourt (15.I, 510). Ihm lag wohl an stilistischer Ähnlichkeit, ein gründliches Studium von Thaceray beweist diese Äußerungen nicht.
Mindestens ein Roman von Charles Dickens hat Eindruck auf ihn gemacht: Verkehr mit der Firma Dombey & Sohn, Engros, Detail und Export, Reclam 1896, eine Übersetzung von: Dealings with the Firm of Dombey and Son: Wholesale, Retail and for Exportation (1848), gewöhnlich »Dombey and Son« genannt. Dieses Buch ist in Thomas Manns Nachlassbibliothek erhalten. Sein Thema ähnelt dem der Buddenbrooks: Im Mittelpunkt steht ein stolzer Geschäftsmann, der seine Umwelt mit seinem Geld regieren will, jedoch endet seine Firma im Konkurs. Dombey missachtet seine Tochter Florence, doch die stellt sich am Ende als die einzige heraus, die ihn liebt, nach dem Muster von Shakespeares King Lear. Im Oktober 1901, als Buddenbrooks erschienen war, beauftragte Thomas Mann Grautoff, Dickens in seiner Besprechung als Einfluss zu nennen (21, 179).[114] Das Werk George Bernard Shaws hätte den jungen Thomas Mann interessieren sollen, weil es die alten Konventionen bekämpfte, auch weil Shaw Wagnerianer war. Aber Shaws Name erscheint erst 1913 in einem Brief (21, 509).
Mit Shakespeare, vornehmlich in der deutschen Übersetzung der Romantiker um Ludwig Tieck, war Thomas Mann vertraut, wie viele Anführungen in den Essays beweisen. In dem Essay Bilse und ich nennt er Shakespeare »den ungeheuersten Fall von Dichtertum«. Am 11. Juli 1900 schreibt er an Grautoff von einem besonders intensiven Erlebnis einer Aufführung von Hamlet in München (21, 120).
Thomas Manns lebenslange Sympathie für Russland und die Russen beruht auf ausgiebiger Lektüre von russischer Prosa in deutscher Übersetzung.[115] Mehrmals hat er geäußert, Tolstoi habe ihn gestärkt, Buddenbrooks zu schreiben. Tolstois Krieg und Frieden zeigte dem Anfänger, wie man in kleinen Kapiteln historische Situationen konkret-lebendig darstellen kann. Thomas Mann tat es ihm nach in den ersten Kapiteln von Buddenbrooks.[116] In Notizbuch 2, das er 1897 in Palestrina begonnen hatte, findet sich ein Auszug aus der Übersetzung von Anna Karenina, die 1890 bei Reclam erschienen war, die er aber nicht für Buddenbrooks benutzte.[117] Vermutlich hatte er Anna Karenina schon früh gelesen. In dem Roman wirbt Tolstoi für eine konservative und religiöse Familienethik,[118] aber er gibt dem Leser Einblick in das Innere dieser Frau, die sich von einem Mann befreit, den sie nicht liebt und erlaubt seinen Lesern, mit ihr zu sympathisieren, obwohl dies seiner religiös-konservativen Ideologie nicht entspricht. In seinem Aufsatz Anna Karenina von 1939 meint Thomas Mann, Tolstoi habe seine Figur Anna geliebt und die Gesellschaft geißeln wollen, weil sie den »Liebesfehltritt« der stolzen und edelsinnigen Frau mit Grausamkeit bestrafe (Essays V, 47 f.). Viele Informationen über Tolstoi bezog Thomas Mann aus Dmitri Mereschkowskis Buch Tolstoi und Dostojewski (deutsch 1903).
Das Vorbild Iwan Turgenjews wirkte vor allem auf Thomas Manns Erzählungen.[119] Seit »langen Jahren«, schreibt er 1898 an Grautoff, habe Turgenjew ihm Anregung gegeben (21, 105). 1921, im Vorwort zu Russische Anthologie, erinnert er sich, das Bild von Turgenjew habe lange auf seinem Schreibtisch gestanden, daneben eines von Tolstoi. Turgenjew habe er »der lyrischen Exaktheit seiner bezaubernden Form« wegen geschätzt, den moralistischen Tolstoi als »Träger epischer Riesenlasten« (15.I, 335).[120] Ein Tagebucheintrag vom 16. Mai 1919 berichtet von einer erneuten Lektüre von Turgenjews Roman Die neue Generation, »an der ich Klarheit, Maß, Übersichtlichkeit, kurz das Französische am meisten bewundere«. Eine Romanfigur habe ihn (während der früheren Lektüre) zur Komik Grünlichs in Buddenbrooks angeregt. Sipjagin ist ein regime-treuer, konservativer russischer Beamter, der sich als Liberaler ausgibt. Turgenjew charakterisiert dessen Falschheit indirekt. Diese indirekte Charakterisierung von Figuren empfand Thomas Mann als »lyrische Exaktheit« und als modern.[121]
Ein Brief Thomas Manns an Korfiz Holm vom 7. Juni 1898 spricht lobend von Tschechows Erzählung Das Duell (Briefe I, 9), die Holm übersetzt und veröffentlicht hatte. Offenbar war das sein erster Kontakt mit Tschechows Prosa, die er später sehr schätzte, wie sein Essay von 1954 beweist.