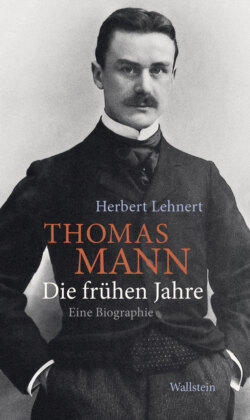Читать книгу Thomas Mann. Die frühen Jahre - Herbert Lehnert - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heinrich Manns Roman In einer Familie und Thomas Manns Gefallen
ОглавлениеHeinrich hatte nach dem Tod des Vaters seinen ersten Roman, In einer Familie, begonnen, den er Paul Bourget widmete. Die Hauptfigur, Erich Wellkamp, verlässt den Vater, der mit fragwürdigen Methoden reich geworden ist, und den Sohn tyrannisiert. Im Fiktiven seines Romans rächt Heinrich sich an seinem wirklichen Vater, der ihm nicht erlaubte, Schriftsteller zu werden. Der schwache Wellkamp – es handelt sich um einen Dekadenzroman – erhält sein mütterliches Erbe und geht als Dilettant auf Reisen. Aus einem hörigen erotischen Verhältnis in Berlin rettet er sich durch eine Ehe mit einer modernen und praktisch veranlagten Frau. Diese Beziehung wird gestört, als Wellkamp sich von seiner noch jungen Schwiegermutter verführen lässt. Sie ist die zweite Frau seines Schwiegervaters, die er wegen einer Mitgift von 250 000 Dollar, damals einer Million Mark, geheiratet hat. Heinrich Mann gibt dem Roman ein unglaubhaftes glückliches Ende. Wellkamps junge Frau verzeiht ihrem Mann den Fehltritt und sorgt für eine bessere Zukunft. Der Roman wurde 1894 von einem kaum bekannten Münchener Verlag gedruckt und wenig beachtet.
Heinrich kam zurück aus Florenz und Viareggio, als Thomas im März 1894 aus Lübeck in München ankam. An der Korrektur des Romans des älteren Bruders hat Thomas sich sicher beteiligt. Thomas hatte keine Pläne für einen Roman. Er war mehr interessiert an Heinrichs unveröffentlichter Erzählung Haltlos und deren Thema der freien Liebe. Die Brüder Heinrich und Thomas verstanden sich jetzt gut. Die Familie war 1894 in München vollständig: die Mutter, Heinrich, Thomas, Julia, Carla und der vier Jahre alte Viktor. Nach damaligem Recht war Thomas Mann noch nicht volljährig; seine Vormünder hatten über seine Berufsausbildung zu bestimmen. Die Lehre in einer Münchener Versicherung, die die Vormünder für Thomas vereinbart hatten, fand dieser langweilig. Stattdessen wollte er ein Gasthörerstudium am Münchener Polytechnikum (heute Technische Universität) aufnehmen, um sich auf den Beruf des Journalisten vorzubereiten. Mit Hilfe eines Rechtsanwalts (Essays III, 181) konnte er den Vormund Krafft Tesdorpf abwehren, der vermutlich ein Studium der Journalistik verboten hatte, weil es unvereinbar war mit dem Willen des verstorbenen Vaters. Im Juni 1896 wurde Thomas Mann volljährig und war der Aufsicht der Vormünder entwachsen. Von Thomas Manns abgebrochenem Studium wird ein eigenes Kapitel handeln.
1894 schrieb Thomas Mann Gefallen. Die Erzählung ist inspiriert von der Kritik junger Schriftsteller an den patriarchalischen Regeln, die damals das Verhältnis der Geschlechter bestimmten. Die deutsche Öffentlichkeit wurde zu der Zeit bewegt von der Diskussion der rechtlichen Stellung der Frau in den Entwürfen für das Bürgerliche Gesetzbuch. Deutsche Frauenvereine protestierten 1894 gegen den Entwurf, der zwar der alleinstehenden Frau gleiche Rechte gab wie alleinstehenden Männern, jedoch die Ehefrau nach alter patriarchalischer Gewohnheit weiterhin dem Ehemann und Familienvater rechtlich unterwarf.[144]
Konflikte mit den traditionellen ›guten Sitten‹ spielten als Themen eine große Rolle in der europäischen Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. La dame aux camélias (Die Kameliendame) von Alexandre Dumas dem Jüngeren, erschien 1848 als Roman, dann als Drama, das 1852 uraufgeführt wurde, und aus dem 1853 die Oper von Giuseppe Verdi, La traviata hervorging. Als Bühnenstück hielt sich Die Kameliendame, besonders, wenn Sarah Bernhardt die Titelrolle spielte. Der Roman Manon Lescaut des Abbé Prévost war 1731 erschienen, auf ihm beruhen die Libretti für die französische Oper Manon (1884) von Jules Massenet und für Giacomo Puccinis Oper Manon Lescaut (1893). Nietzsche pries 1888 in Der Fall Wagner die Oper Carmen von Georges Bizet (1875). Prostitution war Thema in George Bernard Shaws Stück Mrs. Warren’s Profession, gedruckt im Jahr 1893. Eine Aufführung durfte erst 1902 stattfinden. Émile Zolas Roman Nana (1880), über den Aufstieg einer Prostituierten, blieb lange ein Muster für einen gewagten naturalistischen Roman. Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts empfand die Moral der bürgerlichen Ehe als ungenügend für die Natur der Sexualität. Dieses Ungenügen war ein Thema in Heinrichs Haltlos gewesen. Auch der neunzehnjährige Thomas zweifelte an der bürgerlichen Ehe-Moral und hatte eine natürliche Sehnsucht nach freier Liebe, hetero- oder homoerotischer Art. Sein Liebhaber sollte nicht so dekadent und haltlos sein wie derjenige in Heinrichs unveröffentlichter Novelle.
Thomas Mann war eine Weile stolz auf Gefallen, aber nicht lange. Der Autor nahm den Text nie in eine Sammlung seiner Erzählungen auf und nannte ihn schon 1896 »neunzehnjährig« (21, 68). Als er 1910 frühe Erzählungen an den Germanisten Ernst Bertram schickte, wertete er Gefallen ab.[145] 1940, in der Vorlesung »On Myself« in der Universität Princeton, nannte er die Erzählung ein »schreiend unreif[es]« wenn auch, »vielleicht nicht unmelodiös[es] Produkt« (GW XIII, 134). Sein negatives Selbsturteil hat sich als Vorurteil gehalten.[146] Es lohnt sich aber, das kleine Werk wieder in den Kanon von Thomas Manns Erzählungen aufzunehmen.
Schon vor der Veröffentlichung von Thomas Manns Erstlingswerk war eine Erzählung mit dem Titel Gefallen! erschienen. Ihr Verfasser, Hans Schliepmann, veröffentlichte sie 1893 in der Freien Bühne, der Zeitschrift des S. Fischer Verlages.[147] Der Text behandelte den vergeblichen Versuch eines Studenten, eine Prostituierte, eine gefallene Bürgerliche, zu reformieren. Dagegen geht Thomas Manns Gefallen von einer freien unbelasteten Liebe aus, entwickelt eine ganz andere Handlung als die Schliepmanns.[148]
Gefallen spielt in dem Atelier eines Malers, in das der Gastgeber einen dreißigjährigen Arzt, einen jungen Studenten und den Ich-Erzähler eingeladen hat. Der Erzähler nimmt sich Zeit, das seltsame Atelier zu beschreiben. Der Raum sei mit Kunstwerken und kunstgewerblichen Gegenständen aus verschiedenen Weltgegenden »in schreienden Zusammenstellungen« beladen, die »gleichsam auf sich selber mit Fingern wiesen« (2.I, 14). Die eklektische Stillosigkeit ist ein Signal: Die Moderne ist kosmopolitisch, glaubens- und haltlos, so wie Paul Bourget den Dilettantismus beschrieben hat. Feindlich gegen Kirche und Glauben äußert sich der Älteste in der bohemischen Gruppe, der Arzt Dr. Selten, dessen scharfe Ironie sich beständig lustig macht über den großen, altertümlich geschnitzten Kirchenstuhl, auf dem er sitzt. Er hat es sich zum Prinzip gemacht, das »von der betreffenden Regie da oben wenig umsichtig inszenierte Erdenleben völlig frag- und skrupellos zu genießen […]« (2.I, 15).
Das eklektische Atelier kann man als Anspielung auf Nietzsches zweite Unzeitgemäße Betrachtung: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874) lesen, die die blinde Sammelwut des modernen historischen Bewusstseins beklagt. Sie lasse keine Richtung erkennen und entwerte alle Maßstäbe; kulturelle Indifferenz behindere wahre Kultur (KSA 1, 268). Die historische Erziehung am Gymnasium und an der Universität habe der Jugend die Zukunft »entwurzelt«, wenn sie den »Cynismus« einer bloßen »Hingabe der Persönlichkeit an den Weltprozess« empfehle (KSA 1, 295, 312). Junge Menschen fühlen sich nicht mehr an den traditionellen bürgerlichen Lebensstil gebunden. Sie wollen in freier Liebe die traditionelle Sexualmoral ignorieren. Aber dem Liebespaar in Thomas Manns Erzählung gelingt das neue Leben nicht. Der Binnen-Erzähler und seine Geliebte »fallen« am Ende; die junge Frau verkauft sich teuer, der Mann verfällt in eine Libertinage, in der sein Genuss durch Hass verfälscht ist. Thomas Manns Gefallen erzählt vom »Verfall« der alten wie der neuen Sitten, passt in die Mode der Dekadenz.
Die Ungerechtigkeit der alten Sexualmoral vertritt ein junger Student der Wirtschaftswissenschaft, der nach dem Schriftsteller Heinrich Laube benannt ist. Von ihm hatte Thomas Mann in Heinrich Heines Die romantische Schule gelesen, er habe ein »große[s] flammende[s] Herz[ ]«.[149] Der Student Laube kämpft für eine Erneuerung der Geschlechter-Beziehungen, gegen die sexuelle Doppelmoral zu Ungunsten der Frau. »Ist der Mann nicht gerade so gut gefallen?«, fragt er (2.I, 16). Diese Frage hatte sich auch der junge Mann in Heinrichs Haltlos gestellt, nachdem er ein Bordell besucht hatte.
Seltens Geschichte, wie er als junger Student von dem freien Liebesverhältnis mit einer Schauspielerin enttäuscht wurde, soll Laube von seinem Einsatz für die Emanzipation der Frauen abbringen. Mit seiner Erzählung stellt Doktor Selten die Frage erneut, die implizit Heinrichs Haltlos zugrunde lag: Kann es eine naive Beziehung zwischen den Geschlechtern geben, die nicht von den bürgerlichen Konventionen und dem Geldbesitz der Bürger abhängig ist? In der 1894 bestehenden patriarchalischen Gesellschaftsordnung, die Frauen der Oberschicht von allen höheren Berufen ausschloss, bleibt die Frau von ihrem Mann oder ihrem Vater abhängig. Schauspielerinnen sind Ausnahmen.
Der Protagonist war gutmütig und verträglich, der vollendete gute Kerl, »der Liebling aller seiner Kameraden« (2.I, 17). Den Begriff »guter Kerl« gibt es auch in Heinrichs Novelle. Deren Hauptperson überlegt nach einer Nacht mit seiner Freundin, dass er sich nicht an sie binden will. Wenn er sich verpflichtet gefühlt hätte, sie zu heiraten, so wäre er ein »guter Kerl« gewesen im Sinne der herrschenden Moral. Ein »guter Kerl« ist ein an die gewöhnliche Ordnung angepasster Bürger.[150] Der verliebte Student in Gefallen kümmert sich nicht um die bürgerlichen Konventionen. Er wird ein »besserer Kerl als jemals«, nachdem er seine Geliebte gewonnen hat (2.I, 35). Seinen Trieb empfindet er als Notwendigkeit.
Er fühlte, dass irgend ein selbständig überlegter Wille gegen diesen still-mächtigen Befehl sein Inneres nur in wehevollen Widerstreit versetzt hätte. Nachgeben – nachgeben; es würde das Richtige geschehen, das Notwendige. – (2.I, 33)
Thomas Manns »guter Kerl« ergibt sich dem Notwendigen. Sein Geschlechtstrieb ist für seinen Autor, den Leser Schopenhauers, eine Bejahung des Willens zum Leben über den eigenen Leib hinaus.[151] Belehrt von Heinrich wird Thomas Mann verstanden haben, dass Schopenhauers Weltwille mächtiger ist als sein eigener individueller Wille, wenn der sich dem Trieb moralisch entgegensetzt. Der junge Selten widersetzt sich der üblichen moralischen Konvention und sucht nach einer eigenen Moral. Einmal, nach der Vereinigung mit der Geliebten, hat er eine moralische Hemmung. In ihm kommt die Frage auf, »ob er nicht bei allem Glück ein Lump sei«, allerdings wehrt er sie sogleich ab: »Das hätte ihn sehr geschmerzt.« und: »Aber es war gut und schön.« (2.I, 36) Das Glück der freien Liebe begründet eine eigene Moral. Der studentische Liebhaber verklärt sein Glück mit religiösen Metaphern: Ihm ist »glockenfeierlich im Gemüt, wie etwa bei seiner Konfirmation«, und es war ihm »als sähe er dem lieben Gott mit ernster, schweigender Dankbarkeit ins Angesicht«. Bald danach flüstert er den Namen seiner Geliebten »als andächtiges Morgengebet« (2.I, 36). Ein Gott, der nicht die Geschicke lenkt, sondern das »Leben« ist, tritt in einem Gedicht des jungen Mannes auf und schaut »wehmutsvoll« auf das Glück des Sommers, wissend, dass es endet, wie die Jahreszeiten enden müssen. Die Notwendigkeit der Natur im Geschlechtstrieb setzt sich an die Stelle der alten religiösen Begriffe.
Die geliebte Partnerin nutzt das »gesellschaftliche Übergewicht der Frau von 20 Jahren über den Mann gleichen Alters« (2.I, 37), um sich ihren Freund zu unterwerfen. Sie nimmt ihr Leben in ihre Hand, erkennt, dass sie sich außerhalb der Konventionen des Bürgertums gestellt hat, dass sie nach deren Begriffen nicht mehr ›unschuldig‹ ist: »Es wussten ja doch alle, dass ich sowieso …!«, wird im Text ihr Verstoß gegen die guten Sitten beschrieben. Der Autor hebt das im Druck hervor (2.I, 46). Sie fällt in die traditionelle soziale Rolle der Schauspielerin zurück, für die die Sitten des Bürgertums nicht galten. Ihr sexuelles Glück hat sie von den beschränkenden bürgerlichen Konventionen ihrer Herkunft befreit, aber nicht von der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, in der das Geld herrscht. Auch der Student wird in die Welt geworfen, in der man nicht mehr Gott für sein Glück dankt, sondern in der das Geld regiert. Der Student hatte ein gestörtes Verhältnis zum Geld, er hatte es sich durch lügenhafte Briefe an seine Mutter verschafft (2.I, 18). Diese Briefe verweisen auf die Macht der bürgerlichen Ordnung, die Zahlungsfähigkeit von jedem Bürger verlangt. Dahin weist auch der moralische Schluss, den der ältere Selten aus seiner Geschichte zieht: »Wenn eine Frau heute aus Liebe fällt, so fällt sie morgen um Geld« (2.I, 49). Diese moderne Moral bleibt nicht allein stehen. Der Erzähler macht am Ende darauf aufmerksam, dass der Fliederduft von einem Strauß in einer Vase in Selten die Erinnerung geweckt hat, denn Flieder blühte auf dem Weg zur Geliebten. Es ist von Bedeutung, wenn Selten den Fliederduft tief und langsam einatmet, bevor er den Strauß zerstört (2.I, 49). Die Erinnerung an seine Liebe behauptet sich in ihm für einen emotionalen Moment gegen seine neue zynische Moral.
Der Student Laube fühlt sich nicht widerlegt durch Seltens Geschichte. Sein blondes Haar (2.I, 14) macht ihn anziehend, wie Hans Hansen und Ingeborg Holm in Tonio Kröger. Doktor Seltens schwarzes Haar (2.I, 15) stellt ihn zu anderen problematischen Figuren in Thomas Manns frühem Werk, wie Tonio Kröger, dem er dunkles Haar (2.I, 268) und zart umschattete Augen zuteilt (2.I, 244). Selten hat schwarze Locken (2.I, 18). Seine Geschichte sagt, dass freie Liebe nicht in eine Gesellschaftsordnung passt, die von Geldmitteln bestimmt ist, will diese nicht als vorbildlich-verbindlich-moralisch anerkennen.
Die Liebesgeschichte zwischen dem jungen Selten und einer jungen Schauspielerin ist ein imaginierter Wunsch ihres Autors. Kaum 1894 in München angekommen, entwickelte Thomas Mann eine Schwärmerei für eine junge Schauspielerin des Münchener Hoftheaters. 1952 erinnerte er sich, er habe sie damals hundertmal gesehen in allen ihren Rollen (21, 545). Thomas Manns Brief an Ida Hofmann vom 2. Mai 1894 ist erhalten. Der noch 18-jährige Briefschreiber bittet die zwei Jahre ältere Frau um die Erlaubnis, sie besuchen und ihre Hand küssen zu dürfen, da seine Bewunderung ihres Spiels »nach einem mündlichen Ausdruck« verlange (21, 24). Die Erlaubnis bekam er nicht; Thomas Mann erinnert sich: »sie hat mich nie gesehen«.[152] Im Text von Gefallen erscheinen Worte des Briefes kaum verändert als Aufforderungen Röllings, des älteren Freundes des Studenten (2.I, 20; 21, 24).
Ein Vorbild der Figur Rölling ist Bruder Heinrich. In der Fiktion ist Rölling der ältere Freund des Erzählers aus dessen Heimat, der jetzt für den gleichen Beruf studiert (2.I, 19 f.); er hat früher Novellen verfasst (2.I, 17). Er kann sich eine »sentimentalisch[e]« Liebe gar nicht vorstellen, (2.I, 20). Heinrich wird 1894 nicht aufgehört haben, sich Sorgen um homosexuelle Neigungen des Bruders zu machen. Vermutlich hat er die Neigung seines Bruders für Ida Hofmann ermutigt, und diese Ermutigung bildet sich ab in Röllings Reden.
Das französische Original des Begriffes »Seelenstände«, das in literarischen Gesprächen mit Heinrich vorgekommen sein muss, bringt Thomas Mann in seinem Text zum Spaß unter: Als der Student seine Geliebte das zweite Mal besucht, hat er seine Schüchternheit verloren. Der Erzähler kommentiert das so: »All die exaltierten états d’âme, die das erste Mal die Liebesscheu in ihm wachgerufen, kamen da schon in Wegfall.« (2.I, 29). Das französische Zitat sagt dem Lehrmeister Heinrich: Ich weiß, was als modisch gilt, aber ich spiele nur damit.
Gefallen erschien im November 1894 in Die Gesellschaft, geleitet von Michael Georg Conrad, der eine heimliche Liebesaffäre mit der Lübecker Schriftstellerin Ida Boy-Ed hatte, die mit der Mann-Familie bekannt war.[153] Wahrscheinlich hatte Ida Boy-Ed Thomas Manns Novelle empfohlen.
Der Druck von Gefallen und die freundliche Teilnahme des damals berühmten Schriftstellers Richard Dehmel ermutigten Thomas Mann 1894 und 1895 eine Anzahl neuer Texte zu schreiben. Von der verlorenen Erzählung Der kleine Herr Professor ist in Briefen die Rede. Vermutlich ist sie die Vorstufe von Der kleine Herr Friedemann. Aus Walter Weiler wurde Der Bajazzo. Aus Mitleid entstand ebenfalls schon 1894 (21, 30); vielleicht wurde Tobias Mindernickel daraus. Ein Märchenspiel in Versen Der alte König, entstand 1894–1895 (21, 30; 21,45; TM / OG, 27). Vielleicht war es eine politische Satire. Denn Thomas Mann schrieb scherzhaft an seinen Freund Otto Grautoff, die Autoren Ludwig Fulda und Leo Melitz, letzterer ein Verfasser von Schauspiel- und Opernführern, sollten vor seinem Stück »erbleichen« (21,30). Offenbar war Der alte König mit Fuldas Märchenspiel in Versen Der Talisman (1892) vergleichbar. Fulda benutzte die Handlung des Märchens von Hans Christian Andersen, Des Kaisers neue Kleider, um das absolute Königtum zu verspotten, dem Kaiser Wilhelm II. im modernen Deutschland nacheiferte. Thomas Manns Text ist verloren. Am 17. Januar 1896 gibt er in einem Brief an Grautoff die Entstehungsdaten und die Entstehungsorte von 1895 geschriebenen, ungedruckten Texten an: Im Mondlicht, Begegnung (vermutlich Vorstufe von Enttäuschung) und den verlorenen Essay Zur Psychologie des Leidenden (21, 64). Der einzige 1895 entstandene Text, der veröffentlicht wurde, ist Der Wille zum Glück (21, 64). Am 27. Februar 1896 schreibt Thomas Mann wieder von einer Novelle mit dem merkwürdigen Titel ›Im Frühling aufzuhören‹, die nicht erhalten ist.[154] Vielleicht war das eine Vorstufe der Tagebuch-Erzählung Der Tod.