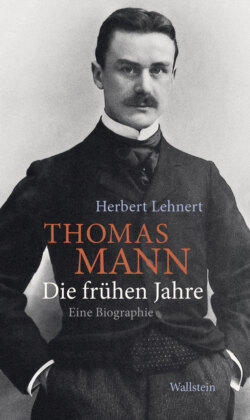Читать книгу Thomas Mann. Die frühen Jahre - Herbert Lehnert - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heinrich Mann verlässt die Kaufmannswelt
ОглавлениеBruder Heinrich hatte mit vierzehn Jahren zu schreiben begonnen, vielleicht früher. Gedichte entstanden im Stil von Heinrich Heine, den er sehr schätzte, auch kleine Prosa-Erzählungen, von denen er gelegentlich eine in einer Lübecker oder Berliner Zeitung unterbrachte. Sie verraten Heinrichs Bedürfnis, die deutsche kaufmännische Welt, in der er aufgewachsen war, zu verlassen. Einige seiner frühen Geschichten versetzen Autor und Leser in ein imaginiertes Milieu des hohen Adels, andere spielen in Paris oder Italien. Heinrich war ein mittelmäßiger Schüler, begann aber, siebzehn Jahre alt, seine Zeit so sehr zum Schreiben und zum Lesen moderner Literatur zu nutzen, dass er im Jahr 1889 das Klassenziel des zwölften Schuljahrs (damals ›Obersekunda‹) nicht erreichte und im Herbst des gleichen Jahres die Schule verließ. Heinrich erklärte, Buchhändler werden zu wollen, weil der enttäuschte Vater auf einer Berufsausbildung bestand. Er trat im Herbst 1889 eine Lehre in Dresden an. Er wollte in eine Großstadt ziehen, Lübeck genügte ihm nicht.
Sein Vater war der Lübecker Senator Thomas Johann Heinrich Mann, Besitzer eines Getreide-Großhandels. Er hatte sich literarische Kenntnisse erworben, obwohl er schon mit vierzehn Jahren den Kaufmannsberuf erlernen musste. Er hatte zu viel Respekt für erfolgreiche, gut gebildete Schriftsteller, um an Heinrichs Berufung zum Schriftsteller zu glauben. Heinrich hielt jedoch an seinem Ziel, Schriftsteller zu werden, fest und betrieb in Dresden ein intensives Selbststudium. Wir können das gut verfolgen, weil er, statt eines Tagebuchs, in ausführlichen Briefen an seinen Lübecker Freund Ludwig Ewers von seinen Studien berichtete. Die meisten Briefe sind erhalten.[3]
Heinrich Mann las Romantiker und Theodor Storm; seine Lieblingsschriftsteller waren Heine und eine Zeit lang der Lübecker Klassiker-Epigone Emanuel Geibel. Diese, und den siebzigjährigen Theodor Fontane las bald nach ihm auch sein Bruder Thomas. Heinrich schätzte Michael Georg Conrad, der in seiner Zeitschrift Die Gesellschaft gegen die christlich fundierte Moral und die bürgerliche Prüderie opponierte, Émile Zola und Richard Wagner empfahl. Conrad war einer der ersten Leser und Anhänger Nietzsches. Heinrich empfahl seinem konservativen Freund Ewers, dem Empfänger der tagebuchartigen Briefe, Die Gesellschaft zu lesen, in der moderne ›Realisten‹ veröffentlichten. Wenig später nannte man diese modernen Autoren ›Naturalisten‹. Auch Thomas Mann las Die Gesellschaft schon als er noch zur Schule ging.[4]
Heinrichs erster gedruckter Text erschien im April 1890 in einer Lübecker Zeitung, eine Gegenkritik zur Verteidigung von Hermann Sudermanns Drama Die Ehre, das im November 1889 großen Erfolg bei der Berliner Erstaufführung gehabt hatte. Ein Lübecker Richter, literarisch gebildet im Geist der Goethezeit, hatte in einer anderen Lübecker Zeitung gegen den groben Naturalismus des Stückes geschrieben. Heinrich verteidigte die Wahrhaftigkeit in Sudermanns Drama und ließ ein Lob der sozialen Bestrebungen Kaiser Wilhelms II. einfließen, demselben, dem später seine Verachtung galt.[5]
Für eine philosophische Grundierung seiner Weltanschauung griff Heinrich Mann nicht zu Hegel und dem deutschen Idealismus wie viele deutsche Schriftsteller der Zeit, sondern zu Schopenhauer, einer Philosophie, die einen Schöpfergott nicht brauchte, während Hegels Philosophie, nach der Erkenntnis der Ganzheit der Welt, dem »Absoluten« fragend, den Gottesgedanken nicht ausschloss. Schopenhauers Weltsystem war pessimistisch im Gegensatz zu dem christlichen Versprechen einer endlichen Erlösung in Gott. An die Stelle einer »Substanz«, dem Grund allen Seins, setzte Schopenhauer den zeit- und ortlosen ›Willen‹.
Schopenhauers Weltsystem verbindet, was widersprüchlich erscheint: Wir haben die Welt uns gegenüber und zugleich in uns. Schopenhauers ›Wille‹ beugt sich nicht der Logik, ist nicht einmal ein Objekt, das angeschaut werden kann. Der Wille in uns, ein dumpfer Drang, zwingt uns zur Bewahrung unserer Existenz, zwingt auch alle anderen Wesen, belebt oder unbelebt. Deren Streben gegeneinander verursacht Leiden. Was uns als Objekt gegenübersteht, ist Kants »Vorstellung«, die Welt, wie sie uns in Zeit und Raum erscheint. Kant hielt das ›Ding an sich‹, ein Ding außerhalb von den Formen von Raum und Zeit, für unerkennbar. Schopenhauer hielt den Willen zur Existenz, zum Leben, für das ›Ding an sich‹, für die Welt im Ganzen. Erlösung von der Qual des ewig für sich streitenden ›Willens‹ kann der Mensch erlangen, wenn er oder sie den konkurrierenden ›Willen‹ durch Mitleid ersetzt. Erlösen kann auch die Kunst. In ein geniales Kunstwerk versunken, kann der Mensch den egoistischen Willen verneinen, kann Bilder der Welt genießen als entstanden aus platonischen Ideen. Schopenhauer galt die Musik als die höchste Kunst; sie war ihm ein Ausdruck des ›Willens‹ selbst.
Nach Schopenhauer studierte Heinrich Mann seit Januar 1891 Friedrich Nietzsche.[6] Dieser hatte zuerst Schopenhauers tragischen Pessimismus angenommen, erhob dann aber das Konzept des ›Willens‹ als »Wille zur Macht« zu einem positiven Prinzip des Lebens. Seine Moralphilosophie hat Nietzsche fast überall in seinem Werk ausgedrückt, besonders in Morgenröthe, in Jenseits von Gut und Böse und in Zur Genealogie der Moral. Herren unterwerfen das Volk, die »Herde«. Für die Herrenmoral ist »gut«, wer zu den Herren gehört, wer Macht hat und übt, »schlicht«, »schlecht« ist, wer nicht aus der Herde hervorragt. Für die Unterworfenen ist gut, was allen nützt; böse ist das Streben nach eigener Macht, das die Ordnung des Ganzen stört. Eine Moral, die die Liebe aller und Gehorsam für die Gebote eines Gottes verlangt, wie die judeo-christliche Religion, ist für Nietzsche eine Sklavenmoral. Nietzsche hielt eine Umwertung aller Werte für nötig, nach Einsicht in eine harte, realistische, soziale Ordnung.
Eine Wirkung seiner Nietzsche-Lektüre zeigt sich in einem Brief Heinrichs an den Freund Ludwig Ewers: »eine objektive Wahrheit ist für mich nirgends vorhanden«.[7] Noch am 12. Mai 1892 ist Nietzsche Heinrichs »Hauptlektüre«.[8] Eine Klassen-Moral zeigt sich, wenn er am 8. September 1891 an Ewers schreibt: »ich bin […] praktisch für fast absolute Monarchie, katholische Kirche, aus Interessenpolitik – theoretisch dagegen vollkommen Anarchist«.[9]