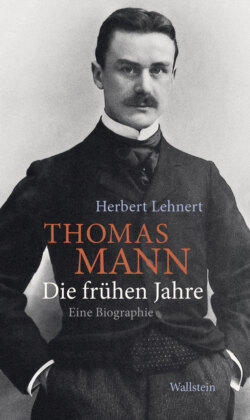Читать книгу Thomas Mann. Die frühen Jahre - Herbert Lehnert - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Lehrer Brandes
ОглавлениеBruder Heinrich besaß das große Werk des Dänen Georg Brandes Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts und hatte es gründlich studiert. Darin folgte ihm sein Bruder nach. In seinem Essay Kritik und Schaffen, erschienen in Das Zwanzigste Jahrhundert von 1896, nennt Thomas Mann Georg Brandes neben Charles Augustin Sainte-Beuve und Jules Lemaître, die er durch Brandes kennen gelernt hatte. Diese »Kunstkenner« seien »neugierige, feingeistige Menschen, immer auf der Suche nach einer künstlerischen Persönlichkeit, in der sie verschwinden, in der sie aufgehen, in die sie sich verwandeln können«. Der Kritiker dürfe ein »Überlegenheitsgefühl« über den naiven Künstler haben, einen »Willen zur Macht« (14.I, 48 f.). Kritik sei Spiel mit Einfühlung in die Rollen der Erzähler und Figuren. 1898, als er sich von Heinrich und von dessen Brandes-Ausgabe trennte, schaffte er sich seine eigene an.
Brandes’ Hauptströmungen bilden die Grundlage für Thomas Manns literarische Bildung. Thomas Mann hat das nur gelegentlich öffentlich anerkannt.[122] Einige späte Erwähnungen Brandes’ zeugen für seinen Respekt. Ein Brief, den Thomas Mann am 10. Februar 1927 auf die Nachricht von Brandes’ Todeskrankheit an die Kopenhagener Zeitung Politiken geschickt hatte, erschien dort in dänischer Übersetzung als Nachruf. Thomas Mann feierte darin Brandes, den »von jung auf verehrten Mann« als einen Angehörigen jener europäischen Tradition, »der wir heute Fünfzigjährigen unsere Erziehung verdanken«. Brandes’ Hauptströmungen seien die »Bibel des jungen intellektuellen Europa vor 30 Jahren« gewesen.[123] Thomas Mann regte im Februar 1908 die Einladung zu einem Vortrag Brandes’ in München an.[124] 1945 lobt er gegenüber Anna Jacobson, einer deutschen Germanistin im amerikanischen Exil, Brandes’ »Klarheit«, die ihm immer erquicklich gewesen sei, aber er setzt diesmal hinzu: »Er hatte viel von einem geistreichen alten Weib mit boshaftem Klatschmaul«.[125] 1929 lobte er die Literaturgeschichte von Arthur Eloesser wegen ihrer Lesbarkeit, eine »Wirkung, wie Dichtung und Literatur sie selber üben – ich habe, seit ich Brandes’ Hauptströmungen las, dies Gefühl der kritischen Anregung nicht wieder so lebhaft gehabt« (GW X, 728).
Georg Brandes’ Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts richten sich gegen romantisch-reaktionäre literarische Tendenzen. Brandes’ ästhetischer Wertmaßstab war der bürgerliche Realismus. Seine Vorlesungen beschränkten sich auf die französische, britische und deutsche Literatur, vergleichend ging er auf die dänische ein. Diese Literaturen verglich er immer wieder untereinander, so dass der Leser eine Überschau über die europäische Literatur gewann. Er belebte seine Vorlesungen häufig mit Erzählungen aus der Biographie der Schriftsteller.
In der Einleitung zu Die Reaktion in Frankreich, dem dritten Band seiner Hauptströmungen, spricht Brandes über das »Autoritätsprinzip«, das der Modernismus nicht mehr gelten lasse, zu der Autoren und Leser jedoch nostalgisch zurückblickten.[126] Die Französische Revolution habe die religiöse Autorität gestürzt, nachdem Voltaire und Rousseau sie schon untergraben hatten. Während der Reaktion im 19. Jahrhundert sei das Autoritätsprinzip jedoch immer wieder geltend gemacht worden, so dass konservative und fortschrittliche Tendenzen nebeneinander bestanden.
Thomas Mann ließ sich keineswegs durch Brandes’ liberale Tendenz von der Lektüre abhalten. 1909 trägt er in sein Notizbuch 9 ein:
Aus Pamphleten lernen: meine Spezialität. Für den Psychologen sind Lit[eratur]-Pamphlete unvergleichlich reizvoller als Verhimmelungen. Brandes über die deutsche Romantik etc. (Nb.II, 182 f.).
In den Betrachtungen eines Unpolitischen charakterisiert Thomas Mann Brandes einmal so: Er sei gewiss »immer ein liberaler, namentlich aber ein freier Mann« gewesen. Das habe er bewiesen, als er Bismarck gegen die Freisinnigen verteidigt habe (13.I, 382 f.).
Obwohl Brandes die deutsche Romantik für »schon in ihren Quellen vergiftet« hält,[127] verschweigt er deren fortschrittliche Seite nicht. Fichtes Lehre von Ich und Nicht-Ich sei ein Notruf »nach Poesie und Freiheit, der jedoch willkürlicher Freiheitsrausch« bleibe.[128] Den Wert von Novalis’ Lyrik erkennt Brandes an, tadelt aber die Zeitvergessenheit, die Thomas Mann, der Schopenhauer-Leser, eher tolerierte. In Friedrich Schlegels Roman Lucinde hebt Brandes die Werbung für die Emanzipation der Frauen lobend hervor, findet aber die »künstlerische Ohnmacht« des Romans widerwärtig.[129] Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts beschreibt Brandes mit Zuneigung, obwohl er doch die fortschrittsfeindliche Romantik verurteilt hat. In dem Buch »summt und klingt die ganze ursprüngliche Romantik wie in einem Käfig eingeschlossen«,[130] der Taugenichts sei der »Repräsentant des romantischen Suchens und Sehnens«.[131]
Die Bewegung Das junge Deutschland erhält einen eigenen Band von Brandes’ Hauptströmungen, in dem Brandes sowohl Ludwig Börne als auch seinem Gegner Heinrich Heine gerecht zu werden sucht. Als Jude geboren, habe Börne sich der deutschen demokratischen Freiheit zugewendet. Ein Kapitel handelt von Hegels Philosophie. Brandes stellt sehr anschaulich den alten Hegel auf den Katheder, wie er in Berlin mit schwäbischem Akzent vorträgt, nach Worten sucht, aus verwickelten Perioden nicht immer herausfindet. Die konservative Rechtsphilosophie stellt Brandes in ihren europäischen Rahmen: Englische Einflüsse hätten sie angeregt.[132]
Brandes beschreibt die französische Romantik als liberale und revolutionäre Tendenz – anders als die deutsche Romantik. Ihr Hintergrund sei die neue Vermögensverteilung nach der Revolution gewesen. Die Jagd nach dem Gelde sei der vorherrschende Zug der Zeit, vor dem die romantischen Schriftsteller sich in südliche Länder und in die romantische Vergangenheit zurückgeträumt hätten. Die große Ausnahme sei Balzac, der, wie Brandes sich ausdrückt, das Geld zum Helden eines großen Epos macht.[133] Balzac habe als erster den Geldmangel als ein Gefühlsmoment, stärker als Liebe, in den Roman eingeführt.[134] Diesem modernen Zug habe aber Balzacs sozialer Konservativismus widersprochen.
Balzac und Stendhal seien für Brandes die Schöpfer des modernen Romans.[135] Brandes erkennt Balzacs Größe an, tadelt jedoch dessen romantische Tendenzen. Balzacs katholisch gefärbte Darstellungen der Pflichttreue und der Wohltätigkeit würden bisweilen »schwülstig und sentimental«.[136] Balzac habe sich auf die »geheimen Wissenschaften« eingelassen. In drei seiner Romane werde der Wille als eine Kraft definiert, die, wie der Dampf, »nach Belieben Alles, sogar die absoluten Gesetze der Natur modifizieren könne«.[137] Der Schopenhauer-Leser Thomas Mann notierte sich das Ende 1894 als Eigenschaft des ›Willens‹ ohne Brandes’ ablehnenden Tadel zu vermerken (Nb.I, 49).
Brandes legt viel Gewicht auf die Autorität, die ein Autor wie Victor Hugo sich erwarb: »Seine Haltung war die eines Führers und Propheten«[138] und: »Nicht das feinste und auserlesenste poetische Talent ist es, das die Leitung in der Literatur behauptet. Sie fällt nicht dem Talent zu, sondern der ganzen Persönlichkeit. Derjenige, der zu einem gegebenen Zeitpunkt das Herz der Zeit in seiner Brust pochen fühlt, die Gedanken der Zeit in seine Intelligenz aufnimmt und den festen Willen hat, der Literatur den Stempel seiner Gefühle und Ideen und die des Zeitalters aufzudrücken, der ist der geborene und bleibende Führer.«[139] Brandes beschrieb die Wunschträume beider Brüder Mann.
Die Brandes-Lektüre hat Spuren in Buddenbrooks hinterlassen. In seinem zweiten Band, Die romantische Schule in Deutschland, behandelt Brandes die Vorliebe deutscher und französischer Romantiker für wilde Landschaften.[140] In diesem Sinn protestiert der jüngere Johann Buddenbrook gegen die Absicht seines Vaters, die Büsche im Garten der Buddenbrooks beschneiden zu lassen (1.I, 34). Derselbe jüngere Buddenbrook, genannt Jean, möchte bei Musik seinen Träumen und Gefühlen nachhängen (1.I, 41). Brandes sagt von der deutschen Romantik: »Sie ist nicht plastisch, sondern musikalisch. Die französische Romantik bringt feste Gestalten hervor, das Ideal der deutschen ist nicht eine Gestalt, sondern eine Melodie, keine einzelne Form, sondern ein unendliches Sehnen.«[141] Das musste Thomas Mann sympathisch berühren, weil er sein Schreiben als romantisch-musikalisch verstand.
Ein anderes Brandes-Echo in Buddenbrooks stammt aus der Einleitung zum sechsten Band, Das junge Deutschland. Dort las Thomas Mann von den deutschen Burschenschaften in der nach-napoleonischen Restauration[142] und wendete dieses Wissen auf Morten Schwarzkopf an. (1.I, 146, 149–151). – In der Szene gegen Ende des Romans, in der Thomas Buddenbrook seiner Schwester seine zunehmenden Depressionen erklärt, kommt das »türkische Sprichwort« vor, das Thomas Buddenbrook irgendwo gelesen haben will: »Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod« (1.I, 473). Der Autor der Buddenbrooks hat dieses Sprichwort in Brandes’ fünftem Band (in Heinrich Manns Besitz) gelesen, wo er Balzacs Tod kommentiert.[143]