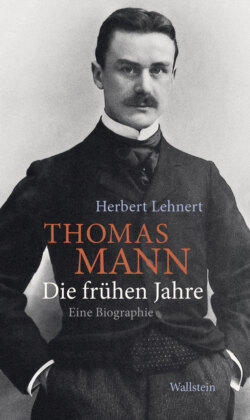Читать книгу Thomas Mann. Die frühen Jahre - Herbert Lehnert - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Briefe an Otto Grautoff I
ОглавлениеEine allzumenschliche Seite des angehenden Schriftstellers Thomas Mann lernen wir kennen in seinen Briefen an den Lübecker Schulfreund Otto Grautoff. Im Lebensabriss von 1930 charakterisierte Thomas Mann die Beziehung zu diesem Freund, auf die Schulzeit zurückblickend, so:
Fast während der ganzen Dauer dieser stockenden und unerfreulichen Laufbahn verband mich mit dem Sohn eines fallierten und verstorbenen Buchhändlers eine Freundschaft, die sich in phantastischem und galgenhumoristischem Spott und Hohn über »das Ganze«, namentlich aber über die »Anstalt« und ihre Beamten bewährte.[86]
Die Freundschaft hielt mehr als zehn Jahre über die Schulzeit hinaus und manifestierte sich in Form eines Briefwechsels, von dem nur Thomas Manns Handschriften erhalten sind; sie beginnen im September 1894. Es ist nicht der gesamte Briefwechsel erhalten, einige der Briefe liegen nur zerrissen oder in miserablem Zustand vor.[87] Was erhalten ist, ist unentbehrlich für unser Verständnis von Thomas Mann.
Grautoff war ein Jahr jünger als sein Freund und lange sein Mitschüler. Er kam aus einer gut-bürgerlichen, aber verarmten Familie. Ein Großvater war Bibliotheksdirektor. Grautoff wollte Schriftsteller werden; seine Familie besorgte ihm eine Lehrstelle in einer Buchhandlung in Brandenburg an der Havel. Grautoff hatte im April 1894 diese Lehre begonnen und litt unter seiner eingeschränkten Existenz als armer Lehrling im provinziellen Brandenburg. Thomas Mann dagegen war seine Lehre losgeworden, hatte die Erzählung Gefallen geschrieben, die im November veröffentlicht werden sollte und erfreute sich seiner Freiheit.
Obwohl Thomas Mann während des letzten Schuljahres die Freundschaft eines Grafen Vitzthum und einiger anderer Mitschüler vorgezogen und die mit Grautoff vernachlässigt hatte (21, 49), hielt dieser an der Beziehung fest und suchte Rat und Hilfe von Thomas Mann. Auch er wollte schreiben, wollte die Lehre in Brandenburg aufgeben, nach Berlin ziehen und sich dort durch freie Mitarbeit in Zeitungsredaktionen über Wasser halten. In seinem ersten erhaltenen Brief vom September 1894 rechnete Thomas Mann dem Freund realistisch vor, dass er in Berlin mit den geringen Mitteln, die er von seiner Familie bekam, nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten könne. Im folgenden Brief vom 22. September spottet er über eine andere Idee Grautoffs, der ihm verkündet hatte, zur Bühne gehen zu wollen. Als »Antrittsrolle« empfiehlt Thomas Mann dem Freund, zwischen Romeo und Julia zu wählen. Nach einer nicht mehr leserlichen, bewusst getilgten Passage heißt es weiter: »und würdest durch wahres Empfinden eine unsägliche Wirkung erzielen, etwa bei den Worten: ›Komm, Nacht … […]‹«. Thomas Mann zitiert aus der deutschen Übersetzung des Monologs der Julia, in Shakespeares Romeo und Julia, dritter Akt, zweite Szene, in der Julia ihr Liebesverlangen ausspricht. Julia sehe nichts als Unschuld in inniger Liebe Tun. Diese Worte unterstreicht Thomas Mann und fügt hinzu: »Verzeih, wenn ich neckisch wurde« (21, 29). Wer den Text des Briefes verstümmelt hat, wollte etwas Peinliches verbergen. Das »Tun in inniger Liebe« im Monolog der Julia ist der Vollzug ihrer heimlichen Ehe. Vermutlich hat Grautoff während der Gespräche in Lübeck über beider homoerotische Sehnsüchte oder in einem seiner Briefe erklärt, dass er seinen Freund Thomas liebe. Ein solches Geständnis würde Thomas’ Gefühl der Überlegenheit gegenüber Grautoff erklären. Auf Thomas Manns Spott muss Grautoff empfindlich und zornig reagiert haben. Thomas schreibt im nächsten Brief, er habe von seinem Freund »wuchtige Schläge« erhalten, dabei habe er nur »Spott und Ulk« ausdrücken wollen (TM / OG, 9). Die Freunde nannten eine satirisch übertreibende Sprache, die es mit der Wahrheit nicht allzu genau nahm, »gippern« (21, 28).
Bald lenkt Thomas Mann ein und gesteht auch seine Liebe im Brief vom 5. März 1895. Er sehe es nicht als unangenehm an, was Grautoff über ihr Verhältnis geschrieben habe. Oft sehne er sich jetzt, entfernt in München, »nach unseren merkwürdigen Zusammenkünften« und »warum soll ich es nicht sagen – nach dir«. Er habe viele Freunde in München, »aber wirklich befreundet, wirklich intim bin ich doch nur mit einem gewesen, und das warst du«. Er will aber auch Diskretion: Er hätte Grautoff in letzter Zeit viel mitzuteilen gehabt, aber schriftlich ginge das nicht (21, 42). Ein folgender Brief ergänzt: »Wir waren schamlos voreinander, in einem intellektuellen Sinn, und wir verständigten uns über die heikelsten Intimitäten«, in einer Weise, die »kein anderer verstanden hätte« (21, 50).
Das ist so zu deuten: Während der Schulzeit in Lübeck trafen die Freunde sich in einem Restaurant und sprachen in intimen Andeutungen über ihre erotischen Gefühle, die sie vor der Familie verleugnen oder verbergen mussten. Das Gespräch mit dem intimen Freund konnte den Druck, der die Freunde zur Heimlichkeit gezwungen hatte, mindern, und diese Erleichterung fehlt dem Briefschreiber jetzt. Seine Beziehung zu Grautoff ist erotischer Natur, aber gestört durch einen immer wieder auftretenden Drang, Grautoff herabzusetzen,[88] vielleicht weil er einen Ausgleich brauchte für sein Gefühl der Unterlegenheit gegenüber seinem Bruder Heinrich. Grautoff scheint auf Thomas’ Bekenntnis skeptisch reagiert zu haben, was Thomas Mann ausgleichen will, indem er zugibt, in Lübeck seine Freundschaft mit Grautoff vernachlässigt zu haben.
Im Brief vom 5. März 1895 antwortet Thomas Mann auf Gedanken über die Liebe, die Grautoff in seinen Briefen geäußert hatte. Grautoff brauche den Unterleib nicht ganz und gar zu verachten, denn er enthalte viel »Poesie«, wenn man ihn mit »Gemüt und Stimmung« umwickele: »du darfst es aber gern; ich thu’s nämlich auch«. Denn auch Thomas Mann habe sich zum Asketen entwickelt und schwärme in seinen schönsten Stunden »für reine ästhetische Sinnlichkeit, für die Sinnlichkeit des Geistes, für den Geist, die Seele, das Gemüt überhaupt« (21, 42). Liebe könne in »Poesie« ausgedrückt werden, das körperliche Verlangen lasse sich kreativ verwandeln.
Im selben Brief tadelt Thomas Mann seinen Freund, weil der einen Artikel des Schriftstellers Friedrich Spielhagen in der Zeitschrift Die Zukunft missverstanden habe. Spielhagen hatte einen satirischen Aufsatz zu der Diskussion der ›Umsturzvorlage‹ beigetragen, dem misslungenen Versuch der preußischen Regierung, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Spielhagen stellte mit Sarkasmus dar, wie dieses Gesetz eine reaktionäre Literatur erzeugen würde. Grautoff hatte den Sarkasmus ernst genommen und glaubte, Spielhagen treibe konservative Propaganda. Thomas Mann erklärt Grautoff, die ›Umsturzvorlage‹ sei ihm gleichgültig, er werde nicht in die Versuchung kommen, Umsturz zu erregen: »meine Muse ist keine reisige Maid, die zürnend dreinschlägt, sondern ein liebliches Mägdlein, das Kränze windet und leise singt. Aber, weil ich nicht nur meine Kunst, sondern die Kunst überhaupt liebe, muss ich die Vorlage allerdings ebenfalls verurteilen« (21, 44). Der Reichstag lehnte die ›Umsturzvorlage‹ ab.
Ein bemerkenswert positives Urteil über Bruder Heinrichs Erzählkunst findet sich in einem Brief vom 16.-17. Mai 1895, vor der ersten Romreise geschrieben. Grautoff hatte Erzählungen Heinrichs negativ bewertet. Ein solches Urteil sei »verdammt einfältig«, er verstehe Heinrichs »feine[ ] und reserviert vornehme[ ] Sprache« nicht, nicht seine »eminente[ ] Psychologie« (21, 56). In diesem Brief findet er immer neue Lobsprüche für Heinrichs Erzählungen. Das »Schönste, das Großartigste, das Wunderbarste«, was Heinrich bisher geschrieben habe, sei seine Novelle Das Wunderbare (21, 57), die in einem Novellenband erscheinen werde.
Die Freunde schicken sich literarische Versuche zu und beurteilen sie. Thomas Manns Urteile sind meist negativ, hart und direkt. Nach einer solchen negativen Beurteilung von Gedichten Grautoffs, findet sein Freund, dass Grautoff Prosa besser schreibe als Lyrik, fügt dem zweifelhaften Lob jedoch hinzu: »Aber kritisch scheinst du wenig begabt zu sein«. Grautoff hatte Hermann Sudermanns Drama Heimat gelobt und dessen Komödie Die Schmetterlingsschlacht getadelt. Es verhalte sich umgekehrt, weiß Thomas Mann: »in der Heimat war Sudermann ein vor dem Geschmack der misera plebs kriechender Kompromissler ohne jedes künstlerische Gewissen, – und hatte Erfolg; in der ›Schmetterlingsschlacht‹ versuchte er es, ein Dichter zu sein und – ward ausgejohlt« (21, 34). Diese Urteile über Sudermanns Dramen hatte Thomas Mann gerade in Maximilian Hardens Zeitschrift Die Zukunft gelesen.[89]
Ohne die Sorge, den Neid des einsamen Freundes zu erwecken, führt Thomas Mann Grautoff seinen Erfolg mit Gefallen vor. Den lobenden Brief, den er von Richard Dehmel darüber erhalten hatte, schreibt er Wort für Wort ab (21, 37 f.). Von seinem Studium erzählt er ohne viel Rücksicht auf Grautoff, der nur aus Geldmangel ein Gasthörer-Studium in Berlin nicht aufgenommen hat. Thomas Mann ist Mitglied einer Münchener Studentenvereinigung geworden, dem Akademisch-Dramatischen Verein. Jedes Semester führte der Verein ein Stück öffentlich auf. Für das Wintersemester ist, angeregt von Thomas Mann, Ibsens Die Wildente vorgesehen. Er selbst hat die Rolle des Großhändlers Werle übernommen (21, 43). In einem Brief vom 27. Februar 1896[90] meldet Thomas Mann, er habe die Novelle Im Frühling aufzuhören geschrieben; sie ist leider verloren. Auf Grautoffs abfällige Kritik eines »Manuskriptchens« von Thomas Mann reagiert dieser positiv im Brief vom 29. März 1896 und lässt seinen Freund diesmal gelten, gibt ihm das Recht, ihn zu kritisieren, freut sich sogar, dass Grautoff »auch verurteilen« kann.
In seinen Briefen stellt Thomas Mann mehrfach in Aussicht, dass er daran denke, sich für einige Zeit in Berlin niederzulassen. In Berlin könnten die Freunde sich zu Gesprächen treffen. Grautoff wünscht eine solche Zusammenkunft sehr (21, 59), in einem Brief vom 18. Juni 1895 begründet Thomas Mann, warum er nicht reisen kann: Es gebe in München ein Mädchen, das noch immer nicht genug Rosen von ihm bekommen habe. Diesem Mädchen galt wohl das Gedicht, das in der Januar-Ausgabe 1895 der Zeitschrift Die Gesellschaft erschien:
Siehst du, Kind, ich liebe dich,
Da ist nichts zu machen;
Wollen halt ein Weilchen noch
Beide drüber lachen.
Aber einmal, unverhofft,
Kommen ernste Sachen, –
Siehst du, Kind, ich liebe dich,
Da ist nichts zu machen! (3.I, 135)
Das angeredete »Kind« ist wahrscheinlich Ina Bruhn, die fünfzehnjährige Tochter des Direktors der Versicherung, in der Thomas Mann einige Monate Lehrling war.[91] Im Brief an Grautoff teilt er sich die Rolle des Brackenburg zu, des aussichtslosen Liebhabers in Goethes Egmont, und nennt sich selbst einen »entartete[n] Schwächling« (21,60), im Kontrast zu der Rolle des überlegenen Freundes, die er Grautoff gegenüber annahm.
Im nächsten Brief vom 30. Juni [1895][92] bekennt Thomas Mann, er sei »gründlich verliebt«. Sein Kopf sei voll von »merkwürdigen und aufregenden Gedanken«, er müsse sich über seine »Psychologie in eroticis wieder einmal ›klar‹ […] werden«. Das »wieder einmal«, an Grautoff gerichtet, bezieht sich auf die Lübecker Gespräche mit dem Freund über homoerotische Liebe. Die jetzt geltende heterosexuelle Liebe hat den gleichen Rang wie die vergangenen homoerotischen. »Liebe ist bei mir gänzlich verrotteten Wesen immer bloß ein ganz künstlicher Rausch, – aber ein Rausch immerhin, der so stark ist, das[s] er mich zu den sonderbarsten und frechsten Schritten zu treiben vermag, wie ich sie in diesen Tagen einer nach dem anderen tue.« Solch freche Schritte waren die Besuche bei Ina Bruhn und vielleicht auch das Gedicht in Die Gesellschaft. Der Brief soll Grautoff wissen lassen, dass sein Freund heterosexuelle Gefühle hat, dass er sich nicht seiner homoerotischen Gefühle schämt, nicht an ihnen leidet.
In diesem Brief vom 30. Juni [1895], in dem er von seiner Verliebtheit schreibt, reagierte er auch auf einen Bericht Grautoffs über dessen Arztbesuch bei einem Assistenten des Berliner Psychiaters Albert Moll. Thomas Mann wisse immer noch nicht »das intim Persönliche« von Grautoffs Krankheit, und er bittet ihn, ihm seinen Fall »deutlich und offenherzig« darzulegen. Aus späteren Briefen geht hervor, dass Grautoff seine Homoerotik behandeln lassen wollte. Thomas Mann möchte alles wissen über die Art und Weise, wie der Arzt das »intim Persönliche deines Falles« beurteile und behandle. Thomas Mann würde alles »verstehen«, was Grautoff ihm schreibe, um nicht zu sagen: »kennen«, denn er selbst sei »wackelig«. Hier nimmt Thomas Mann etwas von seiner selbstsicheren Überlegenheit zurück, die er in anderen Briefen Grautoff vorgespielt hatte. Sein Arzt hatte Grautoff eine Medizin verschrieben, vielleicht gegen Neurasthenie. Thomas Mann möchte, dass Grautoff ihm das Rezept schickt. Er erwähnt in dem Brief seine Lektüre von Molls Buch Conträre Sexualempfindung, über das er urteilt: »Es strotzt von Humanität«.
Die Berlin-Reisepläne störte Bruder Heinrich mit einem nicht überlieferten Brief, der am 10. Juli 1895 in München ankam und Bruder Thomas nach Rom rief (21, 61). Auf einer Postkarte aus Rom vom 5. Oktober 1895 erklärt Thomas Mann sich von Rom begeistert (TM / OG, 60). Die Abneigung, die Jahre später Tonio Kröger in der gleichnamigen Erzählung äußert (2.I, 281 f.), gehört zur Figur und dient dort der Polemik gegen Heinrichs Roman-Trilogie Die Göttinnen. Den Sommer 1895 verbrachten die Brüder in Palestrina. Heinrich schrieb für Das Zwanzigste Jahrhundert, Thomas nahm teil und revidierte seine ungedruckten Erzählungen.