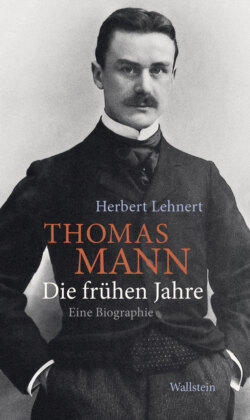Читать книгу Thomas Mann. Die frühen Jahre - Herbert Lehnert - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Maximilian Hardens Zeitschrift Die Zukunft
ОглавлениеDie Wochenzeitschrift Die Zukunft spiegelte die Interessen des deutschen Bildungsbürgertums seit den 90er-Jahren bis zum Ausbruch des Weltkrieges 1914 und noch einige Zeit danach. Das war auch die Zeit der Regierung Kaiser Wilhelms II., nach der Entlassung Bismarcks 1890, für die sich die Bezeichnung »wilhelminische Zeit« eingebürgert hat. Maximilian Harden gründete seine Zeitschrift 1892 als Gegenstimme zu den liberalen deutschen Zeitungen. Harden wollte eine von den liberalen Geldinteressen freie Presse in der konstitutionellen Monarchie des deutschen Reiches. Nach der Bismarck-Verfassung berief der Monarch den Reichskanzler und die Minister als Staatsbeamte. Der Regierungschef war nicht von einer Mehrheit von parteiischen Stimmen abhängig, wie in einer Demokratie. Harden hielt die Aussichten, dass ein bedeutender Mann an die Regierung kam, in der konstitutionellen Monarchie für größer als in der parlamentarischen Demokratie. Nur hätte der Monarch, Wilhelm II., seine Aufgabe darin sehen müssen, der Politik eines starken und klugen Staatsmanns Hoheit und Würde zu verleihen. Da Wilhelm II. jedoch immer wieder versuchte, sich selbst als regierenden Monarchen darzustellen, geriet Harden in Opposition gegen den Kaiser. Harden hielt Abstand von der monarchischen Autorität und zugleich von der liberalen Presse.
Maximilian Hardens ursprünglicher Name war Felix Ernst Witkowski. Sein Vater hatte seine jüdische Familie aus dem damals preußischen Posen nach Berlin gebracht. Dort besuchte Felix Ernst das Französische Gymnasium, wo er sich als exzellenter Schüler erwies. Als er zwölf Jahre alt war, nahm der Vater ihn von der Schule, er sollte eine Kaufmannslehre antreten. Der Sohn widersetzte sich und wurde Schauspieler. Er reiste mit einer wandernden Truppe umher und nahm den Bühnennamen Maximilian Harden an, den er sich später als seinen eigentlichen Namen legalisieren ließ. Als er siebzehn Jahre alt war, ließ er sich evangelisch taufen. Harden hatte das Bedürfnis, über allem zu stehen, als Christ auf die Juden herabzusehen, als früherer Jude die christliche Tradition wie ein auswärtiger Beobachter zu untersuchen. Wie die Brüder Mann ersetzte er seine abgebrochene Gymnasialbildung durch eine autodidaktische, die er, wie die Mann-Brüder, auf eine ungewöhnliche Höhe brachte. Harden betrachtete seine Rolle als Herausgeber einer überparteilichen Wochenzeitung als eine öffentliche Aufgabe, wie die des überparteilichen Reichskanzlers, der die Interessen des ganzen Staates und Volkes wahrnehmen sollte. Eine solche höhere Politik wurde damals als »unpolitisch« verstanden. Die Zukunft erreichte schnell eine hohe Auflage.
Hardens Konservativismus verrät sich in Interesse an Ehrenhändeln. Harden wollte an einem Sonderstatus für die Oberklasse festhalten, sei es, weil er ein Leser Nietzsches war und dessen Gefühl für Vornehmheit teilte, sei es, weil er keinen Zweifel an seiner eigenen Stellung in der Gesellschaft aufkommen lassen wollte. Jedoch verweigerte er eine Duell-Forderung. Harden hatte Sympathien für die Arbeiterbewegung. Den Titel Die Zukunft hatte der Sozialdemokrat Franz Mehring vorgeschlagen, als er noch mit Harden befreundet war. Wie Mehring seine Partei, wollte Harden seine Zeitschrift auf eine sozial verbesserte Zukunft ausrichten. Die marxistische Theorie lehnte Harden ab. Mehring habe gehofft, schrieb Harden viel später, er, Harden, werde sich von Bismarck und Nietzsche abwenden (Z XXIII, 381, 1898). Das geschah nicht.
Vor der Gründung der Zukunft schrieb Harden Theaterberichte und dann politische Feuilletons, die er in der Zeitschrift Die Gegenwart veröffentlichte, für die auch Heinrich Mann schrieb. Diese Aufsätze sammelte Harden in zwei Bänden, die er Apostata nannte. Heinrich Mann schaffte sie sich an.[175] Als die Brüder 1894 in München in engem Kontakt miteinander lebten, hat Thomas Mann die beiden Bände gelesen und Einzelheiten in einem Notizbuch niedergeschrieben. (Nb.I, 19–27). Das Pseudonym Apostata verweist auf den Beinamen, den die Christen dem römischen Kaiser Julian gaben, nachdem er den christlichen Glauben abgelegt und ihn durch eine neuplatonische Philosophie ersetzt hatte. Damit wurde der Kaiser für die Christen zum Renegaten, zum Außenseiter. Das wollte Maximilian Harden sein und so verstand sich auch Thomas Mann.
1905 lobte Thomas Mann Harden in der Antwort auf eine Rundfrage über den Zustand der literarischen Kritik. Er, Thomas Mann, habe »eine Schwäche« für Kritik, »und diese Liebe möcht’ ich nie besiegen. Mein Interesse für den Publizisten Maximilian Harden sieht der Bewunderung zum Verwechseln ähnlich« (14.I, 86).[176] In Bilse und ich nennt Thomas Mann 1906 Harden einen »durchaus musisch organisierte[n] Kritiker des öffentlichen Lebens«. Der »wahre Liebhaber des Wortes« werde sich »eher eine Welt verfeinden, als eine Nuance opfern«. Harden hätte sich Hass und widrige Prozesse ersparen können, »wenn er je vermocht hätte, die Schlagkraft seines Wortes zu schwächen, auf Kosten der künstlerischen Genauigkeit klug zu sein« (14.I, 109).
Harden drückte seine Abneigung gegen die parteiische Politik der parlamentarischen Demokratie in einem frühen Essay aus, der den Titel M. d. R. [Mitglied des Reichstags] trug. Abgeordnete waren für Harden Dilettanten und Parasiten. Wie Nietzsche verachtete er die Herrschaft der Mehrheit. Eine Nation setze sich nicht aus Wählern oder »Parteitramplern« zusammen, »in ihr lebe vielmehr auch noch »eine kleine Menschheit«, der an den Parteien garnichts,[177] »sehr viel aber an dem Fortschreiten der vaterländischen Kultur gelegen ist« (Z I, 480, 1892). Parteipolitik sei allein deswegen verkehrt, weil eine Partei nur die nächsten Wahlen im Kopf habe (Z I, 2). »Die Ehrlichkeit muss man sich dauernd abgewöhnen,« schreibt Harden voller Abscheu, »wenn man die Mitgliedschaft irgend einer Partei erwerben und dauernd bewahren will« (Z I, 291). Nietzsche folgend glaubte Harden, richtige Politik könne nur von großen Männern, also unabhängigen Staatsmännern mit hoher Intelligenz und einem verantwortlichen Sinn für das Ganze konzipiert werden.
Als so einen Staatsmann sah er Otto von Bismarck, der Deutschland den Weg in die Zukunft gegen Widerstände gewiesen hatte, während die Liberalen Bismarck kleinredeten. Die Unterdrückung der Sozialdemokratie kritisierte Harden, Bismarcks Größe zeige sich in der Außenpolitik. Der entlassene Reichskanzler lud Harden zum Besuch auf sein Gut Varzin ein und merkte schnell, dass Harden seine Kritik an Wilhelm II. teilte. Es kam zu einer Art Freundschaft Hardens mit Bismarck.
Harden drückte in zwei Artikeln in der Zukunft von 1892 seine Hoffnung aus, Kaiser Wilhelm werde von selbst seinen angemessenen Platz finden. Wegen Majestätsbeleidigung angeklagt, wurde er von einem Berliner Gericht freigesprochen. Das blieb ein vereinzelter mutiger Akt der preußischen Richter in Berlin. 1898 zum zehnjährigen Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms schrieb Harden einen Artikel Pudel-Majestät (Z XXIII, 495–499), der die Handlung eines satirischen französischen Märchens so wiedergab, dass die Leser Wilhelm in dem Märchen-Prinzen erkennen mussten. Am 12. November 1898 heißt Hardens Leitartikel Auf der Anklagebank (Z XXV, 273–285). Harden stand wieder wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht. Er wusste, dass er sich jetzt nicht mehr auf die Unabhängigkeit der Richter verlassen konnte, die in der preußischen Verfassung festgeschrieben war: »Keiner der fünf Herren wird sich gesagt haben: ›Wir müssen den Harden verurteilen‹; in jedem von ihnen aber, dessen bin ich gewiss, lebte das latente Gefühl: ›Wenn wir den Harden noch einmal freisprechen, wird es uns furchtbar verübelt […]‹« (Z XXV, 282). Harden wurde zu sechseinhalb Monaten Festungshaft verurteilt.
Harden unterstützte lange eine für Bauern und Gutsherren günstige Wirtschaftspolitik. Den Kapitalismus, den er hasste, assoziierte er mit der britischen Industrie, der britischen Politik und mit dem jüdischen Bankier- und Börsen-Reichtum in Berlin und in Deutschland. Sein Freund Walther Rathenau erklärte ihm schon 1897, wie idyllisch und unpraktisch Hardens Weltbild war.[178] Schließlich sah er ein, dass die deutsche Großmachtpolitik, die er nach 1900 unterstützte, ja propagierte, Industrie brauchte.
Im Gegensatz zu Hardens konservativer Wirtschaftspolitik stand seine ausgesprochen progressive Auswahl von Beiträgen für Die Zukunft. Viele Artikel machten dem Namen der Zeitschrift Ehre: Sie informierten über die großen Veränderungen, die in allen Wissensgebieten stattfanden: in der Psychologie, der Medizin, in der Wirtschaft, der Rechtspflege, in der Literatur. Technische Entwicklungen, von elektrischen Eisenbahnen bis zum Unterseeboot stellte Die Zukunft vor. Den Luftschiffbau Zeppelin betrachtete Harden mit Skepsis, gab den Fliegern mit Tragflächen größere Chancen. 1894 erschien ein Artikel über Spektralanalysen von Sternexplosionen (Novae), die die traditionelle Vorstellung von einem ewigen Weltall erschütterten (Z VII, 264–268; 1894). Die Probleme, die die Evolutionstheorien nach Darwin und Lamarck aufwarf, nahmen viel Raum in der Zukunft ein.
Für heutige Leser muss Hardens Politik verwirrend sein: Sie richtete sich gegen das politische Gewicht der liberalen Zeitungen, die eine deutsche Demokratie verlangten und Wilhelm II. kritisierten. Harden trat für eine moderne Gesellschaft und für moderne Technik ein, widersetzte sich aber der parlamentarischen Regierungsform mit ihrem Parteienstreit. Seinen Anti-Liberalismus verstand Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen als Konservativismus. Es war ein Konservativismus, der nicht reaktionär sein wollte. Eine gutwillige autoritäre Regierungsform blieb im Grunde Thomas Manns Ideal, nach 1921 auch in der Form sozialistischer Politik.
Nach 1905 griff Harden die Berater des Kaisers an, die zum Nachgeben in der Marokko-Krise von 1905 geraten hatten. Harden begann, deutsche Machtpolitik zu vertreten. Es gab Prozesse und der Fall verwickelte sich. Harden konnte zuletzt nur gewinnen, wenn er einem Gegner homosexuelle Akte nachwies. Das tat er und verlor viel von seiner früheren Autorität, auch bei Thomas Mann. Dieser brach mit Harden, als dieser sich vor Ende des Ersten Weltkrieges für eine Vermittlung durch den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson aussprach.
Es gab lockere persönliche Kontakte zwischen Harden und Thomas Mann, einige gelegentliche Briefe.[179] Thomas Manns Skizze Die Hungernden wurde 1903 in Die Zukunft gedruckt (Z XLII, 154–158). Hedwig Pringsheim, die Mutter Katia Manns, führte einen regelmäßigen Briefwechsel mit Harden.
Harden wurde 1922 von nationalistischen Mitgliedern eines Freikorps zusammengeschlagen und tot liegen gelassen. Er überlebte und starb 1927 in der Schweiz.