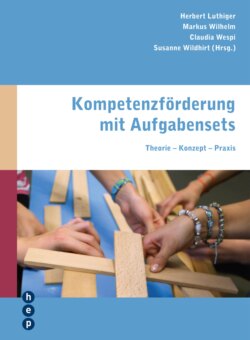Читать книгу Kompetenzförderung mit Aufgabensets - Herbert Luthiger - Страница 5
ОглавлениеEinleitung
Einleitung
Was sucht LUKAS in einem Fachbuch für Pädagogik und Didaktik?
Wie jedes Buch hat auch dieses seine eigene Geschichte. Sie steht in engem Zusammenhang mit der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Fachdidaktik und Allgemeiner Didaktik im Entwicklungsschwerpunkt »Kompetenzorientiert unterrichten« der Pädagogischen Hochschule Luzern. Bei der Auseinandersetzung mit dem Problem, wie angehende Lehrerinnen und Lehrer in der Arbeit mit modernen, kompetenzorientierten Lehrplänen möglichst gut unterstützt werden können, hat uns folgende Frage auf Trab gehalten: Wie sind Aufgaben zu gestalten und im Unterricht einzubinden, damit sie einen auf Kompetenzen ausgerichteten Lernprozess fördern?
Auf diese Weise ist das LUKAS-Modell entstanden. LUKAS steht in diesem Buch nicht für einen männlichen Vornamen, sondern ist ein Akronym für einen Ansatz, der die Kompetenzförderung über die epistemologischen und funktionalen Qualitäten von Aufgaben in den Blick nimmt: LUzerner Modell zur Entwicklung Kompetenzfördernder AufgabenSets.
Das LUKAS-Modell legt den Fokus bewusst auf Aufgaben. Aufgaben fungieren zum einen als Instrument der didaktischen Unterrichtssteuerung, zum andern sind sie – richtig eingesetzt – sowohl Träger von Lerninhalten als auch Förderer von Denk- und Verstehensprozessen.
(Angehende) Lehrerinnen und Lehrer arbeiten bereits heute mit dem LUKAS-Modell. Stellvertretend sei hier folgende Erkenntnis eines Studenten aufgeführt:
Rückblickend lässt sich festhalten, dass das Modell (LUKAS) […] hervorragend als Analyse- und Planungsinstrument eingesetzt werden kann. […] Eine Konfrontationsaufgabe lässt sich z. B. immer gewinnbringend einsetzen, um Vorwissen der Schüler abzurufen. Ebenso ist eine Hypothesenbildung (Konfrontationsaufgabe) sowie -überprüfung (Transferaufgabe) wertvoll, um Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen. Als persönliches Learning werte ich eine formative Lernkontrolle als zwingend und werde diese auch in allen anderen zu unterrichtenden Fächern in Zukunft einsetzen. (Rückmeldung eines Studenten der Pädagogischen Hochschule Luzern, 3.4.2017)
Solche und frühere – auch kritische – Einschätzungen und Rückmeldungen, die wir im Rahmen des Entwicklungsprojekts erhielten, haben uns dazu bewogen, das Modell in der Praxis zu erproben und das vorliegende Buch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Fachdidaktik zu verwirklichen. Es ist uns ein Anliegen, den interdisziplinären Diskurs in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung anzuregen und zu fördern, denn »jede einzelne Unterrichtsstunde und jede Unterrichtseinheit muss sich daran messen lassen, inwieweit sie zur Weiterentwicklung inhaltsbezogener und allgemeiner Schülerkompetenzen beiträgt. Die wichtigste Frage ist nicht ›Was haben wir durchgenommen?‹, sondern ›Welche Vorstellungen, Fähigkeiten und Einstellungen sind entwickelt worden?‹«[3] Dazu ist es notwendig, dass Lehrkräfte über eine möglichst klare Vorstellung verfügen, wie einzelne Kompetenzstufen aufeinander abgestimmt sind. Hierfür braucht es gute Aufgaben – gute Aufgaben in dem Sinne, dass sie den Kompetenzerwerb strukturieren und nachhaltig fördern, weil sie auf ihren Einsatzort innerhalb des Lernprozesses und auf die damit verbundenen didaktischen Funktionsziele abgestimmt sind.
Aufbau und Absicht
Der erste Teil des Buches ist der Bedeutung von Aufgaben als Schlüssel zu einer kompetenzfördernden Lehr-Lern-Kultur gewidmet. Darin wird das LUKAS-Modell mit seinem Lernprozessmodell und dem Kategoriensystem mit den lernrelevanten Merkmalsbereichen hergeleitet und vorgestellt. Es bildet die Grundlage für die zwölf Beiträge der Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker, die im zweiten Teil des Bandes einen Einblick in kompetenzfördernde Aufgabensets geben. Diese sind teilweise in Zusammenarbeit mit Lehrkräften entstanden oder wurden von ihnen im Unterricht erprobt. In jedem Beitrag wird diskutiert, wie das Modell für die Kompetenzentwicklung zu nutzen ist und wie es sich mit den jeweiligen fachdidaktischen Anliegen vereinbaren lässt.
Im dritten Teil des Buches werden domänenspezifische und übergeordnete Gemeinsamkeiten und fachspezifische Unterschiede analysiert. Der Umgang mit dem Modell im Allgemeinen sowie die Ausgestaltung des Lernprozessmodells und der Einsatz des Kategoriensystems im Speziellen werden über die Fächergrenzen hinweg unter die Lupe genommen.
Das Buch richtet sich an Studierende in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, an Lehrkräfte und Schulleitende sowie an Dozierende der Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik – in der Schweiz und in anderen deutschsprachigen Ländern.[4]
Wir möchten an dieser Stelle auch offenlegen, was wir mit diesem Buch nicht leisten können: Die darin enthaltenen Unterrichtsbeispiele werden lediglich »angespielt« und sind somit nicht eins zu eins im eigenen Unterricht einsetzbar – das Buch will keine Aufgabensammlung sein, sondern soll zum Nachdenken und Diskutieren anregen.
Dank
Die vorliegende Publikation wurde nur möglich aufgrund der engagierten Zusammenarbeit mit den beteiligten Autorinnen und Autoren – unseren Kolleginnen und Kollegen der Pädagogischen Hochschule Luzern und ihren Netzwerken. Für ihre engagierte Mitarbeit am Projekt, für die termingerecht eingereichten Beiträge und für die anregenden und weiterführenden Gespräche danken wir allen herzlich. Bei der Hochschulleitung bedanken wir uns für die finanzielle Unterstützung. Den Mitarbeitenden des hep verlags gilt unser herzlicher Dank für die angenehme Zusammenarbeit.
Nun hoffen wir, dass unsere Publikation Anlass gibt für konstruktive Gespräche und dass es zum Nachdenken über das Lernen von Schülerinnen und Schülern anregt. Vor allen Dingen aber hoffen wir, dass das LUKAS-Modell eine Hilfe darstellen möge bei der kompetenzorientierten Unterrichtsgestaltung.
Luzern, im Januar 2018
Herbert Luthiger, Markus Wilhelm,
Claudia Wespi, Susanne Wildhirt