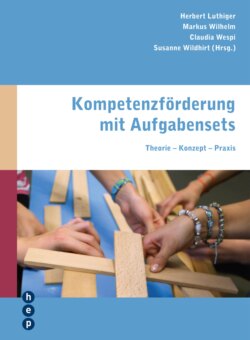Читать книгу Kompetenzförderung mit Aufgabensets - Herbert Luthiger - Страница 8
1.1 Zum Aufgabenverständnis in diesem Buch
ОглавлениеEine einheitliche Auffassung darüber, was unter dem Konstrukt »Aufgabe« im engeren Sinne zu verstehen sei, ist im aktuellen didaktischen Diskurs nicht feststellbar.
Einerseits wird der Auflösungsgrad dessen, was als Aufgabe bezeichnet wird, unterschiedlich definiert. Im Verständnis der Kognitions- und Instruktionspsychologie beispielsweise sind einzelne Aufforderungen und Fragen der Lehrkraft bereits Aufgaben (vgl. z. B. Astleitner, 2006, S. 18; Renkl, 1991, S. 89; Schabram, 2007, S. 6). Im Kontrast dazu orientieren sich andere Autorinnen und Autoren an einem Aufgabenbegriff, der Fragen und Aufforderungen im Unterricht explizit nicht als Aufgaben bezeichnet (vgl. z. B. Bohl et al., 2013, S. 27; Kleinknecht, 2010, S. 12).
Ferner wird in der Literatur neben Aspekten wie dem Auflösungsgrad auch die inhaltliche Qualität von Aufgaben unterschiedlich bestimmt. Beispielsweise wird in der Psychologie klassischerweise zwischen Problem und Aufgabe unterschieden. Seel (1981) verdeutlicht diese Differenz wie folgt: »Wird der Lernende in einer spezifischen Situation mit einer Lernaufgabe befasst, die er mit den ihm augenblicklich verfügbaren Informationen oder Lösungsmethoden nicht direkt bewältigen kann, wird die Lernaufgabe als Problem beurteilt« (ebd., S. 104, kursiv im Original). Konstitutiv für ein Problem sind aus Sicht der Lernerinnen und Lerner demzufolge die noch unbekannten Mittel zum Erreichen des Ziels oder die Notwendigkeit, bekannte Mittel auf neue Weise oder aber die unklaren Vorstellungen über das angestrebte Ziel neu kombinieren zu müssen. Diese Definition impliziert, dass ein Problem höhere Anforderungen an eine Person stellt als eine Aufgabe, weil vorhandenes Wissen und bekannte Lösungsverfahren zur Problemlösung nicht ausreichen, wohingegen für die Bewältigung von Aufgaben lediglich das Abrufen deklarativen und prozeduralen Wissens erforderlich ist. Kritisch eingewendet wird jedoch, dass sich eine solche Trennung an formalen Gedächtnis- und Problemlösungsmodellen orientiert, nicht aber an realen Lernprozessen (vgl. z. B. Leuders, 2014, S. 38; Schabram, 2007, S. 7), weil die Einstufung einer Aufgabe als Problem vom je individuellen Kenntnisstand der Schülerin oder des Schülers abhängt. Für die Unterrichtspraxis ist somit eine Unterscheidung zwischen Aufgabe und Problem wenig zielführend, da der Einsatz von Problemen als spezifische Art von Aufgaben an das Verhältnis zwischen den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und dem Anforderungsniveau der Aufgaben geknüpft ist.
Als übergreifendes Verständnis für eine Aufgabe lässt sich folgender gemeinsamer Kern bestimmen, der auf alle Fächer übertragbar ist:
Eine Aufgabe umreißt eine Anforderungssituation, die Lernende zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt veranlasst. Sie ist Teil einer Angebot-Nutzungs-Struktur, die es notwendig macht, zwischen dem Potenzial der Aufgabe (Angebotsseite) und der tatsächlichen Aufgabenbearbeitung (Nutzungsseite) zu unterscheiden. Aufgaben folgen in diesem Sinne einem (fach-)didaktischen Aufgabenverständnis, das offenlässt, in welchem Maße Aufgaben von außen an die Lernenden herangetragen oder durch sie selbst entwickelt und formuliert werden. Dieses Verständnis lässt auch offen, ob Aufgaben schriftlich oder mündlich erteilt werden. Fragen und Anweisungen im Rahmen des Klassenunterrichts gelten in den folgenden Ausführungen nicht als Aufgaben. Zudem wird auf eine Unterscheidung zwischen Problem und Aufgabe verzichtet, sodass in diesem Verständnis sowohl einfache Übungsaufgaben als auch komplexe Problemaufgaben eingeschlossen sind.