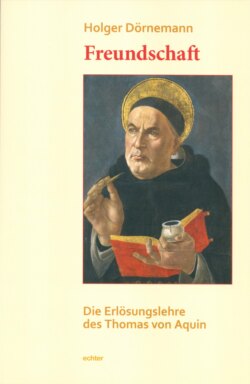Читать книгу Freundschaft - Holger Dörnemann - Страница 18
c) Theologische Tugenden und ‘eingegossene’ Tugenden als ‘übernatürlichgnadenhafte’ Vervollkommnungen der Seelenvermögen und als ‘inchoative’ Teilhabe an der ‘übernatürlichen’ Glückseligkeit
ОглавлениеDamit der Mensch trotz der Defizienz seiner natürlichen Kräfte die übernatürliche Glückseligkeit erlangen kann, müssen ihm übernatürliche Handlungsprinzipien203 gewissermaßen ‘von außen’204 hinzugefügt werden, durch die er der Glückseligkeit proportionierte Akte zu vollbringen imstande ist. Thomas nennt diese Handlungsprinzipien nach scholastischer Sprachregelung ‘Theologische Tugenden’, da sie Gott zum Objekt haben bzw. den Menschen auf ihn ausrichten, und versteht sie als ‘eingegossene’ »habitus« (»habitus infusi«205) bzw. als ‘eingegossene’ Tugenden (»virtutes infusae«206). Sie vollenden den Menschen in den nur den Menschen auszeichnenden rationalen Seelenvermögen, Vernunft und Wille. In diesen Seelenvermögen ist der Mensch zwar schon naturhaft auf Gott ausgerichtet, insofern er Grund und Ziel aller spezifisch menschlichen Tätigkeitsvermögen ist, jedoch nicht zureichend, insofern Gott für die Menschen die Glückseligkeit ist.207 So erfaßt die Vernunft in der Theologischen Tugend des ‘Glaubens’ (»fides«) Sachverhalte (»credibilia«), welche menschliche Fassungskraft ‘an sich’ übersteigen.208 Wie die Vernunft wird auch der menschliche Wille seinerseits in der Theologischen Tugend der ‘Hoffnung’ (»spes«) auf die Glückseligkeit als auf ein mit göttlicher Hilfe prinzipiell erreichbares Ziel ausgerichtet. Unbeschadet der Zukünftigkeit der Glückseligkeit, die durch die Hoffnung angezeigt wird, ist der Wille in der Theologischen Tugend der ‘Liebe’ (»caritas«) mit eben diesem Ziel schon verbunden.209
Obwohl Glaube, Hoffnung und Liebe als vollkommene Tugenden nur zusammen existieren und als vollendende »habitus« nur gemeinsam und zugleich ‘eingegossen’ werden, kann man ihre Akte nach einem ‘Früher’ oder ‘Später’ unterscheiden.210 Denn wie nur etwas geliebt werden kann, was zuvor vom Verstand wahrgenommen wurde, so können sich auch die Theologischen Tugenden der Hoffnung und der Liebe nur auf dasjenige beziehen, was ihnen zuvor im Glauben vorgestellt wurde.211 Die sichere Hoffnung auf die Erlangung eines ‘Gutes’, ermöglicht bzw. entfacht ihrerseits die Liebe zu demjenigen, der das ersehnte ‘Gut’ erreichbar macht; insofern geht die Hoffnung der Liebe voraus.212 Vergleicht man jedoch die gerade skizzierte ‘Ordnung des Entstehens’ (»ordo generationis« bzw. »ordo consecutionis«) der einzelnen ‘übernatürlichen’ Tugendakte mit der ‘Ordnung der Vollkommenheit’ (»ordo perfectionis«), ergibt sich eine umgekehrte Reihenfolge. Denn weil der menschliche Wille in der »caritas« mit Gott verbunden ist und somit auch die Theologischen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung ‘formt’, geht die Tugend der Gottesliebe den beiden anderen Theologischen Tugenden voran, ist die »caritas« - in metaphorischer Sprache - ‘Mutter (»mater«) und ‘Wurzel’ (»radix«) aller anderen Tugenden.213 Diese Sonderstellung der ‘übernatürlichen Gottesliebe’ in der Konzeption der Tugendlehre zeigt sich besonders auch darin, daß mit ihr nicht nur der Glaube und die Hoffnung, sondern auch alle anderen moralischen Tugenden eingegossen werden.214 Bei diesen ‘eingegossenen moralischen Tugenden’ (»virtutes morales infusae«) handelt es sich allerdings um mehr als nur um ein ‘übernatürliches’ Äquivalent zu den ‘naturhaft-erworbenen’, von denen sie wegen der Formung durch die »caritas« bzw. durch die Ausrichtung auf Gott verschieden sind. Denn wie z.B. eine Abstinenz beim Essen aus Gesundheitsgründen verschieden ist von einem religiös motivierten und in der Gottesbeziehung gründenden Fasten, so unterscheiden sich ebenso alle anderen ‘natürlichen’ moralischen Tugenden von den mit der ‘übernatürlichen’ Gottesliebe ‘eingegossenen’ Tugenden.215 Alle diese »virtutes morales infusae« setzen, insofern und weil sie auf das ‘letzte Ziel’ ausrichten, die Gottesliebe voraus.216 Wie die Klugheit unter den moralischen Tugenden eine Verbindung herstellt, so verbindet die Gottesliebe in einem noch höheren Maße alle Tugenden, indem sie als eine den Willen mit dem Ziel menschlichen Lebens verbindende Tugend alle anderen moralischen Tugenden ihrer Bewegung einschreibt, durchdringt und gewissermaßen innerlich ‘formt’. Von daher kann Thomas die ‘übernatürliche’ Gottesliebe auch als ‘Form aller anderen Tugenden’ (»forma virtutum«)217 bezeichnen. Weil die Vollendung des Menschen nach Thomas nicht minder geordnet und vollkommen sein kann als das natürliche Leben, darum sind dem Menschen mit der Gottesliebe alle anderen moralischen Tugenden zu eigen218, und so hängen alle Tugenden von der »caritas« ab219, wie schon im natürlichen Bereich der Affekte die (‘natürliche’) Liebe ‘Wurzel’ und ‘Grund’ aller anderen Affekte ist.220 Wenn die »caritas« verloren geht, verschwinden mit ihr einerseits alle von ihr abhängigen moralischen Tugenden221, aber auch die ‘eingegossenen’ Tugenden des Glaubens und der Hoffnung büßen ihre Vollkommenheit ein und sind wegen der unzureichenden Ausrichtung des menschlichen Willens auf Gott dann ebenfalls keine Tugenden im strengen Sinne mehr.222 So ist die »caritas« zugleich auch ‘Wurzel’ der Theologischen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung, die nur durch die Gottesliebe vollkommene Tugenden sein können, die zugleich aber auch, wie im Blick auf die ‘Ordnung der Entfaltung der Tugendakte’ (»ordo consecutionis«) gezeigt, der Gottesliebe vorausgehen und von ihr vorausgesetzt werden.223
Indem Thomas die ‘übernatürliche’ Gottesliebe im Anschluß sowohl an aristotelische als auch an biblische Argumentationsmuster als Freundschaft und Gemeinschaft des Menschen mit Gott versteht, kann er analog zu einer zwischenmenschlichen Freundschaft, die in sich Mißtrauen und Hoffnungslosigkeit gewissermaßen ‘per definitionem’ ausschließt, auch von der Gemeinschaft des Menschen mit Gott sagen, daß sie Glaube und Hoffnung notwendig voraussetzt: nämlich den Glauben, der eben diese Gemeinschaft des Menschen mit Gott glaubt, und die Hoffnung, in der die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft auch (bzw. gerade) in Zukunft für möglich gehalten wird.224 Indem Glaube, Hoffnung und Liebe sich wechselseitig implizieren und gemeinsam die Freundschaft des Menschen mit Gott ermöglichen, sind sie zugleich die Handlungsprinzipien, durch die der Mensch auf die Glückseligkeit ausgerichtet ist und sie erlangen kann. Wie die ‘naturhaft-erworbenen’ Tugenden zur Erlangung eines der Natur des Menschen entsprechenden Zieles befähigen, so befähigen die Theologischen Tugenden - und insgesamt alle eingegossenen Tugenden - zur Erlangung eines ‘höheren’ und ohne sie unerreichbaren Zieles.225 Insofern sind auch die Theologischen Tugenden bzw. alle ‘eingegossenen’ Tugenden noch nicht selbst die Glückseligkeit (die - wie gesagt - in der ‘Schau Gottes’ (»gloria«) besteht226), doch machen sie der Gnade Gottes teilhaftig (»particeps divinae gratiae«)227 und lassen die Glückseligkeit bereits anfanghaft erleben. Da die Gnade gewissermaßen der Anfang der Glückseligkeit228 in diesem Leben ist und durch die ‘eingegossenen’ Tugenden im Menschen ankommt, ist in den ‘eingegossenen Tugenden’ die ‘auf Erden’ höchstmögliche Glückseligkeit verwirklicht: zuallererst in der übernatürlichen Gottesliebe, die durch die Liebeseinheit mit Gott zugleich eine Verbindung mit der Glückseligkeit229 ist; sodann in den beiden anderen Theologischen Tugenden, Glaube und Hoffnung, die den Menschen ebenfalls mit seinen Vermögen auf Gott und die Glückseligkeit - verglichen mit der »caritas« allerdings auf unvollkommenere Weise230 - ausrichten; und letztlich auch in den übrigen mit der Gottesliebe ‘eingegossenen moralischen Tugenden’, die menschliches Leben gewissermaßen in allen Vollzügen gelingen lassen und so auf ihre Weise auf die Glückseligkeit hinordnen. Worauf schon bei der Untersuchung der ‘natürlichen’ Tugenden hingewiesen wurde, das bestätigt sich auch bei den ‘eingegossenen’ Tugenden: Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit implizieren sich wechselseitig. Im Unterschied zu den ‘natürlichen’ Tugenden haben die ‘eingegossenen’ Tugenden nicht nur ein unvergleichlich ‘höheres’ und - im wahrsten Sinn des Wortes - unfaßbares Ziel, sondern vor allem ein zukünftiges Ziel, auf das die ‘eingegossenen’ Tugenden ihrerseits aber schon so etwas wie einen Vorgeschmack zu geben vermögen. Doch unbeschadet ihrer Vorläufigkeit231 sind die ‘eingegossenen’ Tugenden die denkbar höchsten Lebensvollzüge ‘auf Erden’, die gewissermaßen das Ziel (der Glückseligkeit) schon in sich tragen. Weil sie von Gott ermöglichte Handlungsprinzipien sind, machen die ‘eingegossenen’ Tugenden noch weit mehr als die ‘naturhaft-erworbenen’ Tugenden den Menschen nicht nur in diesem oder jenem Vermögen, sondern gewissermaßen rundum ‘gut’. Sie sind deshalb auch für Thomas die eigentlichen Tugenden (»virtutes simpliciter«), von denen her sich der Vollsinn seines Tugendverständnisses erschließt und neben denen die rein natürlichen Tugenden nurmehr als uneigentliche Tugenden (»virtutes secundum quid«) erscheinen.232
Daß Thomas sein Tugendverständnis gewissermaßen von Anfang an von dieser Höchstform der Tugend entwirft, wird schon in der allerersten Quästion des Tugendtraktates angedeutet, denn nur die ‘eingegossenen’ Tugenden erfüllen alle Bedingungen der von Thomas favorisierten (und auf Augustinus233 zurückgehenden) Tugenddefinition: ‘Eine Tugend ist eine gute ‘Qualität’ des menschlichen Geistes, durch die man ‘recht’ lebt und das ‘Schlechte’ meidet, und die Gott in uns ohne uns wirkt.234 Nur die Theologischen Tugenden mitsamt den eingegossenen moralischen Tugenden sind Tugenden im strengen Sinn, da nur sie den Menschen auf das ‘wahre’ und ‘letzte’ Ziel (»finis ultimus«) hinreichend ausrichten, dessen der Mensch - wie oben betont - in der Gnade ‘fähig’ (»capax«) ist. Und so sind mit den vollkommenen Tugenden diejenigen Wirkungen der Gnade angesprochen, durch die der Mensch (wieder) zum vollkommenen ‘Abbild Gottes’ auf Erden (»imago recreationis«) wird, indem er akthaft zu Gott unterwegs ist; denn die Tugenden des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung vervollkommnen die menschliche Vernunft und den menschlichen Willen in der Weise, daß der Mensch tatsächlich, also nicht nur dem Vermögen nach, sondern akthaft zu Gott als dem Ziel menschlichen Lebens gekehrt ist. Es zeigt sich, daß sich die Vollendung des Menschen in thomanischer Perspektive gemäß und als Vollendung der menschlichen Binnenstruktur vollzieht.
Sind mit den ‘eingegossenen’ Tugenden diejenigen Handlungsprinzipien genannt, durch die der Mensch ‘schon jetzt’ auf die Glückseligkeit ausgerichtet ist, drängt sich jedoch die Frage auf, wie der Mensch eben diese ‘Wirkungen der Gnade Gottes’ erlangen kann: Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Mensch der Gnade Gottes und ihrer Wirkungen in den Seelenvermögen teilhaftig wird? Diese Frage im Hinblick auf die thomanische Theologie der STh voranzutreiben und ein Stück weit einer Beantwortung zuzuführen, dazu will diese Arbeit ihren Beitrag leisten, wobei die weitere Untersuchung ihren Ausgang nehmen soll in dem Traktat der STh, von dem an erster Stelle Hinweise auf die Voraussetzungen für die Erlangung der Gnade erwartet werden können: im Gnaden- und Rechtfertigungstraktat (STh I-II 106-114).
1 Vgl. L.-M. de Blignières, La dignite de I’homme image de Dieu, 199-220; B. Bujo, Moralautonomie und Normenfindung, 173-192; F. Dander, Gottes Bild und Gleichnis, 206-259; J.F. Hartel, Femina ut imago Dei; D.M. Ferrara, Imago Dei; L.-B. Geiger, L’homme, image de Dieu, 511-532; A. Hofmann, Die Gottebenbildlichkeit, 345-358; ders., Erschaffung und Urzustand des Menschen; ders., Zur Lehre von der Gottebenbildlichkeit, 292-327; R. Moretti, Con «l’uomo immagine di Dio», 187-198; T. Ortiz Ibarz, Imagen de Dios en la Creacion, 197-207; J. Pelikan, Imago Dei, 27-56; c.-J. Pinto de Oliviera, Image de Dieu, 401-436; A. Rohner, Thomas von Aquin, 260-291; L. Scheffczyk, Der Mensch als Bild Gottes; E. Schockenhoff, Bonum hominis, 85-95; Ch.-S. Shin, ‘Imago Dei’ und ‘Natura Hominis’, 49-115; R. Simon, Das Filioque bei Thomas von Aquin, 64-98; M. Szell, Facciamo l’uomo a nostra immagine, 221-232.
2 Vgl. A. Hoffmann, Erschaffung und Urzustand des Menschen, 270.
3 Vgl. ebd.
4 »Quia, sicut Damascenus dicit, homo factus ad imaginem Dei dicitur, secundum quod per imaginem significatur intellectuale et arbitrio liberum et per se potestativum; postquam praedictum est de exemplari, scilicet de Deo, et de his quae processerunt ex divina potestate secundum eius voluntatem; restat ut consideremus de eius imagine, idest de homine, secundum quod et ipse est suorum operum principium, quasi Iiberum arbitrium habens et suorum operum potestatem.« STh I-II Prol. Vgl. Johannes Damascenus, De Fide Orth., Lib. II, cap. 12 (PG 94, 920).
5 O.H. Pesch, Thomas von Aquin, 381f., weist mit mannigfachen Belegstellen auf die verbreitete intellektualistische oder rationalistische Deutung der thomanischen Gottebenbildlichkeitslehre hin und zeigfu daß sie in der Regel auf eine einseitige und isolierte Auswertung des Prologs der I-IIae der STh zurückzuführen ist.
6 In qu. 93 (a. 1-9) der STh liegt die Gottebenbildlichkeitslehre innerhalb des Gesamtwerks des Aquinaten in ihrer ausgeprägtesten Form vor. Vgl. III Sent q.2-5; De ver 10.
7 »Manifestum est autem quod in homine invenitur aliqua Dei similitudo, quae deducitur a Deo sicut ab exemplarl: non tamen est similitudo secundum aequahtatem, quia in infinitum excedit exemplar hoc tale exemplatum. Et ideo in homine dicitur esse imago Dei, non tamen perfecta, sed imperfecta. Et hoc significat Scriptura, cum dicit hominem factum ad imaginem Dei«. STh I 93,1.
8 »Primogenitus omnis creaturae est imago Dei perfecta, perfecte implens illud cuius imago est: et ideo dicitur Imago, et nunquam ad imaginem. Homo vero et propter similitudinem dicitur imago; et propter imperfectionem similitudinis, dicitur ail imaginem. Et quia similitudo perfecta Dei non potest esse nisi in identitate naturae, imago Dei est in Fllio suo primogenito sicut imago regis in filio sibi connaturali; in homme autem sicut in aliena natura, sicut imago regis in nummo argenteo«. STh 93,1 ad 2. Vgl. STh I 35,2 ad 3.