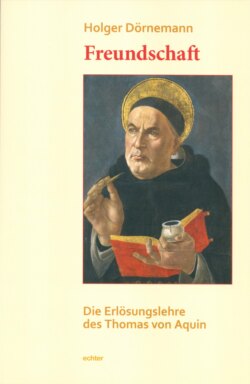Читать книгу Freundschaft - Holger Dörnemann - Страница 5
Geleitwort
ОглавлениеEs kommt nicht oft vor, dass eine Doktorarbeit nach einer Reihe von Jahren in einer Neuauflage erscheint. Es muss sich dann um eine Untersuchung handeln, die aufgrund ihres Themas und der Qualität seiner Bearbeitung über den engsten Kreis der Fachvertreter hinaus irgendwo bahnbrechend für neue Wege des Faches, hier: der systematischen Theologie geworden und so das geworden ist, was man ein „Standardwerk” zum Thema nennt.
Holger Dörnemanns Untersuchung zum Begriff der Freundschaft als zentralem – natürlich analogem – Begriff, das Geschehen der Erlösung durch Jesus Christus zu verstehen, gehört zweifellos zu solchen „Standardwerken”. Das leitende Anliegen des Buches ist, die traditionelle (schultheologische) Trennung zwischen Christologie und Soteriologie zu überwinden. Gemeint ist eine Gliederung der christologischen Thematik, die zuerst Person und Werk Christi – zumeist noch verkürzt auf Tod und Auferstehung – betrachtet, vor allem mit ausführlicher Erläuterung der altkirchlichen Bekenntnisse, und dieses dann in sich selbst als abgeschlossenes Ganzes würdigt, als die „objektive” Erlösung. Erst daran anschließend fragt man nach der „subjektiven” Erlösung, also der „Applikation” des „objektiven” Erlösungswerkes auf die Menschen, soweit sie sich ihr öffnen im Glauben an das „ein für allemal” geschehene Werk Christi. Das leitende Interesse dieser abgrenzenden Unterscheidung zwischen „Christologie” und „Soteriologie” ist gewiss legitim: Christi Heilswerk kann in seiner universalen Gültigkeit und Ausrichtung auf die ganze Menschheit herausgestellt werden – und wenn es auf der Ebene der „Applikation” faktisch nicht allen Menschen zugute kommt, liegt das an diesen und nicht an Christus. Zudem hat sich durch die Bekenntnisgeschichte so viel „Stoff” zur Frage nach der Person Christi angehäuft, dass es auch didaktisch geschickt erscheint, diese Thematik zunächst für sich zu behandeln. Und so meint man sich denn auch in der guten Tradition des Thomas von Aquin, der in seiner Summa Theologiae ganz offenbar aus diesen Gründen die Lehre von der Person Christi einschließlich Mariologie (STh III 1–45) trennt von der Lehre über sein Erlösungswerk (STh III 46–59). Doch seit einiger Zeit wird nicht nur von der Sache her, sondern auch in Bezug auf Thomas die Frage gestellt, ob dieses Nacheinander von Christologie und Soteriologie trotz der scheinbaren didaktischen Eindeutigkeit nicht ein Missverständnis ist. Ob also nicht auch bei Thomas die Christologie von vornherein soteriologisch gewendet ist, will sagen: ob das, was über die Person Jesu und sein „objektives” Heilswerk zu sagen ist, von vornherein nicht nur „subjektiv” ausgerichtet ist, sondern sozusagen in einer Interaktion mit dem empfangenden Subjekt geschieht. Das Heilswerk Christi ist kein Depot der Verdienste Christi, aus dem nun Gnadengaben an das gläubige Subjekt ausgeteilt werden, sondern ist durch sich selbst schon ein Geschehen des Austeilens.
In diese jüngere Tendenz der Thomasforschung ordnet Holger Dörnemann sich ein – und macht in eben diesem Zusammenhang das Thema der „Freundschaft” zwischen Gott und Mensch zum Thema: Gottes Sohn ist aus Liebe zu den Menschen selber Mensch geworden, hat den Tod erlitten und ist zu Gott auferweckt worden. Liebe aber zielt durch sich selbst auf Gegenliebe, also auf Gemeinschaft in Freundschaft. Das „objektive” Heilswerk Christi ist also ohne den Gedanken der Begründung von Freundschaft gar nicht zu denken, es sei denn man müsste dieses Heilswerk erst einmal als ohnmächtige Einladung denken, die warten muss, bis die Antwort der Gegenliebe kommt.
Wer unter diesem Aspekt Thomas befragt, muss natürlich seine „subjektive” Soteriologie untersuchen, also seine Gnadenlehre, die in der Lehre von den theologischen Tugenden kulminiert. So führt Dörnemann die Leserinnen und Leser zunächst durch die thomanische Sicht des Verhältnisses von Gottes Gnade und menschlicher Freiheit hindurch zur Lehre von der Gottesgemeinschaft in Glaube, Hoffnung und Liebe. Und hier geschieht die Überraschung: Wo die Thomasforschung „normalerweise” den Einsatz des Thomas bei der Interpretation der caritas als Freundschaft zwischen Gott und Mensch aufgrund der Mitteilung der Seligkeit Gottes selbst (STh II–II 23,1) rasch übergeht, um sich auf den Tugendcharakter der caritas und dessen Implikationen zu konzentrieren, bleibt Dörnemann hier stehen und interpretiert gerade die Tugend der caritas durch das Freundschaftsparadigma. Er greift dabei strukturierend den Hinweis des Thomas auf das Verständnis von Freundschaft bei Aristoteles in der Nikomachischen Ethik auf und verfolgt von da aus – immer streng bei Thomas – das Freundschaftsparadigma in der Deutung der Heilsgeschichte und ihrer drei Zeiten, in der Verbindung von Gnadenlehre, Tugendlehre und Christologie, in der Lehre vom Gesetz, und schließlich in der Lehre von den Sakramenten.
Aus gutem Grund verzichtet Dörnemann auf eine vorschnelle „Aktualisierung” der Sicht des Thomas – als ob man diesen nur zu zitieren bräuchte, um zu wissen, wie man heute Christologie treiben muss. Aber er verzichtet nicht in einem kurzen Schlussabschnitt auf einige „Leitsätze” für eine systematische Christologie, die sich an den erarbeiteten Perspektiven aus der Christologie des Thomas ergeben könnten. Die Arbeit von Holger Dörnemann ist eine „zünftige” Arbeit zur Thomasforschung. Sie ist keine entspannende „Bettlektüre“, sondern fordert ausdauerndes Mitdenken – und gegebenenfalls Lektüre der zitierten Quellentexte, also mit der STh in greifbarer Nähe. Aber solche Ausdauer wird reich belohnt. Denn die Arbeit Dörnemanns – der inzwischen beruflich den praktisch-theologischen Konsequenzen seiner Untersuchung auf der Spur ist – ist, wenn schon – um große Worte zu vermeiden – kein „Markstein“, so aber ganz gewiss ein wichtiger Kilometerstein auf der unabsehbar weiten Straße der Thomasforschung.
| München, 14. September 2011 Am Fest Kreuzerhöhung | Otto Hermann Pesch |