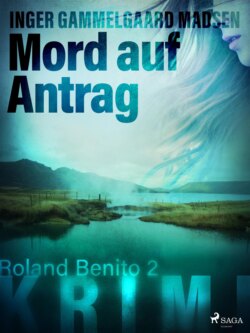Читать книгу Mord auf Antrag - Roland Benito-Krimi 2 - Inger Gammelgaard Madsen - Страница 13
9
ОглавлениеEmma war ein gutes Stück jünger als ihre verstorbene Schwester. Sabrina hatte immer viel von ihrer direkten und unvorhersehbaren Art gehalten. Sie lächelte, als Emma, schon bevor sie sich an einen freien Tisch setzten, zwei SMS entgegengenommen und beantwortet hatte – auf einem kleinen, modernen, silbernen Handy mit so winzigen Tasten, dass sie selbst sie nicht treffen würde. Aber Emmas kleine, dicke Daumen bewegten sich schnell auf ihnen, wie die eines Teenagers. »Das war mein Enkel, der mir gesimst hat«, erklärte sie mit einem müden Lächeln und tippte weiter, während sie sich setzte. Die rotgeränderten Augen zeugten davon, dass sie in den letzten Tagen viel geweint hatte.
Sabrina nickte nur. Sie kannte Emmas Familie nicht besonders gut, so oft trafen sie sich nicht. Emma wohnte ein bisschen außerhalb von Ribe und blieb nur in Aarhus, bis sie damit fertig waren, die Wohnung zu räumen. Sie wohnte während der Zeit im Hotel Cabinn neben dem Aarhuser Theater. Kaj, ihr Mann, war zu Hause geblieben. Sie hatte einen Bauernhof mit kleinen Schweinen, die versorgt werden mussten.
»Nee, das dauert hier wirklich zu lange«, rief Emma aus, sobald sie das Handy in die Tasche gelegt hatte. »Wo bleibt der Kellner bloß?«
Die beiden sahen zum Café, wo zwei Kellner im Linienverkehr zwischen den offenen Türen des Cafés und den Tischen entlang des Flusses auf und ab eilten. Es waren viele Menschen unterwegs. Die Sonne schien und wärmte wie an einem Sommertag, die meisten hatten freibekommen und genossen eine Tasse Kaffee oder ein Fassbier, bevor sie nach Hause gingen. Nur die Angestellten der Läden mussten neidisch in den Sonnenschein hinausschauen. Es dauerte noch ein paar Stunden, bis auch sie an der Reihe waren. Aus dem Haupteingang des Magasin strömten Leute hinein und heraus.
»Die haben doch viel zu tun, Emma. Haben wir denn keine Zeit zu warten?«
Emma erhob sich ungeduldig. Sie war eine kleine, kräftige Dame, verstand es aber, sich geschickt zu kleiden, sodass es nicht das Erste war, das einem auffiel. Die Sonne ließ den weißen Pagenkopf wie Silber leuchten, die kleinen Augen sahen trotzig aus. Sie klemmte ihre Tasche unter den Arm und richtete sich auf. »Nee, Sabrina. Wir haben zu tun. Wenn wir mehrere Stunden warten müssen, um eine einfache Tasse Kaffee serviert zu bekommen, schaffen wir heute nichts mehr.« Sie verschwand mit schnellen, kleinen Schritten im Gedränge des Cafés, die Tasche unter den Arm gepresst, als ob sie fürchtete, jemand würde sie ihr hier in der Großstadt stehlen. Sabrina lächelte wieder. Drinnen würde sie ganz sicher auch warten müssen.
Sie lehnte sich in dem nicht besonders bequemen Caféstuhl zurück, dessen Rückenlehne an der Wirbelsäule scheuerte, und betrachtete die Passanten. Zog man die Jahreszeit in Betracht, waren die Leute sehr dünn angezogen. Sie genoss den Duft aus dem Café. Eine wohlriechende Tasse Espresso oder Cappuccino nach der anderen wurde an ihr vorbeigetragen. Die Atmosphäre ließ sie an Italien und Peter denken. Jetzt, da sie von ihm weg war, vermisste sie ihn. Aber war es nicht oft so, dass man von jemandem wegmusste, um zu erkennen, dass man ihn nicht entbehren wollte? Vielleicht fühlte er das Gleiche, oder was machte er allein in Mailand? Heute Abend hätten sie mit seinen Kollegen von Grundfos gemeinsam gegessen. Das war das Erste, worüber er sich beklagte, als sie zur Beerdigung nach Hause nach Dänemark wollte. Eine Feier war für ihn wichtiger als ein Todesfall in der Familie. Oder besser gesagt, seine Karriere war wichtiger. Sie sah ein umschlungenes Paar vorbeigehen und starrte ihnen neidisch nach. Es war lange her, dass sie und Peter so herumgelaufen waren. Sie fühlte sich allmählich wie eine Selbstverständlichkeit an seiner Seite, wenn es ihm gerade passte. Wenn nicht, konnte sie allein durch Mailands Straßen laufen und exklusive Schaufenster mit Modemarken ansehen, die sie sich nie würde leisten können. Im Laufe der letzten Monate hatte sie es einfach bereut, mit ihm gegangen zu sein. Und jetzt saß sie hier und vermisste ihn schon nach zwei Tagen. Wie hätte sie ein ganzes Jahr ohne ihn auskommen sollen? Sie legte eine Hand auf ihren Bauch, den die Sonne wärmte.
Und dann war da das, was sie ihm nicht erzählt hatte. Peter hatte immer sehr vehement darauf bestanden, dass keine Kinder kommen sollten, bevor er nicht als Produktionsingenieur ausgebildet wäre und das Gehalt bekäme, das er verdiente. Er erwartete, dass sie die Pille nahm, aber an dem Abend hatte sie es vergessen. Warum war es bei ihr auch gleich so leicht gewesen, wenn so viele andere keine Kinder bekommen konnten? Die Einzige, mit der sie über so etwas hätte reden können, wäre – Oma.
Überraschend schnell kam Emma zum Tisch zurück mit einem Tablett, auf dem eine kleine Tasse Kaffee und eine große Tasse Cappuccino standen. Auf den Untertassen lagen kleine, verpackte Schokoladenstückchen. Sabrina stand sofort auf, um mit dem Tablett zu helfen. »Das ging schnell! Was hast du mit der Schlange da drinnen gemacht?«, fragte sie beeindruckt.
Emma lächelte geheimnisvoll, streckte ihre Ellbogen raus und stieß damit. Sabrina lachte und setzte sich. Es war fast so, als ob sie wieder mit Oma zusammen wäre. Sie hatte sie auch immer zum Lachen gebracht.
»Gut, du hast dich erinnert, dass ich Cappuccino wollte«, meinte sie.
»Du begnügst dich mit gewöhnlichem Kaffee, wie ich sehe.«
Emma schielte böse auf Sabrinas große Tasse mit weißem Schaum und Schokoladenstreuseln. »Ja, danke. Ich darf keine fette Schlagsahne in meinem Kaffee zu mir nehmen.« Sie rümpfte die Nase und konzentrierte sich auf ihre Tasse.
»Das ist keine Schlagsahne, Emma. Das ist aufgeschäumte Milch. Und es würde mich nicht wundern, wenn es sogar fettarme Milch wäre. In Italien wirkt die Milch fetter, ohne dass sie es unbedingt ist.«
»Gewöhnst du dich langsam an dein neues Land?«, fragte Emma neugierig und sah sie mit zusammengekniffenen Augen gegen die Sonne an, die gerade auf ihren Tisch schien.
»Ich komm ja wieder nach Hause, deswegen würde ich es nicht gerade mein neues Land nennen. Um ganz ehrlich zu sein, kann ich Mailand nicht leiden. Aber an einem Wochenende sind wir nach Süditalien gefahren und haben Positano besucht. Das war schön. Fast keine Autos. Das Meer und die südländische Atmosphäre. Fast wurde unter den Balkonen abends Mandoline gespielt.« Sie lächelte abwesend. Peter hatte nicht so gestresst gewirkt und eine romantische Seite von sich gezeigt, die sie nur selten sah. Sie war davon überzeugt, dass ihr Kind dort gezeugt worden war.
Schweigend saßen sie da, während sie die Schokolade auspackte und Emma Zucker in den Kaffee rührte. Die Freilegung des Flusses war längst fertig. Das große Projekt war abgeschlossen, und die allermeisten Aarhuser fanden, dass sich all die Umleitungen und Bauarbeiten gelohnt hatten.
Emma starrte auf das Wasser des Flusses. Es war nicht schwer zu erraten, an wen sie dachte.
»Ich vermisse sie auch sehr«, sagte Sabrina und probierte den Cappuccino. Er schmeckte längst nicht so gut wie der, den sie in der Bar del Corso am Corso Vittorio Emanuele genoss, aber das lag nicht nur an den Kaffeebohnen. In Italien schmeckte alles an einem Cappuccino anders. Das Wasser, die Milch, der Zucker.
Tante Emma aß Schokolade und sah weiter aufs Wasser, das ruhig und in der Sonne glitzernd hinter der niedrigen Absperrung dahinfloss. »Elina liebte es, hier zu sitzen und die Leute anzuschauen, wusstest du das? Sie saß bestimmt viele Male auf diesem Stuhl und genoss eine Tasse Kaffee. Und dachte sich Geschichten über die Leute aus.« Emma lächelte, aber ihre Augen waren matt, als sie sie ansah. »Als Kind warst du bestimmt der größte Fan ihrer Geschichten.«
»Ich fand sie toll«, gab sie zu.
»Ihre Fantasie hat nie nachgelassen. Leider habe ich sie als Kind nicht so oft gesehen, weil ich so viel jünger bin als sie. Elina wurde als 14-Jährige weggeschickt, um Geld zu verdienen. So war das halt damals in den armen Familien. Aber ich habe es genossen, wenn sie in den Ferien zu Hause war und wir zusammen sein konnten. Ich habe wahrhaftig auch an ihren lustigen Erzählungen, die immer vom Guten handelten, Freude gehabt.«
Sabrina nickte. »Oma war ein guter Mensch.« Sie sah Emma lange an, die sie in so vieler Hinsicht sehr an ihre Schwester erinnerte, bevor sie beschloss, sie zu fragen. Die Gedanken hatten sie die ganze Nacht über gequält, während sie mit all den Erinnerungen im Bett ihres Großvaters schlief. Es ärgerte sie, dass Peter ihre Wohnung in der Dalgas Avenue für das Jahr, das sie in Italien wohnten, an ein junges Paar vermietet hatte, aber die Mieteinnahmen waren hilfreich und genau genommen lebten sie davon, weil sie da unten nicht arbeiten konnte. Sie hatte überlegt, ein Hotelzimmer zu nehmen, während sie sich in Aarhus aufhielt, aber warum sollte man dafür Geld ausgeben, wenn Omas schöne Wohnung am Großen Marktplatz leer stand. Bei ihrem Vater und Carola wollte sie auf keinen Fall wohnen.
»Emma, weißt du, was zwischen meinem Vater und Oma passiert ist? Hat das etwas mit meiner Mutter zu tun?«, fragte sie vorsichtig.
»Ich erinnere mich gut daran, als Josefine starb. Deine Mutter war sehr krank, Sabrina. Das hat uns alle sehr mitgenommen. Ich weiß nicht, ob Elina es deinem Vater nachgetragen hat, weil er so schnell diese – Carola heißt sie, oder? – geheiratet hat. Sie hat es nie erwähnt. Nachdem wir deine Mutter begraben hatten, wollte sie überhaupt nicht mehr über sie sprechen. Ach, Sabrina, du warst so klein ...« Emma nahm ihre Hand und drückte sie fest.
»Ich kann mich nicht an die Beerdigung erinnern. Ich kann mich noch nicht mal an Mama erinnern. Nur in kleinen, kurzen Momentaufnahmen, Szenen, die ich vielleicht nur erzählt bekommen habe.«
»Du warst erst vier. Wie sollst du dich an sie erinnern können, meine Liebe? Josefine war ein wunderbarer Mensch. Du bist ihr unfassbar ähnlich, sowohl innerlich als auch äußerlich. Sie hatte die gleichen dunklen Augen wie du. Aber zuletzt war sie sehr dünn. Überhaupt nicht wiederzuerkennen. Vor ihrer Krankheit war sie ein klitzekleines bisschen mollig. Aber du hast auch ganz schön abgenommen, Sabrina. Ein bisschen zu viel, finde ich. Man braucht doch noch Reserven, falls man krank wird.«
Sabrina wurde ganz verlegen und legte wieder eine Hand auf ihren Bauch. Die schlanke Linie würde nicht von Dauer sein. Aber sie hatte über zehn Kilo abgenommen, als sie das Studium der Ernährungswissenschaften begonnen und mehr über gesunde Ernährung gelernt hatte. Das war, bevor sie Peter kennengelernt hatte, aber sonst hätte er sie wohl auch nicht beachtet. Er war sehr kritisch, was Ernährung und überhaupt Aussehen betraf. In ein dickes Mädchen hätte er sich nie verlieben können.
»Aber man kann natürlich auch nicht als dicker Stöpsel wie ich rumlaufen, wenn man in deiner Branche arbeitet«, kommentierte Emma mit einer gewissen Selbsterkenntnis und stopfte sich demonstrativ das letzte Stück Schokolade in den Mund.
»Nicht alle Ernährungsberater sind gleich schlank«, lachte Sabrina.
»Vermisst du deine Arbeit? Ich meine – ist das nicht gut, von all den sterbenden und kranken Menschen weg zu sein, die ...«
»Ich vermisse meinen Job!«, unterbrach sie und sah Emma bestimmt an. »Es ist so lebensbejahend zu sehen, wie sehr kranke Menschen immer noch den Willen haben weiterzuleben, und es ist unbeschreiblich, dabei zu sein, den letzten Teil ihres Lebens lebenswert zu machen.«
Emma nickte und schwieg lange.
»Gab es nie einen Kranken, der darum gebeten hat, dass ihr sein Leiden beendet?«, fragte sie ein bisschen heiser mit unsicherer Stimme.
»Meinst du aktive Sterbehilfe? Nein, den Gedanken haben die Patienten im Hospiz selten. Manchen geht es deutlich besser, wenn sie zu uns kommen. Manchmal mussten wir sogar die Sterbenden heimschicken, weil sie gar nicht mehr moribund waren. Eine Schätzung des Hospiz Forums Dänemark besagt, dass an manchen Stellen jeder Fünfte wieder nach Hause geschickt wird, um Platz für schwerer erkrankte Patienten zu schaffen. Das regt zum Nachdenken an, oder? Davon abgesehen ist es verboten, einem anderen das Leben zu nehmen. Das gilt für alle, auch für Krankenschwestern und Ärzte.«
Ihre Stimme klang nicht ganz überzeugend. Sie erinnerte sich an einen Zwischenfall vor ein paar Jahren, als eine Patientin eine Krankenschwester genau darum gebeten hatte, ihr nämlich so viel Morphium zu geben, dass sie nicht mehr aufwachen würde. Die Krankenschwester hatte lange mit der Patientin gesprochen und herausgefunden, dass sie eigentlich gar nicht sterben wollte, aber Mitleid mit ihrem Mann hatte, der sie treu jeden einzelnen Tag besuchte. Danach war die Krankenschwester im Schwesternzimmer zusammengebrochen und hatte von diesem Vorfall und anderen Ereignissen erzählt, die sie im Krankenhaus auf der Intensivstation erlebt hatte, wo sie gearbeitet hatte, bevor sie ins Hospiz Skovdal gekommen war. Damals wusste sie nicht genau, was früher im Anschluss daran geschehen war, und glaubte, das sei ein normales Verfahren. Während einer Nachtschicht wurde sie Zeuge davon, wie ein Arzt einem Patienten so viel Morphium gab, dass er danach starb. Sie standen da und sahen zu. Später fand sie heraus, dass die erhöhte Dosis im Morphiumtropf nie notiert worden war, und als sie den Arzt nach dem Grund fragte, antwortete er, das sei für die Angehörigen am besten. Sie hatte nicht gewagt, ihrem Chef zu widersprechen, aus Angst, gefeuert zu werden. Aktive Sterbehilfe kommt in Krankenhäusern tatsächlich vor – öfter als man ahnt. Es geschieht aus verschiedenen Gründen, aus Mitleid, Barmherzigkeit oder aus reinem und purem Zynismus, hatte sie gesagt.
»Falls es trotzdem keine Hoffnung auf Heilung gibt, ist das dann nicht besser für alle? Wenn das Morphium einfach hochgedreht wird, merkt der Patient doch nichts«, fuhr Emma fort, obwohl sie einen Debattenbereich betrat, über den sie sich nie einig werden würden.
»Im Hospiz Skovdal benutzen wir keinen Morphiumtropf. Es gibt viel zu viele Meinungsverschiedenheiten, wie er gesetzt werden soll und ob oder wann die Dosis gesteigert werden soll. Es ist immer eine Frage der Einschätzung. Ein Patient mit starken Schmerzen bekommt das Morphium stattdessen subkutan – also unter die Haut – mit einer Morphinpumpe verabreicht, die den Patienten mehr bei Bewusstsein lässt, sodass er in der letzten Zeit, die sie zusammen haben, noch etwas von seinen Angehörigen hat und umgekehrt. Niemand hat das Recht, Gott zu spielen.« Mit ihrem Tonfall setzte sie einen Schlusspunkt unter ihre Debatte. Im selben Moment war das Motorengeräusch eines weißen, mit Werbung überladenen Taxis zu hören, das einen Haufen betrunkener Menschen abholte, die wohl außerhalb der Stadt weiter Party machen wollten.
»Na, wir müssen auch zurück und weiterkommen. Elina hat alles aufgehoben, sodass es viel aufzuräumen gibt. Ich habe bezahlt«, meinte Emma und hakte sich bei ihr unter, als sie losgingen und bei der Immervad um die Ecke bogen. Den Mann, der ihnen folgte, bemerkten sie nicht.