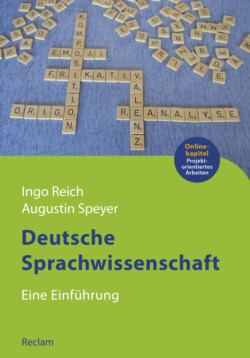Читать книгу Deutsche Sprachwissenschaft. Eine Einführung - Ingo Reich - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.6 Zwischen Semantik und Pragmatik
ОглавлениеDie Diskussion in den letzten fünf Abschnitten hat gezeigt, dass sprachliche Kommunikation auf verschiedenen Ebenen stattfindet: explizit sprachlich kodiert, aber auch implizit (nicht-monoton) inferiert; auf einer inhaltlichen (propositionalen) Ebene, aber auch auf einer Handlungsebene. Möchte man sich dieses System nochmals in Gänze am Beispiel der Äußerung ich habe gerade leider viel zu tun vor Augen führen, dann könnte dies wie folgt aussehen: Für jedes einzelne Wort in dem Satz ich habe gerade leider viel zu tun haben wir in unserem mentalen Lexikon eine gelernte Bedeutung abgespeichert, Von der Ausdrucksbedeutung zur Äußerungsbedeutungdie AusdrucksbedeutungAusdrucksbedeutung des Wortes. In dem Satz ich habe gerade leider viel zu tun werden diese Ausdrucksbedeutungen entlang der syntaktischen Struktur zu einer komplexen Ausdrucksbedeutung kombiniert. Diese komplexe Ausdrucksbedeutung muss (um beurteilbar zu sein) in der Äußerungssituation verankert werden, insbesondere muss den deiktischen Ausdrücken ein referenzieller Bezug zugewiesen werden. Das Resultat der Verankerung der Ausdrucksbedeutung des Satzes im Äußerungskontext haben wir seine ÄußerungsbedeutungÄußerungsbedeutung genannt.
Wie wir in Kapitel 7 noch sehen werden, kann sich diese Äußerungsbedeutung grundsätzlich aus expressiven und aus propositionalen Bestandteilen zusammensetzen. Beschränken wir uns auf den propositionalen GehaltGehaltpropositionaler der Äußerungsbedeutung des Satzes ich habe gerade leider viel zu tun (»dass ich gerade viel zu tun habe«), dann fällt dieser im Wesentlichen mit dem zusammen, was Grice (1975) als das GesagteGesagtes bezeichnet hat. Mit der Äußerung von ich habe gerade leider viel zu tun wird dieser propositionale Gehalt (das Gesagte) behauptet (Handlungsebene). Ausgehend von der Behauptung des Gesagten können nun auf der Basis der Grice’schen Maximen weitere Annahmen darüber getroffen [57]werden, worin der Von der Äußerungsbedeutung zum kommunikativen Sinneigentliche kommunikative Sinnkommunikativer Sinn der Äußerung besteht, was mit ihr gemeintGemeintes ist. In einem Kontext, in dem ein Studierender außerhalb der Sprechstunde an meine Tür klopft und etwas mit mir besprechen möchte, könnte dies zum Beispiel die Aufforderung sein, ein anderes Mal vorbei zu kommen. Dies wäre eine (partikulare) Konversationsimplikatur. Die Beziehung der fraglichen Ebenen zueinander ist in Abbildung 3.4 schematisch dargestellt.
Abb. 3.4: Erste schematische Darstellung der Interpretationsebenen
Wie die Darstellung in Abbildung 3.4 nahelegt und auch schon mehrfach angedeutet wurde, werden die Begriffe Sprechakt und kommunikativer Sinn in dieser Einführung so verwendet, dass sie Unterschiedliches bezeichnen: Der Begriff des Sprechakts bezieht sich auf eine sprachliche Handlung, der Begriff des Kommunikativer Sinn und Sprechaktkommunikativen Sinnskommunikativer Sinn ist dagegen ein rein inhaltlicher Begriff und fällt im Wesentlichen mit dem Begriff der (partikularen) Konversationsimplikatur im Sinne von Grice (1975) zusammen. Das ist grundsätzlich konsistent mit der ursprünglichen Verwendung in Bierwisch (1980), auf den der Begriff des kommunikativen Sinns letztlich zurückgeht. Tatsächlich ist die Beziehung zwischen kommunikativem Sinn und Sprechakt mit Bierwisch (1980) jedoch etwas komplexer: Der kommunikative Sinn ist in dem Sinne als Teil eines Sprechaktes aufzufassen, als er erst zur Realisierung eines Sprechaktes führt. Daher müsste der kommunikative Sinn in dem obigen Schema eigentlich dem Sprechakt vorausgehen. Da wir die Beziehung zwischen der Äußerung eines Satzes und dem mit der Äußerung typischerweise verbundenen Sprechakt direkter charakterisieren würden (über eine Default-Beziehung), weichen wir hier von Bierwisch (1980) ab. Im Fall indirekter Sprechakte müsste man dem kommunikativen Sinn aber tatsächlich eine weitere Sprechaktebene nachschalten, die die primäre Illokution bezeichnet.
So weit, so gut. Die zentrale Idee von Grice ist also, dass wir das Gemeinte auf der Basis des Gesagten, den Grice’schen Maximen und Weltwissen ableiten. Das Gesagte ist dabei als der Teil einer Äußerungsbedeutung aufzufassen, der grundsätzlich als wahr oder als falsch bewertbar ist. In der Semantik (Kapitel 7) ist hierfür auch der Begriff der PropositionProposition (Aussage) üblich. Eine zentrale Beobachtung ist nun, dass sprachliche Unvollständige ÄußerungenÄußerungen für sich genommen im Allgemeinen noch keine Proposition (also eine als wahr oder falsch bewertbare Aussage) ausdrücken. Machen wir hierzu ein konkretes Beispiel: Zu Beginn von Kapitel 2 hatten wir eine Situation beschrieben, in der Erna, Lisbeths beste Freundin, nachmittags bei Lisbeth zu Besuch ist. Erna setzt sich an den Tisch und Lisbeth bietet ihr daraufhin mit den Worten »Eine Tasse Kaffee?« eine Tasse Kaffee an. Lassen wir Erna nun wie folgt antworten: »Ich hatte schon drei.«
Wie für die Frage »Eine Tasse Kaffee?« ist auch für die Antwort »Ich hatte schon drei.« offensichtlich, dass sie keinen vollständigen Satz darstellt und die Verankerung der deiktischen Ausdrücke damit allein noch nicht zu einer als wahr oder falsch bewertbaren Aussage (einer Proposition) führt: Die Äußerung »Ich hatte schon drei.« ist in dem Sinne unvollständig, dass durch die Äußerung selbst nicht explizit gemacht wird, wovon Erna schon drei hatte. Im Kontext der Frage ist zwar sofort klar, dass es sich um drei Tassen Kaffee handelt, und wir werden die Äußerung auch sofort entsprechend gedanklich ergänzen, aber diese Annahme ist eben eine Annahme, die wir auf der Basis des Kontexts machen und nicht (allein) auf der Basis der Äußerung. Da die Verankerung der Ausdrucksbedeutung einer Äußerung im Äußerungskontext nicht immer unmittelbar zu einer Proposition führt, werden wir im Folgenden zwischen Sprachliche Kodierung und pragmatische Anreicherungeiner explizit kodierten ÄußerungsbedeutungÄußerungsbedeutungexplizit kodierte und einer pragmatisch angereicherten ÄußerungsbedeutungÄußerungsbedeutungpragmatisch angereicherte unterscheiden. Letztere ist die (gegebenenfalls erforderliche) pragmatische AnreicherungAnreicherungpragmatische der explizit kodierten Äußerungsbedeutung auf der Basis kontextuell plausibler Annahmen, mit dem Resultat einer (minimalen) als wahr oder falsch bewertbaren Aussage (Proposition). Wenn wir im Folgenden also von Äußerungsbedeutung sprechen, dann ist damit (solange nichts anderes gesagt wird) immer die pragmatisch angereicherte Äußerungsbedeutung gemeint.
[59]Die explizit kodierte Äußerungsbedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ergibt sich aus dessen Ausdrucksbedeutung und ihrer Verankerung im Äußerungskontext. (In Abschnitt 3.1 haben wir sie noch einfach Äußerungsbedeutung genannt.)
Werden sprachliche Äußerungen vom Adressaten (über nicht-monotone Inferenzen) inhaltlich ergänzt, dann spricht man von pragmatischer Anreicherung.
Die (pragmatisch angereicherte) Äußerungsbedeutung ergibt sich aus der explizit kodierten Äußerungsbedeutung über pragmatische Anreicherungen. Sie ist im Prinzip als wahr oder falsch beurteilbar, kann aber auch expressive Bedeutung tragen.
Die Beobachtung, dass die explizit kodierte Äußerungsbedeutung im Allgemeinen noch pragmatisch angereichert werden muss, um eine grundsätzlich als wahr oder falsch beurteilbare Aussage zu erhalten, ist für den Grice’schen Ansatz nicht ganz unproblematisch. Das Problem ist – wie z. B. Levinson (2000) ausführlich darstellt –, dass nach Grice (1975) Konversationsimplikaturen immer auf der Basis des Gesagten (unter Bezug auf die Gesprächsmaximen) herzuleiten sind. Um bei unvollständigen Äußerungen aber überhaupt zu einer als wahr oder falsch beurteilbaren Aussage (also dem Gesagten) kommen zu können, muss die explizit kodierte Äußerungsbedeutung pragmatisch angereichert werden. Dieser Prozess der pragmatischen Anreicherung ist aber wiederum ein nicht-monotoner Inferenzprozess, der dem der konversationellen Implikaturen zumindest sehr nahekommt, wenn nicht sogar mit ihm identisch ist. Im Allgemeinen braucht man also das Gesagte, um Implikaturen abzuleiten, gleichzeitig aber auch Implikaturen, um zum Gesagten zu kommen. Levinson (2000) nennt dies Der Grice’sche Zirkelden Grice’schen ZirkelGrice'sche Zirkel. Dieser wird von Levinson (2000) in der Weise aufgelöst, dass erstens generalisierte und partikulare Implikaturen als unterschiedliche Prozesse betrachtet werden: Generalisierte Konversationsimplikaturen sind Default-Annahmen auf der Basis von Heuristika, während partikulare Konversationsimplikaturen alleine über Relevanzbetrachtungen ausgelöst werden. Zweitens nimmt Levinson (2000) an, dass pragmatische Anreicherung nur über generalisierte Konversationsimplikaturen erfolgt. Damit muss bei der pragmatischen Anreicherung nicht mehr Bezug auf die Maximen genommen werden und die Zirkularität ist damit aufgelöst.
In der Relevanztheorie (Sperber & Wilson 1986) wird dieses Problem gelöst, indem die Grenze zwischen Semantik und Pragmatik verschoben und zwischen dem gezogen wird, was wir Ausdrucksbedeutung (›Logische Form‹ in der Terminologie der Relevanztheoretiker) und explizit kodierte Äußerungsbedeutung genannt haben: Dem Prozess der pragmatischen Anreicherung (der ›Explikatur‹) und des Ziehens weiterer Schlussfolgerungen (also von ›Implikaturen‹ im engeren Sinne) liegt zwar derselbe Mechanismus zugrunde (die Annahme optimaler Relevanz), aber da beide Prozesse (i) pragmatischer Natur und (ii) nicht linear geordnet sind (im Sinne von zuerst Explikatur, dann Implikatur), kann Zirkularität erst gar nicht entstehen.
Betrachtet man das obige Beispiel »ich hatte schon drei« nochmal etwas genauer, dann ist am Ende gar nicht so klar, dass die Äußerung in syntaktischer Hinsicht wirklich unvollständig ist. Man kann in der Syntax durchaus argumentieren, dass das Numeral drei hier allein noch kein geeignetes Objekt ist und aus strukturellen Gründen einen so genannten nominalen Kopf benötigt. Tatsächlich wird von nicht wenigen Linguisten in solchen Fällen angenommen, dass hier eine Ellipse vorliegt: Auf syntaktischer Ebene ist die Phrase Tassen Kaffee eigentlich präsent, sie wird aber (aus Ökonomiegründen) nicht ausgesprochen, da sie über die vorige Äußerung leicht rekonstruierbar ist. So gesehen wäre die Phrase Tassen Kaffee sprachlich kodiert, aber eben nur auf syntaktischer Ebene und nicht auf phonetischer Ebene, also implizit und nicht explizit. Damit ist sie folglich nicht Teil der explizit kodierten Äußerungsbedeutung. Folgt man dieser Argumentation, dann ist die Rekonstruktion der Lücke grammatisch bzw. strukturell motiviert und wir sprechen daher Strukturbedingte Anreicherungvon strukturbedingter AnreicherungAnreicherungstrukturbedingte oder auch von SättigungSättigungAnreicherung. Die strukturbedingte Anreicherung einer explizit kodierten Äußerungsbedeutung bezeichnen wir als die grammatisch determinierte ÄußerungsbedeutungÄußerungsbedeutunggrammatisch determinierte. (Man vergleiche hierzu auch die Überlegungen in der entsprechenden Vertiefungsbox in Abschnitt 3.1.)
Wenn es pragmatische Anreicherungen gibt, die strukturbedingt sind, dann gibt es vermutlich auch pragmatische Anreicherungen, die dies (höchstwahrscheinlich) nicht sind. Tatsächlich lässt sich auch dies an unserem Beispiel illustrieren. Denn was mit der Äußerung von »Ich hatte schon drei« in der obigen Situation kommuniziert wird, ist ja nicht einfach, dass Erna schon drei Tassen Kaffee hatte, sondern genau genommen, dass Erna heute schon drei Tassen Kaffee hatte. Der Adressat (in diesem Fall Lisbeth) ergänzt die Äußerung gedanklich also auch noch durch heute. Die naheliegende Frage ist nun, ob diese Ergänzung wie im vorigen Fall strukturell motiviert ist. Tatsächlich spricht einiges dafür, dass hier ein etwas anderer Fall vorliegt. Wir werden in der Syntax noch sehen, dass heute (in unserem Beispiel) als temporales Adverbial eine Angabe ist. Das heißt im Wesentlichen, dass heute (in diesem Fall) in syntaktischer Hinsicht nicht zwingend erforderlich ist, um einen vollständigen Satz zu bilden. Das Adverbial kann also frei hinzugefügt werden, muss es aber nicht. In diesem Sinne hat die pragmatische Anreicherung der Äußerung durch das Temporaladverbial heute keine strukturelle Basis und wir sprechen entsprechend von Freie Anreicherungeiner freien AnreicherungAnreicherungfreie.
Man könnte hier argumentieren, dass das Adverbial heute zwar syntaktisch fakultativ, aber in Semantisch motivierte Anreicherung?semantischer Hinsicht obligatorisch ist, damit die Äußerung überhaupt eine beurteilbare Aussage ausdrückt, also eine Aussage, die wir als [61]wahr oder falsch bewerten können. Diese Frage ist empirisch nicht einfach zu entscheiden. Vermutlich wird man sagen müssen, dass eine Äußerung der Art »Ich hatte schon drei Tassen Kaffee« bereits temporal spezifiziert ist und (semantisch) ausdrückt, dass Erna irgendwann (in ihrem Leben) schon drei Tassen Kaffee hatte. Diese Aussage ist aber sicher nicht die Aussage, die wir verstehen und die vom Sprecher intendiert ist. Da es in der gegebenen Situation aber nicht relevant ist, ob Erna schon einmal irgendwann in ihrem Leben drei Tassen Kaffee getrunken hat, wird der Adressat die Aussage auf den relevanten Zeitraum (heute) verengen. Bei einer Äußerung von »Ich habe schon dreimal geheiratet« wird er es dagegen (sehr wahrscheinlich) nicht tun.
Abbildung 3.5 soll die in diesem Kapitel eingeführten Begrifflichkeiten und die jeweiligen Eine schematische ZusammenfassungZusammenhänge (in leicht vereinfachter Form) grafisch verdeutlichen:
Abb. 3.5: Interpretations- und Handlungsebenen im Beispiel »Ich hatte schon drei.«
Ziel der schematischen Darstellung in Abbildung 3.5 ist vor allem, die Ebenen der Ausdrucksbedeutung, der Ebenen der Äußerungsbedeutung und kognitive VerarbeitungÄußerungsbedeutung, des kommunikativen Sinns und des Sprechakts deutlich voneinander zu trennen und innerhalb der Äußerungsbedeutung nochmals zwischen den verschiedenen Ebenen zu differenzieren. Die Pfeile sollen hier den strukturellen Zusammenhang zwischen diesen Ebenen deutlich machen. Die Linearisierung sollte dabei aber nicht so verstanden werden, dass mit ihr gleichzeitig eine entsprechende linear geordnete kognitive Verarbeitung behauptet wird. Es ist zwar sicherlich so, dass das Erfassen der Äußerungsbedeutung der Aktivierung von Ausdrücken im mentalen Lexikon nachfolgt. Aber ob z. B. die Prozesse der strukturbedingten und der freien Anreicherung ebenfalls kognitiv aufeinander folgen, kann durchaus und mit einiger Berechtigung in Frage gestellt werden. Daher sollte man solche didaktisch motivierten Abbildungen nicht überinterpretieren. Wer sich für eher kognitive Aspekte pragmatischer Prozesse interessiert, sei auf die genannten Arbeiten der Relevanztheorie verwiesen oder – wer vor etwas formaleren Zugängen nicht zurückschreckt – auch auf spieltheoretische Ansätze (vgl. z. B. Jäger 2012).