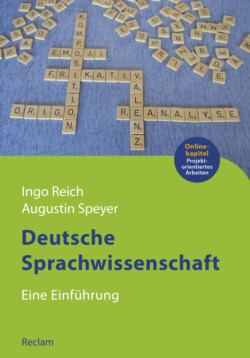Читать книгу Deutsche Sprachwissenschaft. Eine Einführung - Ingo Reich - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Sprachliche Kommunikation
ОглавлениеSprache dient uns im Alltag also (vor allem) zur Kommunikation, das heißt in erster Annäherung, sie dient der gezielten Vermittlung Information und Kommunikationvon Information. Der Begriff der sprachlichen KommunikationKommunikation steht damit im Zentrum des Sprachgebrauchs. Nähern wir uns diesem Begriff eher deskriptiv an (und verweisen hier nur nebenbei auf komplexe Modelle wie das Organon-Modell von Bühler 1934 oder das Sender/Empfänger-Modell von Shannon & Weaver 1949), indem wir eine nicht untypische Situation betrachten: Erna ist bei Lisbeth zu Besuch. Lisbeth bietet ihr zunächst einen Platz an und fragt dann:
Abb. 2.1: Eine typische Kommunikationssituation. – © Julia Stark
Halten wir zunächst das (mehr oder weniger) Offensichtliche fest: Kommunikation erfolgt typischerweise zwischen zwei oder mehreren Kommunikationspartnern, Sprecher und Adressateinem SprecherSprecher (in unserem Fall Lisbeth) und einem (oder mehreren) AdressatenAdressat (in unserem Fall Erna). Die Unterscheidung zwischen Sprecher und Adressat bildet dabei die Basis für die Unterscheidung zwischen [14](sprecherseitiger) Sprachproduktion und (adressatenseitiger) Sprachverarbeitung in der Psycholinguistik.
Der Sprecher äußert in der fraglichen Situation (der ÄußerungssituationÄußerungssituation) einen sprachlichen Ausdruck (in unserem Fall »Eine Tasse Kaffee?«) mit einem bestimmten kommunikativen Zielkommunikatives Ziel, das heißt, er verfolgt Kommunikative Intention und kommunizierte Informationeine kommunikative Intentionkommunikative Intention (Absicht). Der Adressat hört und verarbeitet diese Äußerung und kommt am Ende dieses Prozesses zu einer begründeten Hypothese darüber, warum der Sprecher diesen sprachlichen Ausdruck geäußert hat und was er ihm, dem Adressaten, mit dieser Äußerung sagen möchte. (In unserem Fall wäre das die Annahme, dass Lisbeth mit ihrer Äußerung Erna eine Tasse Kaffee anbieten möchte.) Entspricht das, was der Adressat auf diese Weise verstanden hat, im Wesentlichen dem, was der Sprecher tatsächlich kommunizieren wollte, dann sprechen wir von erfolgreicher Kommunikation.
Ein Sprecher hat mit seiner Äußerung eine bestimmte Information (erfolgreich) kommuniziert, wenn (i) der Sprecher diese Information kommunizieren wollte und (ii) der Adressat aufgrund der Äußerung (und weiterer Überlegungen) auch annimmt, dass der Sprecher ihm genau diese Information kommunizieren wollte.
Bei diesem adressatenseitigen Verstehensprozess muss man nun offenbar zwei Ebenen der Kommunikation unterscheiden. Ausgangspunkt der Hypothesenbildung ist natürlich das Verstehen der sprachlichen Äußerung selbst: Die Äußerung besteht aus einzelnen Wörtern mit einer (mehr oder weniger) festen und gelernten Bedeutung. Diese einzelnen Wortbedeutungen verbinden sich in der Äußerung zu einer komplexen Bedeutung. In diesem Sprachlich kodierte InformationSinne kodiertkodiert der komplexe Ausdruck sprachlich eine bestimmte Information: Die Äußerung »Eine Tasse Kaffee?« wird aufgrund der Bedeutung von eine Tasse Kaffee immer in irgendeiner Form mit einer Tasse Kaffee zu tun haben (und nicht etwa mit einem Stück Holz). Diese Information wird explizit kommuniziert. Wie einzelne Wortbedeutungen sprachlich kodiert werden und wie sie sich zu komplexen Bedeutungen kombinieren, untersucht die SemantikSemantik.
Das Dekodieren der Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks reicht aber im Allgemeinen noch nicht aus, um eine Hypothese darüber bilden zu können, warum der Sprecher die Äußerung vollzogen hat und was er damit sagen möchte. In unserem Beispiel liegt es natürlich nahe anzunehmen, dass Lisbeth ihrer Freundin Erna eine Tasse Kaffee anbieten möchte und wir werden ihre Äußerung entsprechend in der Art von Möchtest du eine Tasse Kaffee? [15]verstehen. Diese Annahme kommt aber nicht alleine auf der Basis sprachlich kodierter Information zustande. Erna weiß, dass Lisbeth weiß, dass Erna gerne Kaffee trinkt. Außerdem ist es in unserem Kulturkreis üblich und höflich, Gästen etwas zum Trinken anzubieten. Daher ist es eben eine plausible Annahme, dass Lisbeth Erna eine Tasse Kaffee anbieten möchte. (Das sind die weiteren Überlegungen, von denen in der obigen Definition die Rede ist.) Diese Annahme, so plausibel sie in der gegebenen Situation auch ist, ist jedoch äußerst abhängig von nicht-sprachlichen Faktoren: Davon, was Sprecher und Adressat voneinander wissen. Davon, was man in solchen Situationen üblicherweise tut. (In einer Situation, in der Erna gerade etwas auf ein Blatt Papier malt und Lisbeth dies beobachtet, würden wir die gleiche Äußerung eher in der Art von Malst du da gerade eine Tasse Kaffee? interpretieren.) Diese Informationen werden also Kontextuell inferierte Informationkontextuell inferiertinferiert (erschlossen) und implizit kommuniziert. Derartige Inferenzprozesse sind Gegenstand der PragmatikPragmatik.
Kommunikation muss dabei natürlich immer über Kommunikationskanal und -mediumeinen KanalKommunikationskanal und ein MediumKommunikationsmedium erfolgen. Bei sprachlicher Kommunikation ist dies nicht selten ein auditiver Kanal mit Schallwellen als Medium (oder auch Träger). Wir sprechen dann von mündlicher KommunikationKommunikationmündliche. Das ist aber nicht die einzige Form sprachlicher Kommunikation. Sprachliche Kommunikation kann auch gestischKommunikationgestische (z. B. im Fall von Gebärdensprachen) oder schriftlichKommunikationschriftliche über einen visuellen Kanal erfolgen. Vor allem bei schriftlicher Kommunikation wird man darüber hinaus elektronischeKommunikationelektronische von nicht-elektronischer Kommunikation unterscheiden. Schriftliche Kommunikation erfolgt meist asynchronKommunikationasynchrone, d. h., die Produktion (das Senden) und die Rezeption (das Empfangen) erfolgen grundsätzlich zeitlich versetzt.
Darüber hinaus kann Monologische und dialogische KommunikationKommunikation unidirektional (monologisch)Kommunikationmonologische oder bidirektional (dialogisch)Kommunikationdialogisch erfolgen. Von unidirektionaler Kommunikation können wir in erster Annäherung dann sprechen, wenn die Äußerung grundsätzlich keine sprachliche Reaktion des Adressaten erfordert. Typische Beispiele sind oft schriftlicher Natur (z. B. Romane oder Zeitungsartikel), können aber natürlich auch mündlicher Natur sein (z. B. Radionachrichten, Reden oder Vorträge). Umgekehrt ist bidirektionale Kommunikation häufig mündlicher Natur (z. B. in alltäglichen Gesprächen), kann aber natürlich auch schriftlicher Natur sein (z. B. in einem Briefwechsel).
Auf der Basis dieser grundlegenden Eigenschaften sprachlicher Kommunikation kann man eine Eine erste Klassifikation von KommunikationsformenKlassifikation verschiedener KommunikationsformenKommunikationsformen versuchen: Die Unterscheidung zwischen dialogischer und monologischer Kommunikation resultiert zunächst in zwei großen Klassen: verschiedene Formen des Gesprächs (dialogisch) und verschiedene Formen der [16]Mitteilung (monologisch). Diese können dann jeweils weiter in synchrone und asynchrone Formen untergliedert werden, die digital oder analog und schriftlich oder mündlich vermittelt werden. In Abbildung 2.2 wird diese Klassifikation tabellarisch zusammengefasst. Dabei ist anzumerken, dass die Bezeichnungen der Kommunikationsformen (mangels präziser Begrifflichkeiten) nicht immer ganz überzeugen und sie an der ein oder anderen Stelle eher als (mehr oder weniger) typische Repräsentanten der fraglichen Kommunikationsform aufzufassen sind.
Abb. 2.2: Eine erste Klassifikation von Kommunikationsformen
In dieser Klassifikation wird nicht explizit berücksichtigt, dass von der ursprünglichen Konzeption her genuin unidirektionale (monologische) Kommunikationsformen wie die Kurznachricht (über SMS oder Twitter) natürlich auch für bidirektionale (dialogische) Kommunikation genutzt werden können. Im Fall der SMS ist eine solche Verwendung inzwischen sicher üblich, wenn nicht sogar dominant. Aber auch bei Twitter gibt es inzwischen technisch die Möglichkeit der Antwort auf einen Tweet. Umgekehrt kann auch eine typische dialogische Kommunikationsform wie der Brief für Mitteilungen (wie z. B. einen Steuerbescheid oder eine Vorladung) genutzt werden.
In der Literatur werden nicht selten noch zwei weitere Kriterien genannt, die hier ebenfalls bewusst ausgeklammert werden. Zum einen ist das die Distanz zwischen Sprecher und Adressat, zum anderen die Frage, ob Kommunikation von Angesicht zu Face-to-face-KommunikationAngesicht, also face-to-faceKommunikationface-to-face, erfolgt oder nicht. Ist der Ort, an dem sich der Adressat befindet, im Wesentlichen identisch mit dem [17]des Sprechers, dann sprechen wir von lokaler Kommunikation. Ist er hinreichend weit von dem des Sprechers entfernt, sprechen wir von distalerdistal Kommunikation. Wird Face-to-face-Kommunikation jetzt so verstanden, dass Sprecher und Adressat am selben Ort physisch präsent sein müssen, dann fallen beide Kriterien zusammen und als distale Kommunikationsform könnte man dann das klassische Telefongespräch nennen. Wird aber lediglich gefordert, dass Sprecher und Adressat Zugang zu mimischer und gestischer Information über einen visuellen Kanal haben, dann kann man außerdem noch das Video-Telefonat (face-to-face und distal) vom klassischen Telefonat (distal, aber nicht face-to-face) unterscheiden. Auch wenn beide Faktoren (wie wir gleich noch sehen werden) großen Einfluss darauf haben, wie wir zu kommunizierende Information versprachlichen, spielen sie für die Klassifikation von Kommunikationsformen eine eher untergeordnete Rolle.