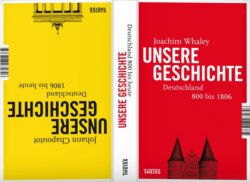Читать книгу Unsere Geschichte - Johann Chapoutot - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom östlichen zum deutschen Königreich
ОглавлениеDie fränkischen Königreiche, das westliche, aus dem schließlich Frankreich wurde, wie auch das östliche entwickelten ein spezifisches Identitätsbewusstsein. Seine Herrscher, die Söhne Ludwigs des Deutschen (Reg. 843–876; der zweite Sohn Ludwigs des Frommen), konnten ihre Ansprüche erfolgreich gegen ihre Onkel verteidigen und so ein für alle Mal die Erbfolgerechte der Söhne über die der Brüder stellen. Sie machten sich auch Lothringen zu eigen und verlagerten die Westgrenze zurück auf eine von den Flüssen Schelde, Maas und Saône gebildete Linie. Die Nordsee und im Süden die Alpen bildeten stabile natürliche Grenzen, und im Osten blieb die Grenze gegen die Slawen von Kärnten über den Böhmerwald bis hinauf zu Saale und Elbe unverändert. Das östliche Reich war gegenüber dem westlichen kulturell zurückgeblieben, aber militärisch erfolgreicher, und es entwickelte eine eigene Sprache. Auf Lateinisch hieß sie lingua theodisca, jedoch ist das Adjektiv nicht mit „deutsch“ im modernen Sinne zu übersetzen. Das Wort „diutisc“, zuerst 786 in einer althochdeutschen Übersetzung aus dem Lateinischen benutzt, bedeutete soviel wie „(all)gemein“ [im Sinne von: „zum Volk gehörig“, d. Ü.], und auch der 843 auftauchende Ausdruck „teutisci“ bezeichnete lediglich all jene, die keine Langobarden waren. Die Ostfranken besaßen keine Grammatik oder geschriebene Sprache, doch ihr über mehrere Generationen aufrechterhaltenes politisches Bündnis schuf allmählich die Grundlage für eine sich von der romanischen Sprache der West- und Südfranken unterscheidende Ausdrucksform. Es war eine Mischung aus lateinischen, keltischen und diversen regionalen nord- und ostgermanischen Elementen.
Mit dem Vertrag von Ribemont (880) wurden die Grenzen zwischen dem ost- und dem westfränkischen Reich endlich festgelegt. Ludwig III. (Reg. 876–882) machte Frankfurt am Main zur Hauptstadt des östlichen Reichs. Ihre zentrale Lage erleichterte ihm die Einbeziehung des Adels in seinen Hof. Und während die westfränkischen Könige die Herrschaft über die Kirche an das Papsttum verloren, konnte Ludwig das Recht auf die Ernennung von Bischöfen und die Kontrolle des Kirchenbesitzes in seinen Händen behalten.
Doch schwächten fortwährende gegenseitige Vernichtungskriege die Dynastie der Karolinger und verschärften ein wachsendes Krisenbewusstsein. An der Ostgrenze wurde das Mährerreich ab den 830er-Jahren zur Bedrohung, die auch anhielt, nachdem Ungarn das Reich in den 890er-Jahren überrannt hatte. 881 fielen Wikinger in das Rheinland um Aachen ein und stießen 882 und 892 bis zur Mosel vor. Der letzte König der Karolinger, Arnulf (Reg. 887–899) konnte noch 894 König von Italien und zwei Jahre später Kaiser werden, doch gelang es ihm nicht, die militärischen Unternehmungen, die praktisch in alle Richtungen hätten durchgeführt werden müssen, aufrechtzuerhalten. Sein Erbe, Ludwig das Kind (Reg. 900–911), war bei der Königskrönung im oberfränkischen Forchheim erst sechs Jahre alt und nicht mehr als eine Marionette in den Händen der mächtigen Adligen und Bischöfe. Und der Hof selbst wurde mehr und mehr vom erbitterten Kampf der Konradiner aus der Wetterau und der Babenberger aus der Gegend um Mainz beherrscht. Es ging um die Vorherrschaft im Herzogtum Franken, die sich schließlich Konrad sichern konnte. Aber die Babenberger sannen noch lange danach auf Rache.
Als die Monarchie ins Stolpern kam, gewannen die einflussreichen Markgrafen, denen im Osten die Verteidigung des Reichs oblag, an Macht. Aus den Rängen des Adels traten neue Führer hervor, die sich bald schon Herzöge nannten. Zu den besonders mächtigen Unzufriedenen gehörten die Liudolfinger aus Sachsen und die Liutpoldinger aus Bayern. Die neuen Herzöge richteten sich in den traditionellen germanischen Regionen ein: in Schwaben, Bayern, Thüringen, Sachsen, Franken, später auch in Lothringen, doch waren sie nicht die direkten Nachfolger der germanischen Herrscher der spätrömischen und merowingischen Epochen, auch handelte es sich nicht um Anführer von Ethnien oder Stämmen. Sie entstammten dem karolingischen Adel und erhoben nun den Anspruch, regionale Interessen zu vertreten und die Integrität des Königreichs insgesamt zu verteidigen. Doch ihre ausgeprägte Rivalität führte beinahe zum Untergang des Königreichs, das sie zu schützen behaupteten. Mit Unterstützung der Frankonier, der Sachsen, der Schwaben und der Bayern konnten die Konradiner die Wahl von Herzog Konrad zum König 911 in Forchheim durchsetzen. Konrad regierte bis 918. Er war der erste Herrscher, der nicht dem Geschlecht der Karolinger entstammte, verfolgte aber als Franke die Ziele seiner karolingischen Vorgänger. So wollte er Lothringen von Karl III. (dem Einfältigen), dem König von Westfranken, der es 911 erobert hatte, zurückgewinnen und des Weiteren die Vorrechte der Monarchie gegen den mächtigen Adel verteidigen. Allerdings gelang es ihm nicht, Lothringen zurückzuerobern. Das zweite Ziel erreichte er zumindest teilweise, doch erwies sich der Mangel an königlichen Vorfahren als Handicap: In Ermangelung der Aura fürstlicher Abstammung musste er sich auf Waffen stützen. In der Schlacht gegen Arnulf von Bayern (918) wurde er verwundet und starb. Da er keinen männlichen Erben hatte, konnten seine Feinde sich darauf einigen, Heinrich von Sachsen als Heinrich den Vogler zum König zu wählen. Heinrich I., „der Vogler“, regierte von 919 bis 936; den Beinamen erhielt er, weil er angeblich auf Vogeljagd war, als ihn fränkische Boten mit der Nachricht von seiner Erhebung überraschten.