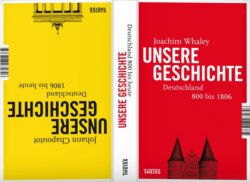Читать книгу Unsere Geschichte - Johann Chapoutot - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Was war das Heilige Römische Reich? Das Reich als politische Organisation
Оглавление„Weder heilig, noch römisch, noch ein Reich“, spottete Voltaire in seinem 1756 veröffentlichten Essai sur l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations. Viele hielten diese Charakterisierung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation für die zutreffende Beschreibung eines häufig missverstandenen Gebildes. Das Reich war, einem verbreiteten Konsens zufolge, im Jahr 800 gegründet worden. 1806 wurde es aufgelöst. Doch mit der Kaiserkrönung Karls des Großen durch den Papst war das Reich noch längst nicht voll entwickelt. Als die deutschen Könige 962 mit Otto I. die römische Kaiserwürde erlangten, war das Reich nicht heilig, geschweige denn „deutsch“. Die Kaiserwürde machte die deutschen Könige und ihre Nachfolger bis 1806 zu Monarchen ersten Ranges in Europa. Doch erst um 1500 verwendete man die Bezeichnung „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“. Bis dahin hatte die ihm zugrunde liegende politische Ordnung tief greifende Veränderungen durchgemacht.
Am Anfang hatte das fränkische Königreich gestanden, das seiner Struktur nach eine Stammesgesellschaft unter einem gewählten Führer war. Auf dieser Grundlage entwickelten die folgenden Herrscherdynastien allmählich ein voll entwickeltes Feudalsystem, das in einer Hinsicht erst mit dem Reich 1806 unterging. Fortwährend pflegten der Kaiser und die deutschen Fürsten ihre Beziehung durch Rituale wie etwa der Erneuerung von Lehnsverhältnissen. Bis ins 18. Jahrhundert hinein waren Fragen von Rang und Bevorrechtigung – wer bei wichtigen Zeremonien und anderen formellen Zusammenkünften stehen sollte oder sitzen durfte – häufig Gegenstand erbitterter Kontroversen. In diesem Sinne war das Reich kein Territorialstaat, sondern blieb ein – wie die deutschen Historiker es nannten – „Personenverbandsstaat“.
Für diesen Staatstypus war charakteristisch, dass die Fürsten und freien Städte das Recht, ihren Herrschaftsbereich zu regieren, weitgehend beibehielten. So blieb die Macht des Monarchen begrenzt, und er war eher ein Oberster Richter und militärischer Befehlshaber als ein Regent der deutschen Territorien. Allgemeine Maßnahmen konnten nur mit der Zustimmung aller in die Tat umgesetzt werden – eine Regelung, die um 1500 als grundlegendes Verfassungsprinzip die Beziehungen zwischen Kaiser und Reichstag festlegte.
Doch erlangten die Fürsten und die freien Städte niemals Souveränität, sondern blieben bis 1806 der Autorität von Kaiser und Reichsgesetzgebung untergeordnet. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts entwickelte das Reich institutionelle und gesetzliche Strukturen, die schließlich wichtiger wurden als die feudalen Beziehungen zwischen dem Kaiser und seinen Vasallen. Während der gesamten Dauer des Reichs lag die Regierung in den Händen des Monarchen, der von einer kleinen Anzahl Mitstreiter wie etwa dem Reichserzkanzler unterstützt wurde. Der institutionelle Rahmen aber, innerhalb dessen sie agierten, veränderte sich stark. Versammelten sich früher Notabeln zur Königswahl, gab es später sieben designierte Kurfürsten, und die Treffen von Adligen am Hofe wurden um 1500 zu stärker formell ausgerichteten „Hoftagen“ und später „Reichstagen“. Auch das Justizwesen veränderte sich. Im 16. Jahrhundert wurden Sondersitzungen von Adligen unter Leitung des Monarchen selbst durch zwei oberste Gerichtshöfe ersetzt: durch das Reichskammergericht in Speyer Einleitung und den Reichshofrat in Wien; beide waren mit juristisch qualifizierten Richtern ausgestattet. Nach dem 14. Jahrhundert lockerten sich die Verbindungen zwischen Papsttum und Reich, und die Reformation trug entscheidend zur weiteren Schwächung bei. De facto hat der Heilige Stuhl den Westfälischen Frieden, der schließlich den Lutheranern und reformierten Protestanten im Reich ihre Rechte sicherte, nie anerkannt. Die deutsche Reichskirche, unter Karl dem Großen ein wichtiges Instrument der Regierung, bestand im späteren 16. Jahrhundert nur noch aus einem Kern von Kaisertreuen, die hauptsächlich im Südwesten und im Rheinland zu finden waren. Von 1519 an waren die Machtbefugnisse des Monarchen formell in einer Wahlkapitulation festgelegt, die ein neu gewählter Kaiser vor der Krönung mit seiner Signatur zu bekräftigen hatte.
Im 18. Jahrhundert war die Sammlung grundlegender Gesetze von der Goldenen Bulle (1356) bis zum Westfälischen Frieden (1648) so umfangreich geworden, dass sie für mehr galt als nur für ein Äquivalent irgendeines anderen vormodernen Verfassungsregimes, denn die Deutschen verfügten über weiter gefasste und expliziter in öffentlich zugänglichen Druckwerken niedergelegte Gesetze als die Bewohner jedes anderen europäischen Gemeinwesens. Zudem hatten die Deutschen das verbriefte Recht, sich an einen höheren Gerichtshof oder gar an den Kaiser selbst zu wenden, wenn sie sich rechtlich benachteiligt fühlten. Auf diese Weise konnten sie auch gegen ihre eigenen Herrscher vorgehen.