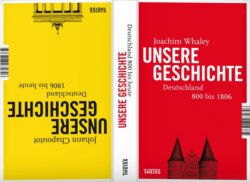Читать книгу Unsere Geschichte - Johann Chapoutot - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Reichsinsignien
ОглавлениеBis zum Ende des Reichs im Jahre 1806 wurden bei den Krönungen dieselben Insignien und Reliquien verwendet, die im Mittelalter zusammengetragen worden waren. Man kleidete den Kaiser in einen Umhang, von dem behauptet wurde, es handle sich um den Krönungsmantel Karls des Großen, doch war die Robe wahrscheinlich um 1133/34 in Sizilien aus Seide byzantinischer Herkunft gefertigt worden. Deutsche Quellen jedenfalls erwähnen das Kleidungsstück erstmals 1246. Doch ein Jahrhundert später galt es bereits als der Mantel Karls des Großen und wurde durch weitere Gewänder ergänzt, die wohl auch im 12. Jahrhundert auf Sizilien gefertigt waren, wie etwa Albe, Adlerdalmatika, Stola, Unterkleidung, Gürtel, Handschuhe und Schuhe.
Ähnliche Mythologien betrafen die Kaiserkrone, die höchstwahrscheinlich um 1024 im westlichen Rheinland gefertigt worden war, und den Reichsapfel, der bei der Krönung der staufischen Kaiser im 12. Jahrhundert Verwendung fand. Zu den Reichsinsignien gehörten auch das Zepter, das Schwert und die Heilige Lanze, in deren Spitze angeblich ein Nagel vom Kreuz Christi eingearbeitet war. Die Lanze war im 10. Jahrhundert in den Besitz der deutschen Könige gelangt. Das praktisch einzige Kleinod aus der karolingischen Zeit ist das „Krönungsevangeliar“, eine Bilderhandschrift mit silbernem Einband, die kurz vor 800 in der Palastschule zu Aachen hergestellt wurde.
Anfänglich wurden diese Reichsinsignien und -kleinodien zusammen mit diversen Reliquien wie etwa einem Splitter vom Kreuz Christi und einem Stück Stoff vom Tuch, das den Tisch beim Letzten Abendmahl deckte, von einem König dem Nachfolger persönlich überreicht. Das erforderte häufiges Reisen und die Verwahrung an unterschiedlichen Orten. Im 14. Jahrhundert begann Karl IV. damit, sie alljährlich zu präsentieren. Als Prag 1423 durch den Aufstand der Hussiten bedroht wurde, ließ Kaiser Sigismund sie von der nahe gelegenen Burg Karlstein (Karlštejn) zum Heilig-Geist-Spital in der Reichsstadt Nürnberg bringen, der er das Privileg beständiger Aufsicht über die Sammlung verlieh. Als Nürnberg 1523 protestantisch wurde, gab es keine alljährliche Zurschaustellung mehr, doch blieben die Insignien und Kleinode dort bis 1796, als französische Truppen in Franken einmarschierten. Nun wurde die Sammlung nach Wien gebracht und kehrte erst 1938, auf Befehl Hitlers, nach Nürnberg zurück. Doch 1946 fanden sie ihre Obhut in der Hofburg zu Wien, wo sie noch heute zu finden sind.
Das Reichssymbol, der Doppeladler, kennt eine ähnliche Entwicklungsgeschichte. Karls des Großen Palast in Aachen schmückte zunächst der einköpfige Adler des Römischen Reichs. Auch die Ottonen nahmen ihn als Symbol ihrer Macht; er war einer römischen Kamee eingearbeitet, die sich auf einem Kreuz befand, das Otto III. (Reg. 983–1002) dem Aachener Dom vermachte. Die Kamee war von Juwelen und Perlen aus dem Besitz der späteren Karolinger umgeben. Bis zum 14. Jahrhundert verwies der einköpfige Adler auf den Anspruch der deutschen Kaiser, Nachfolger der römischen Herrscher zu sein. Das Bild des Doppeladlers tauchte zuerst im 4. Jahrhundert in Kleinasien auf und fand zunehmend im Oströmischen (oder Byzantinischen) Reich Verwendung, bis es die Dynastie der Palaiologen im 13. Jahrhundert endgültig als Herrschaftszeichen übernahm. Auch im Heiligen Römischen Reich wurde der Doppeladler heraldisch benutzt, und ab 1433 war er, so wie Kaiser Sigismund es wollte, schwarz auf goldenem Grund das Wahrzeichen des Reichs. Zunehmend fanden die Wappen von Städten und Fürsten auf seinen Flügelfedern Platz. Ursprünglich waren sie zu zehn Gruppen à vier Wappen angeordnet (deshalb auch die Bezeichnung „Quaternionenadler“), später fanden mehr Wappen auf den Federn Platz. Der Doppeladler konnte für den Kaiser stehen (dann zierte dessen Wappen die Brust) oder für das Reich (dann trug er ein Kreuz auf der Brust). Das heraldische Tier fand im ganzen Reich Verbreitung, so z.B. in den Wappen von Reichsstädten oder den Bannern und Dokumenten von Handwerkszünften.
Der Adler, sei er nun ein- oder doppelköpfig, gehörte zu den vielen dauerhaften Identifikationsmerkmalen, in denen sich die deutschen Untertanen mit ihren Herrschern und, wie diese, mit dem politischen Gemeinwesen verbunden sahen. Im 19. und 20. Jahrhundert bestritten viele Gelehrte, dass das Reich jemals patriotische Begeisterung oder ein Bewusstsein deutscher Identität unter den Einwohnern ausgelöst habe. Im Gegensatz dazu macht dieses Buch die Identifikation des Reichs mit der deutschen Nation, die sich kontinuierlich seit dem Mittelalter entwickelte, zu einem seiner Hauptthemen. Vorangetrieben und fokussiert wurde die Bestimmung dessen, was das deutsche Reich sein sollte, auch durch die Auseinandersetzungen über die Kirchenreform, die der Reformation vorangingen. Diese Konflikte veranlassten viele Autoren dazu, die römischen Ursprünge des Reichs zu bestreiten. Stattdessen betonten sie, es sei von Anbeginn ein deutsches Reich gewesen. Doch blieb der Titel unverändert bestehen, und einige katholische Theoretiker glaubten auch weiterhin an den römischen Ursprung und ein besonderes Verhältnis zum Papsttum, doch wurde dies zunehmend in den Bereich des Mythischen verwiesen.