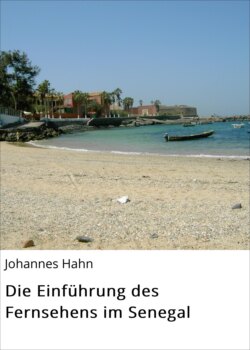Читать книгу Die Einführung des Fernsehens im Senegal - Johannes Hahn - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Modernisierungstheorie
ОглавлениеGemäß der auf Darwin zurückgehenden evolutionistischen Theorie des sozialen Wandels bewegen bzw. entwickeln sich Gesellschaften zwangsläufig in eine bestimmte Richtung. Zur Beschreibung dieses Vorgangs bedienten sich die Evolutionisten mit Vorliebe eines Phasenmodells, demzufolge Gesellschaften von einem Urzustand über eine oder mehrere Übergangsphasen in ein Endstadium gelangen - worunter nichts anderes als das England des 19. Jahrhunderts zu verstehen war.
Modernisierungstheoretiker können als Nachfahren der Evolutionisten betrachtet werden, denn auch sie verstehen Entwicklung bzw. Modernisierung als unilinearen Prozess, in dem es Pioniergesellschaften und Nachzügler gibt - nur als Endstadium sind zeitgemäß die derzeitigen politisch-ökonomischen Systeme Westeuropas und Nordamerikas fixiert.
Allerdings handelt es sich bei der Modernisierungstheorie ursprünglich um eine makrosoziologische Theorie, die der Erklärung früherer Wandlungen in heute industrialisierten Gesellschaften dienen soll. Die Kritik an der Übertragung dieser Theorie auf Entwicklungsländer richtet sich hauptsächlich gegen deren Ideologiegehalt, die recht simple Einteilung in traditionelle und moderne Gesellschaften und gegen den ethnozentristischen Blickwinkel, der die Ursachen von Unterentwicklung ausschließlich in endogenen Faktoren zu erkennen vermag. Dass auch etwas anderes als die derzeitige westliche Industriegesellschaft das Ziel der angenommenen stufenweisen Entwicklung sein könnte, wird ausgeschlossen.
Die Bedeutung von Massenkommunikation im Prozess der Modernisierung hat Daniel Lerner in seinem Buch “The Passing of Traditional Society” beleuchtet. Aufgrund einer 1950 in sechs Ländern des mittleren Ostens durchgeführten Studie erkannte Lerner das vermeintliche Hauptproblem seiner Probanden: “How to modernize traditional lifestyles, that no longer work to their own satisfaction?”6. Er unterstellt, dass moderne, westliche Lebensart der traditionellen islamischen überlegen sei und hält den Prozess der Modernisierung für unausweichlich.
Dies begründet er damit, dass überall auf der Welt die Urbanisierung zunehme - und damit automatisch die Alphabetisierung und infolgedessen der Medienkonsum, womit der Weg ins Paradies einer westlichen Gesellschaftsordnung mit höherem Einkommen und politischer Partizipation nach dem Muster westlicher Demokratien bereits geebnet sei. Belege für die zwangsläufige Entwicklung in den Phasen Urbanisierung, Alphabetisierung, Medienkonsum und politisch-ökonomische Partizipation glaubt Lerner in statistischem Material aus 32 Ländern gefunden zu haben. Seine Studie widmet sich hauptsächlich der Frage, wie eine Gesellschaft von einer Phase in die nächste gelangt - und dafür bedürfe es, so sein Ergebnis, psychischer Mobilität, die vor allem durch den Konsum von Massenmedien erlangt werde.
Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Geschehen in den Entwicklungsländern modifizierte Lerner 1977 seine Kausalkette7. Zunächst käme es, auch diesmal wieder durch Medienkonsum, zu “rising expectations”, bis diese Erwartung einer besseren Zukunft den “rising frustrations” Platz mache, um schließlich in die dritten Phase des “military takeover” zu münden.
Lerner stützt sich auf das Beispiel Ägyptens, das zur Zeit Nassers eine propagandistische Medienstrategie verfolgte. Es seien Radioempfänger in der Bevölkerung verteilt worden - die aber größtenteils von lokalen Religionsführern in Beschlag genommen wurden und die Bevölkerung nicht erreichten. Die Frage, wie das Radio trotzdem seine behauptete Wirkung erzielen konnte, bleibt unbeantwortet.
Das wohl einflussreichste Buch in der Geschichte der Entwicklungskommunikation war Wilbur Schramms “Mass Media and National Development”8. Nicht nur in der Wissenschaft der 60er Jahre galt die im Auftrag der UNESCO erstellte Studie als Standardwerk, auch die Politiker der Entwicklungsländer glaubten bereitwillig an die dort postulierte Allmacht der Medien, deren größtes Potenzial im edukativen Bereich zu finden sei. Schramm befragte Medienexperten und -politiker und hat damit vielleicht eher deren Wunschvorstellungen dokumentiert, als reale Medienwirkung zu untersuchen. Zwar steht bei Schramm die Richtung des anzustrebenden Wandels ebenso fest wie bei Lerner, aber anders als dieser erkennt er, dass nicht nur die Anzahl der Radio- und Fernsehgeräte von Bedeutung ist, sondern auch die Gestaltung der Medieninhalte. So plädiert Schramm für eine Angleichung der Medieninhalte an kulturelle Muster der jeweiligen Region und fordert eine Lokalisierung der Medien.
Trotz dieser Differenzierung zweifelt Schramm nicht an der Schlüsselrolle der Medien im Entwicklungsprozess, wenn sie eben nur “richtig” eingesetzt würden.