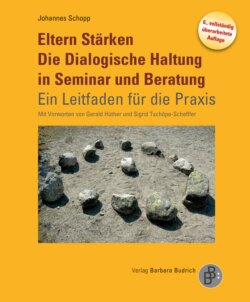Читать книгу Eltern Stärken. Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung - Johannes Schopp - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Krisenklau“
ОглавлениеAls ich den Titel „Gesund ist, wer noch krank werden kann“ in einer Aufsatzsammlung von Walther H. Lechler (1997), dem bekannten Suchttherapeuten aus Bad Herrenalb, zum ersten Mal las, fielen mir sofort die Sätze unserer Hebamme ein, die uns jungen Eltern erklärte, wie wichtig die sogenannten Kinderkrankheiten für die gesunde Entwicklung eines jeden Kindes seien. Sie würden helfen, Abwehrkräfte im Körper zu aktivieren.
Eine ähnliche Einstellung finden wir bei Janusz Korczak, der schon 1929 das bedingungslose „Recht des Kindes auf Achtung“ forderte (Korczak 2002, S. 27ff.). Damit ist u.a. gemeint, „dass Erwachsene Kindern durch ihre Ängste und (Über-) Fürsorge wesentliche Erfahrungs- und Lebensmöglichkeiten nehmen. Dem Erwachsenen wird damit zugemutet, Ängste um das Leben des Kindes und eigene Vorstellungen von dem geraden, gefahrlosen Weg in eine glückliche Zukunft des Kindes genau zu überprüfen und – falls nötig – zugunsten neuer Einstellungen zu revidieren“ (Tschöpe-Scheffler 2003a, S. 62f.). Das Beispiel der kleinen Elisabeth aus meiner Nachbarschaft veranschaulicht diesen Gedanken:
[44] Das knapp 13-monatige Mädchen macht ihre ersten Gehversuche, als sie im Garten über eine kleine Sockelkante – und offenbar vor Schreck schreiend – zu Boden fällt, ohne sich allerdings dabei zu verletzen. Der stolze Vater, ein Maurer, füllt diese kleine Stufe sofort fachmännisch mit Beton auf, im guten Glauben, sein kleines Töchterchen vor zukünftigen Gefahren schützen zu müssen. Beim ersten kleinen Sturz über eine Sockelkante im Garten wird dem Mädchen von ihrem Papa der „Stolperstein“ aus dem Weg geräumt. Ihr wird die Chance verwehrt, zukünftig an der gleichen Stelle selbst auf etwaige Unebenheiten zu achten.
Manche Eltern erfüllen ihren Kindern aus Furcht vor einem „gesunden“ Konflikt (fast) jeden Wunsch, nehmen ihnen damit aber die Chance, an einer klaren Entscheidung, die auch ein „Nein“ bedeuten kann, zu wachsen. Im guten Glauben, das Richtige zu tun, ziehen wir unsere Kinder eher aus dem reißenden Fluss, als dass wir ihnen zeigen, wie man in den entsprechenden Situationen besser schwimmt.
Walther H. Lechler sprach in diesem Zusammenhang auf einem seiner Vorträge davon, dass gerade ein solcher „Krisenklau“ dazu führe, dass die Menschen geschwächt würden. Er versuchte darzustellen, dass ihnen dadurch die Chance genommen werde, die Probleme eigenverantwortlich lösen zu können.
Der Diplompsychologe Mathias Wais hat diesen „Krisenklau“ an einem Fallbeispiel in seinem Buch: „Suchtprävention beginnt im Kindesalter“ (Wais 2002) einmal recht konkret skizziert:
„Beginnen wir [also] im Kindergarten. Der vierjährige Kevin weint jeden Morgen herzzerreißend, wenn die Mutter ihn im Kindergarten abgeben will. Er klammert sich an sie und brüllt, als ginge es auf die Schlachtbank. Die Mutter ist hin- und hergerissen, bleibt schließlich jeden Morgen noch etwas länger da, damit Kevin unter ihrem Schutz den Schritt in die neue Welt tun kann. Sie versucht, ihn in das Spiel der anderen Kinder hineinzulotsen. Sie lockt ihn zum Kaufladen, spielt selbst mit ihm. Er aber weicht nicht von ihrer Seite. Nach ein paar Wochen kommt Kevins Mutter zu dem Schluss, dass es für den Jungen zu früh sei, in den Kindergarten einzutreten. Sie meldet ihn wieder ab und will es in einem halben Jahr noch einmal versuchen. – Was hat Kevin jetzt wohl gelernt? Auf jeden Fall [45] hat er einen im Moment anstehenden Entwicklungsschritt nicht vollzogen. Die Mutter hatte ihn davor bewahrt.
In der Schule dann hat er Mühe mit der Rechtschreibung. Kevins Vater nimmt an, dass die Lehrerin, eine noch sehr junge Frau, nicht in der Lage ist, den Kindern Lesen und Schreiben richtig beizubringen. Auf dem Elternabend greift er sie an. Schließlich macht er eine Eingabe an die Schulleiterin, dann ans Schulamt. Kevin kommt in die Parallelklasse. Dort kaspert er herum und verweigert jedes Schreiben. Die Eltern bringen Kevin zu einem Kinderpsychotherapeuten. Als auch diese Maßnahme die Leistungen im Diktat nicht verbessert, wird die Therapie abgebrochen und Kevin bekommt einen Privatlehrer, der begleitend zum Unterricht in der Grundschule jeden Tag zu Kevin nach Hause kommt und mit dem Jungen Rechtschreibung übt. Das hilft. Als allerdings ein vorher nicht geübtes Diktat 32 Fehler bringt, sind die Eltern bestürzt. Kevin aber, die Ruhe selbst, sagt: „Das hat mir Herr Petersen auch nicht beigebracht“.
So geht es weiter, bei Kevin wie bei vielen anderen Kindern. Der Vater besorgt die Lehrstelle, bessert, als Kevin über das geringe Lehrgeld mault, hintenherum das Lehrgeld auf, indem er dem Lehrherrn monatlich hundert Euro für Kevin zusteckt. Als Kevin 16 ist, will er sich bei amnesty international engagieren. Aber die Eltern haben es ihm freundlich und beharrlich ausgeredet. Er sollte in seinem Alter doch noch nicht mit so schrecklichen Dingen wie politischer Verfolgung und Folter konfrontiert sein. Damit er mehr junge Leute kennen lernt und unbeschwert seine Jugend leben kann, bezahlen sie ihm immer neue Tanzkurse.
Als die Mutter wegen einer sehr schmerzhaften rheumatischen Erkrankung die Hausarbeit kaum mehr erledigen kann, bietet Kevin an, Putzen und Abwasch zu übernehmen. Die Eltern wollen das aber nicht, er soll seine Freizeit genießen. Sie stellen eine Haushaltshilfe ein.
Konflikte und Probleme – innerfamiliäre wie auch außerfamiliäre – werden von Anfang an und noch, bis er fast 17 ist, von Kevin ferngehalten. Er soll eine unbeschwerte Kindheit haben und Schule und Ausbildung sind ja Belastung genug. Mit 16 klaut Kevin ein Moped – er hat selbst zwei – und verkauft es an einen Freund. Der Vater weigert sich, dem Besitzer Ersatz zu leisten, weil der das Moped ja ungesichert abgestellt habe.
Anderen Kindern und Jugendlichen wird nicht nur alles, was nach Belastung aussieht, abgenommen und die Verantwortung entzogen für ihr eigenes Tun und Streben, sondern sie sind auch noch ständigen Ermahnungen und Warnungen [46] ausgesetzt, deren Grundtenor ist: Die Welt ist gefährlich (böse, undurchschaubar, voller Versuchungen), deshalb halte dich von ihr fern“ (Wais 2002, S. 19ff.).
Es ist gewiss nicht einfach, einen Menschen, den man liebt, Fehler machen zu sehen, wenn man ihm eigentlich nur helfen will, mit einem bestimmten Lebenskonflikt fertig zu werden. Das Beispiel zeigt einmal mehr, dass gerade dieses Helfen-Wollen um jeden Preis das Gegenteil des erhofften Erfolgs bringen kann. Zahlreiche Eltern plagen sich in diesem Zusammenhang häufig mit Entscheidungen, die der Alltag ihnen abverlangt, wie:
„Sollen wir gegenüber unseren Kindern Verbote zum Umgang mit für ‚schlecht’ gehaltenen Freunden aussprechen?“
„Soll ich meine Tochter täglich früh aus dem Bett und zur Schule treiben, obwohl sie schon alt genug ist, alleine aufzustehen?“
„Hat es Zweck, die Kinder immer wieder in der Schule „heraus zu pauken“, wenn sie ,Mist gebaut’ haben?“
„Hat es einen Sinn, mit „Stubenarrest“ zu verhindern, dass der Sohn auf eine Fete geht, weil dort vermutlich Alkohol getrunken wird?“
„Ist es richtig, das Taschengeld zu erhöhen, wenn es permanent nicht reicht?“
„Was mache ich, wenn ich merke, dass mein Kind heimlich raucht oder Alkohol trinkt?“
„Ich komme nicht mehr an meine Tochter heran, was soll ich machen?“
Viele Eltern erwarten auf diese Fragen gar nicht unbedingt immer eine Antwort. Die Frage nach dem „Wozu?“ („Was glauben Sie, hat Ihr Kind davon, dass es sich so oder so gebärdet?“ o.ä.), bringt in vielen Fällen Erleichterung. Meistens tut es den Eltern schon gut, einfach mit anderen Eltern über ihre Entscheidungszweifel zu reden und Gehör zu finden.
„Eine Krise kann einen Menschen durchlässig machen.“
Wilfried Reifarth Antonovsky benutzt in diesem Zusammenhang wieder die Metapher des Flusses als Abbild des Lebens und verbindet damit die Vorstellung, dass wir Menschen alle in verschiedenen Flüssen mit Strömungen, Strudeln oder anderen Gefahrenquellen schwimmen. Für ihn gehört zum Leben nicht nur unvermeidlich, sondern notwendigerweise ein Ungleichgewicht, d.h. Herausforderungen, an denen wir Menschen unsere Stärken stärken können.
[47] „Meine fundamentale philosophische Annahme ist“, sagt er, „dass der Fluss der Strom des Lebens ist. Niemand geht sicher am Ufer entlang. Darüber hinaus ist für mich klar, dass ein Großteil des Flusses sowohl im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn verschmutzt ist. Es gibt Gabelungen im Fluss, die zu leichten Strömungen oder in gefährliche Stromschnellen und Strudel führen. Meine Arbeit ist der Auseinandersetzung mit folgender Frage gewidmet: ,Wie wird man, wo immer man sich in dem Fluss befindet, dessen Natur von historischen, soziokulturellen und physikalischen Umweltbedingungen bestimmt wird, ein guter ,Schwimmer’?“ (Antonovsky 1997, S. 92).
Für diejenigen Menschen, denen der Boden unter den Füßen zu schwinden scheint, deren Kinder beispielsweise bei Diebestouren oder bei nächtlichen Graffittiausflügen erwischt werden oder in die Drogenszene abzurutschen drohen oder magersüchtig werden, ist Antonovskys These vom notwendigen Ungleichgewicht nicht unbedingt leicht nachvollziehbar. Sie wollen am liebsten jetzt und sofort von einem „Rettungsboot“ aufgenommen werden und nicht erst langwierig „schwimmen“ lernen bzw. es ihren Kindern beibringen müssen. Doch auch in weit weniger brisanten Lebensabschnitten können sich die sogenannten „Kleinigkeiten“ in der Summe zu Bergen auftürmen. Veränderungen in Ehe und Partnerschaft, Veränderungen mit der Geburt des ersten Kindes, Veränderungen im Beruf, in der Pubertät der Kinder etc., mit anderen Worten der ganz normale Alltag wird jedoch je nach Grundhaltung und momentaner Lebenssituation der Einzelnen als Belastung oder als Herausforderung wahrgenommen.
„Lernen heißt Neugier wecken, über sich selbst und andere mehr zu erfahren.“
J. Brown Die meisten Besucher der Elterndialoge empfinden es allerdings als tröstlich und entlastend, durch die offene und wertschätzende Atmosphäre angesteckt, zu erfahren, dass das Störende, Auffällige, das Belastende und das Kranke genauso zum Leben gehören wie das ersehnte Gute, Funktionierende und Gelingende. Wichtig ist es, zu verstehen, dass alles im Leben diese zwei Seiten hat, eine Licht- und eine Schattenseite, dass zu allem immer auch sein Gegenteil gehört. Wir können im Leben nicht alles „richtig“ machen. Eltern und Kinder müssen ständig Entscheidungen treffen. Dabei werden Fehler gemacht. Stärke heißt, auch schwach sein zu dürfen.
[48] Diese Erkenntnis selbst hilft zwar weder, die empfundenen Probleme zu beseitigen bzw. Fragen zu beantworten, noch den Einzelnen ihre konkrete Angst zu nehmen, sie macht aber Mut zum offenen wahrhaftigen Dialog.
„Lernen bedeutet‚ ,Wissen’ mit anderen zu teilen.“
Peter Senge Die Balance im Leben finden wir in der Konfrontation zwischen äußeren Anforderungen und inneren Ressourcen. Wir wachsen an der aktiven Auseinandersetzung mit den uns gestellten „Aufgaben“. Um im Bild des Flusses zu bleiben: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminare werden dabei begleitet, selbst gute „Schwimmer“ bzw. gute „Schwimmlehrer“ ihrer Kinder zu werden, mit anderen Worten, den Kopf über Wasser zu halten.
„Ich glaube, gesund bedeutet nicht den Gegensatz zu körperlich krank, zu körperlichem Defektsein – gesund bedeutet: Ich bin glücklich! ,Gesund’ ist ein gleichbedeutender Ausdruck für ,glücklich’, ein Synonym für ,glücklich’. ,Glücklich’ bedeutet nicht, dass ich keine Sorgen mehr habe, keine Probleme, keine Konflikte, keine Spannungen, keine Auseinandersetzungen, dass ich keine Katastrophen mehr durchleben muss, dass alles nur eitel Freude wäre, sondern dass ich trotz Konflikten, trotz Problemen, trotz Katastrophen in der Lage bin, es mit dem Leben aufzunehmen. Dass ich gelernt habe, es gibt immer Wege der Hilfe, immer wieder Möglichkeiten, es zu schaffen, auch wenn ich zunächst einmal sehen und zugeben muss, dass ich mit ,meinen’ Möglichkeiten am Ende bin.“
Walther H. Lechler