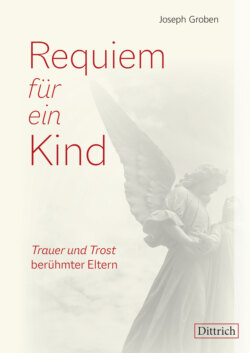Читать книгу Requiem für ein Kind - Joseph Groben - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie brisante theologische Diskussion über das Los der ungetauften Kinder zog sich jahrhundertelang bis 2005 hin, als Papst Benedikt XVI. eine Kommission von Theologen einsetzte, die zur Auffassung gelangten, dass »die Seelen nicht getaufter, gestorbener kleiner Kinder direkt ins Paradies kämen« (2007).
Im Mittelalter führte die seelische Not der Eltern zu mehreren Auswegen oder »Ersatzlösungen«, die eher der populären Religiosität als der amtlichen Lehre der Kirche entsprachen. So fand man bei vielen archäologischen Grabungen in unmittelbarer Nähe der mittelalterlichen Kirchen Gräber von Tot- und Frühgeborenen, die man in der einschlägigen Literatur als »Traufkinder / Traufenkinder« bezeichnet. Diese ungetauften Kinder wurden von ihren unglücklichen Eltern oder Angehörigen möglichst nahe an den Kirchenmauern und beim Chor bestattet, in der Hoffnung oder im festen Glauben, dass das Regenwasser, das von der Traufe am Dach der Kirche herunterrann, bei ihnen im Laufe der Jahre die Taufe ersetzen könne. Das immer wieder herabtropfende oder fließende Wasser sollte eine Art »Nottaufe« darstellen.
Noch seltsamer und befremdlicher wirkt heute das hochmittelalterliche und frühneuzeitliche Phänomen der »Auferweckungsheiligtümer« (»sanctuaires à répit«), die sich besonders in Süddeutschland, Frankreich, der Schweiz und Belgien hundertfach entwickelten; eine »markante Erscheinung des christlichen Europas«, »un fait religieux et culturel majeur de l’Europe chrétienne«, wie Jacques Gélis 2006 urteilt. Diese Praxis erscheint zuerst im 12. Jahrhundert. Ab dem 14. Jahrhundert machten sich unzählige Eltern mit ihrem totgeborenen Kind auf den Weg zu einem Marienheiligtum in ihrer Nähe, wo sie den kleinen Leichnam vor einem Marienbild ausstellten in Erwartung eines »Wunders«, das heißt, eines Lebenszeichens. Um den Leichnam herum stellte man Kerzen auf und versuchte auch bisweilen mittels glühender Kohlen das Kind aufzuwärmen. Auf den Mund des Kindes legte man eine leichte Feder. Wenn diese sich bewegte, glaubte man, dass der Atem wieder einsetze, oder wenn die Wangen sich leicht röteten, wurde auch das als Lebenszeichen gedeutet, und das Kind wurde sofort getauft. Nachher verfiel es dann endgültig in den Todesschlaf, und die Eltern begruben es auch oft um das Heiligtum herum.
Bei archäologischen Ausgrabungen in den letzten Jahrzehnten fand man überall Hunderte von Kinderskeletten. Das meistbesuchte Heiligtum der frühen Neuzeit war das Kloster Ursberg in Süddeutschland. Die Zahl der dort getauften totgeborenen Kinder wird auf 24 000 geschätzt. Das Marienheiligtum von Oberbüren in der Westschweiz wurde 1992–1997 von Spezialisten exemplarisch untersucht, und die akribischen Ergebnisse der Ausgrabungen, die 247 Kinderskelette zutage förderten, in einer umfassenden Publikation 2018 zugänglich gemacht.
Ein gut erhaltenes Architektur-Zeugnis der populären Wiedererweckungspraxis stellt das Marienheiligtum im idyllisch gelegenen Wallfahrtsort Avioth in der altluxemburgischen Grafschaft Chiny dar. Auch hier wurde die Muttergottes als »Notre-Dame de Consolation« jahrhundertelang von den unglücklichen Eltern angefleht, ihren Kindern für eine kurze Zeit das Leben wiederzuschenken. Der Glaube an diese wundertätige Vermittlung Marias ließ im 13. und 14. Jahrhundert eine prachtvolle gotische Kirche erstehen, ein wahres Juwel der mittelalterlichen Architektur, mit einer einmaligen »Recevresse«. Hier konnten die dankbaren Eltern ihre Gaben niederlegen, indem sie gewöhnlich das Gewicht des Kindes in Korn oder Wachs aufwogen. Von weit und breit strömte man mehrere Jahrhunderte lang zur »Notre-Dame de la Consolation«. In einem Register wurden alle Wunder schriftlich festgehalten, u.a. vom Chronisten Jean Delhôtel, der zwischen 1625 und 1673 genau 135 »Wunder« gewissenhaft registrierte.
Die letzten »wunderbaren« Nottaufen in Avioth fanden kurz vor der Französischen Revolution statt, bis der aufgeklärte Weihbischof von Trier Johann Nikolaus Hontheim, der als »Febronius« in die Kirchengeschichte eingegangen ist, 1786 die Wallfahrten und die Taufen unter Strafe verbot. Die Haltung der katholischen Kirche zu den Wundertaufen, die für die Heiligtümer immer lukrativ waren, blieb lange Zeit ambivalent. Einige religiöse Orden und der lokale Klerus bedienten sich nur allzu gerne des reichlichen Segens der »Aufschubwunder«. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts, unter Papst Benedikt XVI., änderte sich die offizielle Haltung der katholischen Kirche gegenüber den ungetauften Kindern – und auch gegenüber der seelischen Not der trauernden Eltern. »Ungetaufte Kinder dürfen ins Paradies«, titulierte etwas reißerisch am 22. April 2007 die angesehene deutsche Tageszeitung »Die Welt«.