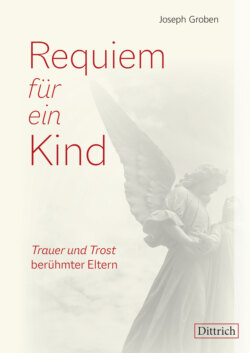Читать книгу Requiem für ein Kind - Joseph Groben - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kunst und Kindertod
ОглавлениеTieferen Einblick in das fremde Leid gewinnen die meisten Menschen heutzutage durch die Kunst, wenn ein Dichter, ein Maler, ein Bildhauer oder ein Musiker seinem persönlichen Schmerz einen öffentlichen Ausdruck verleiht oder das Kindersterben zum Thema wählt. Kein Leser der Buddenbrooks (1900) vergisst das unheimlich jähe Sterben des kleinen Hanno, mit dem Thomas Manns »Verfall einer Familie« abrupt endet; kein Leser des Romans »La peste« (1947) von Albert Camus kann die schreckliche Szene vergessen, als der Arzt Rieux ohnmächtig und empört der Agonie eines Kindes zusehen muss. Das Wiedersehen der Eltern in Athen, am Sterbe- und Todesbett ihrer Tochter Sabeth in Frischs Roman »Homo faber« (1959) ist von aufwühlender Tragik, trotz der unterkühlten Ausdrucksweise des Technikers Walter Faber. Anspruchsvolle Romane erreichen allerdings nur eine Elite von Lesern.
Dass aber auch eine breite Schicht der Bevölkerung für das tragische Thema empfänglich ist und davon unmittelbar ergriffen werden kann, davon zeugt exemplarisch der große Publikumserfolg des Filmes von Nanni Moretti »La stanza del figlio« (2001). »Das Zimmer des Sohnes« ist die Geschichte einer glücklichen Familie, die durch den jähen Verlust des 16-jährigen Sohnes Andrea zutiefst erschüttert wird und verzweifelt nach Trost und neuem Gleichgewicht sucht. Einzelne Szenen, wie die drastische Einsargung des Sohnes, der elementare Schmerzensausbruch des Vaters in der vergitterten Gondel des Lunaparks prägen sich unbarmherzig jedem Gedächtnis ein. Nach dem Urteil der Fachpresse hat der Film »ganz Italien zu Tränen gerührt«; er wurde dreifach mit dem »David de Donatello«, einer italienischen »Oscar« oder »Cäsar«-Variante, ausgezeichnet. Bei ihrer Vorführung auf dem Filmfestival von Cannes, am 17. Mai 2001, hinterließ die Familientragödie bei den Jury-Mitgliedern »Verunsicherung, Verwirrung, Verstörung«. Drei Tage später wurde »La stanza del figlio« mit der »Goldenen Palme« einstimmig – was äußerst selten ist – als bester Film des Festivals preisgekrönt.
Einige der hier dargelegten Fälle haben in jüngster Zeit durch Bühnenwerke das Interesse eines breiten Publikums wieder erregt. So wurden François Husters Schauspiele »Putzi« (1991) und »Mahler« (2000), die den Verlust der Tochter ergreifend thematisieren, mit großem Erfolg in Paris und verschiedenen Provinzstädten aufgeführt. In Wien geriet der Selbstmord von Lili Schnitzler und Franz von Hofmannsthal wieder in die öffentliche Diskussion dank des Salonstücks »Späte Worte« (2000) der österreichischen Autorin Michaela Ronzoni. Andre Link beschwört in seinem Monologdrama »Mein Flügel und ich, wir waren eins« (2001) die tragische Existenz Clara Schumanns, die hin- und hergerissen zwischen ihrer Künstlerkarriere und ihrer Mutterrolle, den Verlust von fünf Kindern beklagen musste. Der Selbstmord des Kronprinzen Rudolf hat nie aufgehört, die Gemüter zu beschäftigen, wie zahlreiche Darstellungen beweisen, von den populären Sissy-Filmfolgen bis zum Musical »Elisabeth«, in denen die Tragödie von Mayerling den tränenreichen Schwerpunkt bildet.
Viele erschütternde Kunstwerke spiegeln die Tragödien wider, die das Lebensgefühl der betroffenen Künstler beim Schaffensprozess geprägt haben. Die zahlreichen Trauermusiken, Totenmessen, Elegien, Nänien und Lamentos der Musikliteratur sind nicht selten das Ergebnis persönlicher Verluste, Zeugnisse echter Trauer. Michael Haydn, Bedrich Smetana, Franz Liszt, Antonin Dvorak, Leos Janacek, Jan Sibelius und zahlreiche andere Musiker haben ihren verstorbenen Kindern ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Zu den jüngsten Zeugnissen gehören auch das berühmte Lied »Tears in Heaven«, das der britische Songwriter Eric Clapton komponierte, nachdem sein Sohn Conor 1991 in New York aus dem Fenster eines 53. Stockwerks gefallen war, und das »therapeutische« Album »Skeleton Tree«, in dem der australische Musiker Nick Cave den tödlichen Sturz seines 15-Jährigen Sohnes Arthur von einer Klippe bei Brighton beschwört.
Jan Kochanowski, Joseph von Eichendorff, Friedrich Rückert, Stefan Andres, Victor Hugo, Léopold Senghor u.a.m. haben ganze Gedichtzyklen dem Andenken ihrer verstorbenen Kinder gewidmet. Die künstlerische Arbeit, das Ringen um den angemessenen Ausdruck, zwang zu einem gewissen Abstand und half den Schmerz zu dämpfen.
Für manche Künstler wird die »Monumentalisierung« des Gedenkens zu einer Art Lebensaufgabe. Cicero beabsichtigte, dem Andenken seiner Tochter Tullia einen öffentlichen Tempel zu errichten. Klemens von Metternich errichtete in Böhmen ein imposantes Mausoleum für seine früh verstorbenen Töchter Clementine und Marie. Käthe Kollwitz arbeitete fast zwanzig Jahre am Denkmal für ihren Sohn Peter, der 1914 als Freiwilliger in den Krieg gezogen war und zu den ersten Gefallenen zählte.
Wie besonders aus den letzten Beispielen ersichtlich, wird der Begriff »Kind« hier in seinem weiten Sinne aufgefasst. Auch erwachsene Söhne und Töchter bleiben die »Kinder« der Eltern, besonders wenn diese sie überleben. Und der Verlust eines Jugendlichen oder Erwachsenen ist für die Eltern gewiss schmerzlicher als der Tod eines Kleinkindes. Jahrelang haben sie einen festen Platz im Leben und im Herzen der Eltern eingenommen; wenn sie herausgerissen werden, zerbricht ein ganzer Lebensabschnitt voll gemeinsamer Erlebnisse, Erinnerungen und liebgewonnener Gewohnheiten. Der emotionale Verlust einer vertrauten entfalteten Person ist größer als jener einer nur knospenhaften Existenz ohne Individualität. Bei älteren Kindern ist der Tod auch deswegen oft tragischer, weil die Hinterbliebenen damit jegliche Hoffnung auf Nachkommenschaft begraben müssen. In mehr als einem Fall stirbt damit der »Stamm« aus: Hector Berlioz, Modest Grétry, Michael Haydn, Alphonse Lamartine, Giuseppe Verdi, Leopold II., Walter Gropius, Mascha Kaléko, Else Lasker-Schüler André Malraux, Romy Schneider u.a.m. starben einsam und »verwaist«.