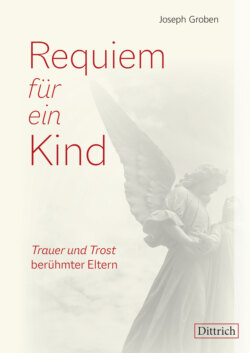Читать книгу Requiem für ein Kind - Joseph Groben - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Kindertod als persönliche Tragik
ОглавлениеSeitdem die Fortschritte von Hygiene und Medizin dem Kindersterben weitgehend Einhalt geboten haben, ist auch die Geburtenrate entsprechend zurückgegangen. Das Einzelleben hat dadurch eine nie dagewesene Aufwertung erfahren. Seit der Entwicklung der romantischen Gefühlskultur misst man jedem einzelnen Kind eine unverwechselbare und unersetzliche Bedeutung zu. Mit der Abnahme der Sterbefälle wächst zugleich ihre Tragik. Was einst »sors communis« war, ein Schicksal, das man mit fast allen Familien teilte, wird jetzt zum tragischen, schicksalhaften Ausnahmefall, der von den Betroffenen doppelt schmerzlich empfunden wird. »Das Unglück geschah auch mir allein«, klagt Rückert in einem seiner 446 »Kindertotenlieder«. Stefan Andres schreibt: »In den ersten Tagen und Wochen, da kam es mir so vor, als ob noch nie Eltern ein Kind hätten begraben müssen.« Der Verlust kann zum Trauma werden, der den Rest der Existenz überschattet und verdüstert. Jetzt gilt zusehends der berühmte Vers Lamartines: »Ein einziges Wesen fehlt, und alles ist wie ausgestorben.«
Kindergräber von 1581
In der modernen Kleinfamilie spitzt sich die Krise tragisch zu. Der Tod des einzigen Kindes führt zur Identitätskrise und zum Verlust des Lebenssinns. Plötzlich ist alles vorbei. Mit dem Kinde stirbt nicht nur die Zukunft des Kindes, sondern auch gewissermaßen die »Unsterblichkeit« der Eltern, deren Angst vor dem Tod jetzt panisch aufbricht. Häufige Begleiterscheinungen sind Dauerstress, Depressionen, Misstrauen, Hypochondrie, Wirklichkeitsverlust oder Wirklichkeitsflucht (Drogen Alkohol, Spiritismus), höhere Anfälligkeit für Krankheiten und Unfälle, Selbstmorde.
Sehr oft kommen Schuldgefühle hinzu, Selbstvorwürfe, falsch gehandelt, etwas Wichtiges unterlassen zu haben. Cicero bekennt sein »summa mea culpa«, Grétry verdammt seinen Künstlerehrgeiz, den er für den Verlust seiner drei Töchter verantwortlich macht, Dostojewski macht sich schreckliche Vorwürfe. Mallarme verflucht sein »Blut«, das seinem Sohn den Tod gebracht hat, Tagore klagt sich an wegen der Kinderheiraten. Nicht selten bedauern Eltern lebhaft, dass sie nicht anstelle ihrer Kinder gestorben sind. Schuldzuweisungen an den Ehepartner sind nicht selten, sodass es oft zur Entfremdung oder Trennung der Eltern kommt. Nach dem plötzlichen Tod seiner beiden Söhne – der eine war aus dem Fenster gestürzt – trennte sich Saint-Saëns von seiner Frau. Die Änderung der Wohnung gehört zu den häufigen Abwehrreaktionen der trauernden Eltern. Die Last der Erinnerung an quälende Einzelheiten, die sich in diesen Wänden abgespielt haben, wird auf die Dauer unerträglich und verhindert jeden Abstand zum Verlust. So empfanden es Dickens, Dvorak, Mahler, Metternich, Marx, Verdi und viele andere mehr.
Paradox erscheint, dass auch einzelne Betroffene, wie Victor Hugo und Alma Mahler, die traumatische Leere des Verlustes durch verstärkte sexuelle Kontakte und »erotisch-lüsterne Impulshandlungen mit Zwangscharakter« (G. Raimbault), bewusst oder unbewusst, zu überwinden trachteten.
Die Flucht in die Arbeit gehört zu den typischsten Versuchen, den Alptraum zu bannen. Cicero schuf fast sein ganzes philosophisches Werk nach dem Verlust der Tochter Tullia. Nach dem plötzlichen Tod seines einzigen Sohnes stürzte sich Goethe in sehr anstrengende Studien und vermeinte so, den Schmerz gewaltsam zu unterdrücken. Ein lebensgefährdender Blutsturz war die Folge. Ähnlich reagierte Pasteur nach dem Tod seiner Tochter Cécile. In aufreibender Forschungsarbeit glaubte er, »die einzige Ablenkung von so großen Schmerzen« zu finden.
Nicht selten bewirkt der Tod eines Kindes eine schockartige Reaktion. Hugo von Hofmannsthal starb am Begräbnistag seines Sohnes. Nach dem wechselvollen Überlebenskampf und dem Tod seiner Lieblingstochter verlor Charles Darwin endgültig den religiösen Glauben und entwickelte seine Lehre vom »Struggle for life«. Die Erschütterung über den frühen Tod seiner beiden Kinder Blandine und Daniel trug entscheidend dazu bei, dass Liszt zum »sündigen Büßer« wurde, sich 1865 in Rom zum Abbé weihen ließ und fortan vorwiegend verinnerlichte geistliche Musik schuf. Der Tod des Thronnachfolgers wurde zum »Desaster« für den belgischen König Leopold II., der in einer rastlosen und megalomanen Tätigkeit eine »Kompensation« für seinen Kummer suchte. Die private Kolonisierung des Congo wurde »zum einzig würdigen Memorial für seinen im Alter von neun Jahren verschiedenen Sohn.« (Patrick Roegier)
Für die Frauen bieten sich die Abwehr- und Fluchtstrategien selten im gleichen Ausmaß dar. Da ihre Bindung an das Kind biologisch-emotionaler, fast viszeraler Natur ist, empfinden sie die gewaltsame Trennung auch entsprechend schmerzlicher. »Was dem Vater bis an die Knie geht, geht der Mutter bis ans Herz«, lautet ein altes Sprichwort. Margarete Mitscherlich drückt denselben Sachverhalt in der Sprache unserer Zeit aus: »Mit dem Verlust eines Kindes tragen Mütter … einen Teil ihres Selbst zu Grabe, erleiden einen empfindlichen Wertverlust, der einer seelischen Amputation gleichkommt. Im schlimmsten Fall wird Trauer zur Trauerfalle, zum monotonen Kreisen um die Trauer, zum Gefangensein im totalen Selbstverlust.«
Immerhin, manche Mütter haben versucht, den Schlag aktiv zu bewältigen, nicht nur Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz, Mascha Kaléko und Else Lasker-Schüler, sondern auch »ungeniale« Ehefrauen wie Dorothee Andres, Anna Dostojewski, Alma Mahler und Luise Rückert haben in ergreifenden Darstellungen ihre Trauerarbeit dokumentiert. Bettina von Brentano wurde nach dem Tod ihres Sohnes Kühnemund, der 1835 bei einem Bad in der Spree umkam, zum »Anwalt der Armen und Unglücklichen, der Unterdrückten und Verfolgten«. Die »Schlüsselerfahrung« des eigenen Leides ließ sie »herzzerreißend … auch das schwere Leid der anderen« mitfühlen (Brief an den König von Preußen, 1846).