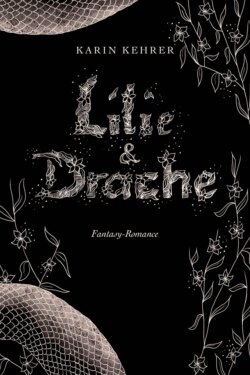Читать книгу Lilie und Drache - Karin Kehrer - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PROLOG
ОглавлениеThe night is darkening round me,
The wild winds coldly blow;
But a tyrant spell has bound me
And I cannot, cannot go.
(„Song“, Emily Brontë)
Dunkelheit ist mehr als die Abwesenheit von Licht. Ein schlichter Geist mag davon überzeugt sein, dass auf jede Nacht ein Tag folgt, die Finsternis dem Licht weichen muss, dass dies ein Gesetz der Natur ist. Aber es gibt eine Dunkelheit, die alles besiegt, die den Anbruch eines neuen Morgens nicht zulässt.
Finsternis überall … die Schwarze … das Ende …
Rynwed de Gordaw schrak hoch. Er blinzelte, starrte auf seine Hände. Die Feder war ihm entglitten, lag auf der Platte des Tisches. Er betrachtete das von vielen Messern zerfurchte Holz, als sähe er es zum ersten Mal.
Hatte er geschlafen? Das durfte er nicht. Er musste seine Aufgabe zu Ende bringen.
Welche Aufgabe?
Er war müde, so unendlich müde. Mit einem tiefen Seufzer hob er den Kopf, lauschte in die Dunkelheit.
Stille. So allumfassend, dass er vermeinte, ein erstickendes Tuch hülle ihn ein. Kein Klagen der Nachtvögel, kein Tapsen von heimlichen Pfoten, die über den Steinboden huschten. Nicht einmal das Wispern des Windes war zu hören. Nur Schatten lagerten in den verborgenen Winkeln dieses ärmlichen Gemachs, das zu seiner letzten Zufluchtsstätte geworden war. Die Kerze spendete kaum Licht und er wollte seine Gabe nicht darauf verschwenden, sie heller leuchten zu lassen.
Er beobachtete sie, diese Schatten, schon seit er die Kerze entzündet hatte, aber sie lebten nicht, waren keine Abgesandten der Schwarzen. Nur die Abwesenheit von Licht.
Er runzelte die Stirn. Welcher Gedanke war ihm durch den Kopf gegangen, bevor die Erschöpfung ihn übermannt hatte?
Die Worte des Obersten Wächters des Lichts, Arcsardar Evlan de Gordaw, seines großen Vorfahren, der voraussah, was auf sein Volk zukommen würde. Ahnungen, kaum zu begreifen. Die Wirklichkeit sollte so viel schrecklicher werden als jede Vision zeigen konnte.
Falschheit. Verrat. Lüge. Vergebliche Opfer. Tod.
Warum war er so dumm gewesen und hatte den Einflüsterungen seiner Feindin vertraut? Er hätte es besser wissen müssen.
Ließ er sich nur deshalb von ihr täuschen, weil SIE einst eine von ihnen gewesen war? Eine Wächterin des Lichts, dazu bestimmt, den Menschen Hilfe und Heilung zu bringen? Hatte er geglaubt, er könne noch einen Funken Anstand in ihr entfachen, eine barmherzige Regung? Nun, seine Gutgläubigkeit hatte ihn genarrt.
Er war vor fünf Sonnenuntergängen von Colheldon, seiner heimatlichen Festung, aufgebrochen. War das tatsächlich noch nicht länger her? Inzwischen hatte er einen Blick in die finstersten Abgründe getan, hatte tiefste Hoffnungslosigkeit und Demütigung erfahren. Dass er seiner schlimmsten Feindin entkommen konnte, war kaum als Glücksfall zu bezeichnen. Oder hatte SIE es genau so gewollt? Nur, um ihn zu verhöhnen und ihn als Verlierer zurückkehren zu lassen?
Diesen Gefallen würde er ihr nicht tun. Er würde seine Heimat nie wieder betreten. Aber SIE wusste bestimmt nicht, dass er einen letzten Ausweg gefunden hatte, denn sonst hätte SIE ihn ebenfalls sofort getötet.
Rynwed presste die Hände an seine Schläfen, wie um den abschweifenden Gedanken Einhalt zu gebieten. Den Schmerz, der in ihm aufwallen wollte, drängte er mit aller Macht zurück.
Er strich das Pergament vor ihm glatt. Seine Arbeit war noch nicht getan. Langsam setzte er die Feder auf, schloss die Augen und sammelte sich. Ah, wie war er doch schwach geworden! Die Kraft, die sich in seinen Adern ausbreitete, war nur mehr ein kläglicher Rest seiner Gabe.
Seine Lippen bewegten sich lautlos, während seine Hand die magischen Worte auf das Pergament setzte. Hell leuchtende Buchstaben flossen aus der Feder, senkten sich nieder und wurden aufgesogen.
Für eine Weile nahm er die Umgebung nicht mehr wahr, richtete sein ganzes Augenmerk auf die Botschaft, die in fernen Zeiten Erlösung bringen sollte. Sein größtes Opfer, alles was ihm noch geblieben war, so wie es der Einzige und Große Heldon, Bewahrer des Lichts, ihm geboten hatte.
Die Kerze war bis auf eine Fingerbreite herabgebrannt, als er das letzte Wort schrieb. Er legte die Feder zur Seite, saß einfach nur da und fixierte das Pergament. Nichts deutete darauf hin, dass es eine geheime Botschaft enthielt, sie würde sich nur demjenigen offenbaren, der dazu bestimmt war.
Ein bitteres Lächeln huschte über seine Züge. Ein letzter, erbärmlicher Versuch, sein Volk zu retten. Ein Versuch, der mehr als waghalsig war, denn so vieles konnte ihn zunichtemachen.
Wieder lauschte er in die Dunkelheit. Die Diener der Schwarzen hatten ihn noch nicht aufgespürt, aber das war nur eine Frage der Zeit. Er konnte ihnen nicht mehr entwischen. Sie würden schnell herausfinden, wo er sich aufhielt, seine Gabe verriet ihn, auch wenn sie schon so schwach war. Das Turmzimmer der Ruine von Martok, in die er sich geflüchtet hatte, konnte ihrer Witterung nicht entgehen, aber er brauchte diesen Ort, weit genug entfernt von jeder menschlichen Regung, um seine Kraft ungestört fließen lassen zu können. Wenn die Diener seiner Feindin ihn aufstöberten, würde nichts mehr als ein kläglicher Funke in ihm sein.
Er hielt inne, als die Kerze leicht flackerte. Krochen sie bereits witternd und suchend durch die Dunkelheit? Leichte Panik überschwemmte ihn. Es war zu früh, er hatte sein Werk noch nicht vollendet.
Nein, er spürte nichts von der Anwesenheit der giftigen Schatten, die alles Lebendige überfielen und aussaugten. Ein Schicksal, das auch ihm bestimmt war, so gewiss, wie die Dunkelheit sein Volk ausgelöscht hatte. Nur die Finsternis, die das spärliche Licht nicht vertreiben konnte, sah durch die Fensteröffnung zu ihm herein. In der Ferne blinkten ein paar Sterne am Himmel. Viel zu wenige und zu weit weg, um Trost zu spenden. Eine mondlose, stille Nacht, wie geschaffen für sein Vorhaben – und seinen Tod.
Rynwed schüttelte unwirsch den Kopf. Er durfte seine verbliebene Zeit nicht mit unnützen Gedanken vergeuden.
Er tastete nach dem Leinenbeutel, den er über die Lehne des Stuhls gehängt hatte und der seine wenigen Habseligkeiten enthielt. Behutsam nahm er die hölzerne Schatulle heraus. Ein Geschenk seines jüngeren Sohnes, ein Relikt aus einer vergangenen, glücklicheren Zeit. Er schloss kurz die Augen und sog tief den Duft des Holzes ein. Erinnerungen stiegen in ihm auf und er musste schlucken, um die Tränen zu unterdrücken. Seine Gemahlin, seine beiden Söhne, die weiten Wälder von Sardaryon, der Geruch der mächtigen Nadelbäume, eingefangen in diesem geschnitzten Kästchen.
Und doch, wie wenige schöne Tage hatte es für sie alle gegeben! Das Böse war übermächtig geworden, hatte ihr Leben in jedem Augenblick bedroht. Nun gab es keine Wächter des Lichts mehr, bis auf ihn und seinen ältesten Sohn. Ein Knabe noch, viel zu jung, um diese große Bürde zu tragen.
Er verschloss seine Gedanken, um sie nicht auf das Kommende zu richten. Es war sinnlos. Warum sollte er sich damit quälen? Er konnte es nicht ändern und es war bestimmt besser, nichts darüber zu wissen.
Sanft strichen seine Finger über den Deckel. Das Wappen der de Gordaws war darauf eingeprägt, die Lilie und der Drache, der die kostbare Blume, Sinnbild des Lichts, schützend umschlang. So viele Äonen vergeudet in Kampf und Krieg! So viele sinnlose Tode! Und am Ende sein eigener.
Ein leises Rascheln ließ ihn zusammenzucken. Er starrte auf das Fenster. Hatte sich der Schatten, der dort lagerte, nicht gerade bewegt? Er saß wie gelähmt, lauschte.
Nein, da war nichts. Noch nicht.
Er öffnete die Schatulle, rollte das Pergament zusammen, drückte es in das Kästchen und klappte den Deckel zu. Er legte seine Hände darauf und schloss wieder die Augen. Es dauerte einen langen, qualvollen Moment, bis er die Quelle seiner Kraft wiederfand und sie in seine Hände fließen lassen konnte. Doch dann durchflutete ihn die vertraute Wärme und er öffnete die Augen. Sein ganzer Körper leuchtete sanft, so wie er es getan hatte von dem Tag seiner Geburt an, sobald er seine Gabe rief. Er lenkte das Licht in seine Finger, sammelte es dort, bis es die Schatulle mit hellem Schimmer erfasste.
Noch einmal richtete er all seine Gedanken auf die Person, die Rettung bringen würde. Er hatte lange nach ihr gesucht, war überrascht gewesen über die einfache Lösung. Aber es mochten noch viele Sonnenumläufe vergehen, ehe sein Volk neu erstarken würde. Und sein Opfer dafür war groß.
Er begann, den Bann zu murmeln. Worte, die ein Wächter des Lichts niemals aussprechen sollte, wollte er nicht dem Untergang geweiht sein. Worte, mit denen er sich selbst vernichtete.
Er keuchte leise, als sich seine Kraft in der Brust sammelte und langsam aus ihm zu fließen begann. Er lenkte sie auf die Schatulle, wo sie sich zu einem leuchtenden, pulsierenden Ball formte. Leiser Schmerz zog durch seinen Körper, als immer mehr von seinem Licht ihn verließ. Die wunderbare Gabe, das Geschenk des Schöpfergotts, das ihn seit Anbeginn seines Lebens begleitet hatte. Er musste sich dazu überwinden, auch noch den letzten Rest davon los zu lassen.
Sein Körper erlosch, während das Licht sich in der Schatulle bündelte, sie mit hellem Schein umgab. Rynwed senkte seine Hände, sah zu, wie es sich in das kleine Behältnis zurückzog. Dort würde es für lange Zeit bleiben. So hatte er es beschlossen.
Er sog den Atem ein, von plötzlicher Schwäche übermannt. Ein Letztes war noch zu tun. Er musste seine Botschaft dorthin senden, wo der Retter sie finden würde.
Noch einmal straffte er seinen Körper, murmelte mit tauben Lippen die Beschwörungsformel. Ein Lichtblitz flammte auf, hüllte die Schatulle ein und dann war sie fort. Ein heller Flecken schwebte kurz noch an der Stelle, wo sie gestanden hatte. Er verschwamm und das Gefühl eines endgültigen Verlustes übermannte Rynwed so stark, dass ein Schluchzen in seiner Kehle aufstieg. Er schluckte und blinzelte die Tränen weg, die in seinen Augen brannten. Jetzt blieb ihm nichts mehr als auf das Ende zu warten.
Er sank auf dem grob gezimmerten Stuhl zusammen, der mit dem Tisch und dem staubigen Strohsack, auf dem er zuvor noch geruht hatte, die einzige Einrichtung dieser armseligen Kammer darstellte, in der zu früheren Zeiten die Wachsoldaten ausgeharrt hatten.
Die Ruine von Martok. Einst mächtige Festung, ein Bollwerk gegen das Böse. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es betrachtete. Sardar Myrwin de Trentaw, der Herr von Martok, hatte eine sehr zweifelhafte Rolle in den Kriegen gespielt. Man hatte ihn bezichtigt, einen Pakt mit den dunklen Mächten geschlossen zu haben.
Einerlei. Es tat nichts mehr zur Sache. Die Burg war gefallen, wie so viele andere auch und jetzt herrschte Stille in diesen zerborstenen Mauern. Für einen Moment glaubte Rynwed, die Verzweiflung zu spüren und die Stimmen der verlorenen Seelen zu hören, die von dem Gemäuer aufgesaugt worden waren, aber das konnte auch eine Täuschung sein. Es gab viele solcher Orte im Reich der Sardars und niemand vermochte, ihre Schrecken zu lindern oder vergessen zu machen.
Er erhob sich schwerfällig und trat zum Fenster. Kühle Luft umspielte sein Gesicht. Kurz ergab er sich der Vorstellung, wie es sein mochte, wenn er jetzt den Fuß auf das Sims setzen und sich fallen lassen würde. Niemand würde davon erfahren, wenn er seinem Leben selbst ein Ende setzte. Nein, einen solchen Frevel durfte er nicht begehen! Heldon würde ihm das nicht verzeihen!
Rynwed schleppte sich zu dem Strohsack, seinem armseligen Lager, auf dem er den Tod erwarten würde. Die wenigen Schritte erschienen ihm wie eine einzige Qual, jeder Knochen seines Körpers, jede Sehne, jeder Muskel schmerzte. Deutlich spürte er jetzt, da er sein Licht verschenkt hatte, die Last des Alters. Nun war er nichts mehr als ein gewöhnlicher, sterblicher Mensch mit einem letzten Rest an Lebensfunken. Genauso sollte es sein, wenn er der Schwarzen in die Hände fiel. Nicht mehr sollte SIE von ihm bekommen!
Er legte sich nieder, streckte sich aus. Es würde nicht mehr lange dauern, dessen war er sich gewiss. Seine Kraft hatte in der Finsternis geleuchtet wie ein Fingerzeig.
Er betrachtete das klägliche Flämmchen der Kerze, die langsam niederbrannte. Es sollte das letzte Licht sein, das er in seinem Leben sah. Seine Augen schlossen sich und er schlief ein.
Ein Geräusch weckte ihn. Er schrak hoch, fand sich für einen Moment nicht zurecht. Die Kerze war heruntergebrannt, tiefe Dunkelheit hüllte ihn ein. Es war kalt, er fror, aber er wagte nicht, sich zu rühren.
Ein leises Schaben auf dem Steinboden. Etwas bewegte sich auf ihn zu. Er konnte nichts sehen, aber er spürte deutlich die Gegenwart eines anderen Wesens. Oder nein, es mussten mehrere sein, denn jetzt hörte er ein scharrendes Geräusch am Fenster. Er starrte in die Finsternis, nahm eine Bewegung wahr, etwas Schwarzes, noch dunkler als die Nacht. In einer ersten Regung wollte er aufspringen, weglaufen, doch das hatte keinen Sinn. Die saugenden Schatten waren schnell und er würde ihnen nicht entkommen.
Ein Geruch stieg in seine Nase, vertraut und doch immer wieder aufs Neue verstörend. Der Gestank des Bösen, ein Hauch von Verwesung und etwas Uraltem, Unaussprechlichem. Er hielt den Atem an, aber es nützte nichts. Der Gestank saß bereits in ihm fest und breitete sich beißend aus. Etwas tastete sich an seinem Bein entlang. Wo es ihn berührte, gefror das Blut in seinen Adern. Und dann kam der Schmerz. Wie unzählige Nadelspitzen durchdrang er die Haut, fuhr in das Fleisch und in die Knochen, durchbohrte ihn. Er stöhnte, unterdrückte einen Schrei. Nein, er wollte nicht klagen, wollte diesen Ungeheuern den Triumph nicht gönnen, sie um sein Leben betteln zu hören!
Das Etwas hüllte seine Beine ein, ein zweites bemächtigte sich seines Oberkörpers. Der Schmerz wurde zur brennenden Qual, glühende Speere fraßen sich in sein Inneres und jetzt schrie er doch. Er bäumte sich auf, als sein Körper ausgesaugt wurde, aufgefressen von diesen gierigen Wesen.
Der Gestank wurde übermächtig, als ein Schatten sich auf sein Gesicht legte, aber er nahm ihn kaum mehr wahr, nur mehr diese brennende Qual, die alles Leben in ihm auslöschte. Sein letzter Schrei wurde erstickt, war nur ein Seufzen, das in der Dunkelheit verklang.
Die Schatten verharrten kurz, als ihr Werk getan war. Dann suchten ihre gierigen Finger nach weiteren Opfern. Als sie nichts Lebendiges mehr fanden, stießen sie ein leises, enttäuschtes Fauchen aus, glitten auf die Fensteröffnung zu und verschwanden in der Dunkelheit, um dem Ruf ihrer Herrin zu folgen.