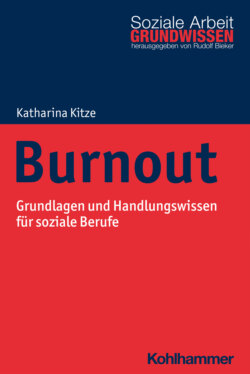Читать книгу Burnout - Katharina Kitze - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
ОглавлениеDurch das Outen von Personen des öffentlichen Lebens und die vielfache Nutzung des Begriffs im alltäglichen Sprachgebrauch hält sich das Thema Burnout seit Jahrzehnten hartnäckig im öffentlichen Interesse. Es mehren sich Berichte über die Zunahme von Arbeitsunfähigkeit genauso wie die Anzahl von Ratgebern über Burnout. So entsteht schnell der Eindruck, dass Burnout bereits den Charakter einer Volkskrankheit angenommen hat.
In diesem Kapitel erfahren Sie,
• weshalb es aus gesellschaftlicher Sicht wichtig ist sich mit dem Phänomen zu beschäftigen,
• wie oft Burnout in der Bevölkerung auftritt und deshalb das Gesundheitssystem belastet und
• welche Berührungspunkte das Thema Burnout mit der Sozialen Arbeit hat.
Du weißt nicht mehr wie die Blumen duften,
kennst nur die Arbeit und das Schuften
… so geh’n sie hin die schönsten Jahre,
am Ende liegst Du auf der Bahre
und hinter Dir da grinst der Tod:
Kaputtgerackert – Vollidiot.
(Joachim Ringelnatz)
Schon Ringelnatz urteilte, dass eine anstrengende Arbeit ohne entspannenden Ausgleich nicht gutgeheißen werden kann. Wie kommt es, dass manche Menschen sich von ihrer Arbeit derart fordern und überfordern lassen? Welche Wirkungen hat eine solche Verhaltensweise auf die Gesundheit und Lebenszufriedenheit? Was lässt Menschen ausbrennen?
Stress im Berufsleben ist heutzutage zwar nichts Außergewöhnliches. Ja, er ist für viele Arbeitstätige sogar anregend und herausfordernd, so dass sie motiviert an die Aufgaben herangehen und gute Leistungen erbringen. Doch wenn der Stress eine Qualität besitzt, die zu dauerhaft überlasteten und erschöpften Menschen führt, dann stimmt etwas nicht im System Arbeit. Oder stimmt vielleicht etwas mit diesen Menschen nicht? Warum trifft es nicht alle Arbeitstätigen, deren Berufe hohe Anforderungen und Leistungsdruck mit sich bringen? Dies sind nur einige Fragen, die in diesem Lehrbuch durchdacht werden sollen.
Das Leiden in einer solchen Arbeitssituation hat indes einen Namen: Burnout. Dieser Begriff ist heutzutage in aller Munde und findet gerade in den Medien eine bedeutungsschwangere Nutzung. So wird Burnout gern zur Beschreibung von Menschen eingesetzt, die uneigennützig Höchstleistungen vollbringen und dafür ihre Gesundheit opfern. Ein ›Burnout‹ zu haben bedeutet für viele Menschen als interessiert und arbeitsam zu gelten. Dieses Gestresst-Sein kann denn auch demonstrativ eingesetzt werden, um der Tatsache Ausdruck zu verleihen, dass jemand involviert und engagiert ist. Diese Selbstdarstellung wirkt nach außen, als ob die Person ein Idol für Fleiß und Ehre sein könne, klingt es doch eher nach starken Menschen, denen nachgeeifert werden sollte. Burnout gilt hier als geflügeltes Wort für Leistungsbereitschaft und verleiht den Personen damit einen gewissen gesellschaftlichen Status.
Jedoch wissen die wirklich von diesem Phänomen Betroffenen, dass dieses Ausbrennen und die Erschöpfung der Arbeitskraft zu ganz erheblichem Leiden führen. Burnout heißt eher ständig negative Gefühle wie Ärger und Angst mit sich zu tragen, gesundheitliche Probleme zu spüren und sich hilflos zu fühlen. Es hat weder etwas mit Leistung und Erfolg noch mit einem Ansehen in der sozialen Umgebung zu tun.
Das Attraktive am Phänomen Burnout ist hingegen, das jede Person glaubt, etwas dazu sagen zu können, es zu kennen. Dabei ist bis heute keine einheitliche Definition verfügbar. Wovon reden wir eigentlich? Das wäre etwas, was geklärt werden müsste, wenn sich Personen mit Erschöpfung brüsten. Um den Zugang zu dem zu erleichtern, was Burnout nun tatsächlich im Kern ausmacht, braucht es mehr als den Satz: »Ich fühle mich total erschöpft«. Hier liegt denn auch – wieder einmal – ein ganzes Buch dazu vor. Wozu denn nun noch ein Buch? – wird sich so manche Person denken. Um diese Frage zu beantworten, ist es hilfreich zuerst einen Blick auf die gesellschaftliche Relevanz des Themas zu werfen.