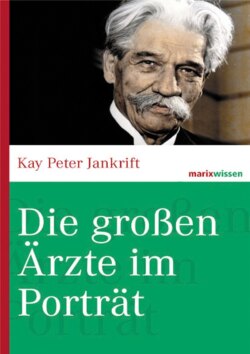Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 10
STATIONEN IN DER GESCHICHTE DER MEDIZIN Von Hippokrates bis Sir Alexander Fleming
ОглавлениеIm antiken »Haus der Heilkunde«
Die Anfänge unserer modernen Medizin reichen zurück bis in die griechische Antike. Das zweifelsohne bekannteste Zeugnis für diese lange Traditionslinie ist der sogenannte »Eid des Hippokrates«, die früheste Verpflichtung der Ärzteschaft zu ethischem Handeln. Die Lehren der griechisch-römischen Heilkunde bildeten für mehr als ein Jahrtausend die theoretische Grundlage der Medizin. Sie basieren auf dem großen hippokratischen Corpus, jenen Werken, deren Autorschaft zu Recht oder Unrecht dem legendären Hippokrates von Kos (ca. 460–ca. 375 v. Chr.) zugeschrieben wird, der zum Inbegriff des idealen Arztes wurde. In Ableitung naturphilosophischer Konzeptionen von den vier Elementen Erde, Luft, Wasser und Feuer entwickelte Hippokrates eine rationale Theorie der Medizin. Ihren Kern bildete die sogenannte Viersäftelehre (Humoralpathologie). Dieser zufolge werden die Elemente zu den vier Körpersäften Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle gekocht. Während es sich bei den ersteren dieser Säfte um bekannte Körperflüssigkeiten handelt, wird heute darüber gerätselt, was sich hinter der Bezeichnung »schwarze« Galle verbirgt. Sie lässt sich nach modernen medizinischen Definitionen mit keiner der im menschlichen Körper tatsächlich vorkommenden Flüssigkeiten in Verbindung bringen. Die vier Körpersäfte der hippokratischen Lehre repräsentieren zugleich jeweils Kombinationen der natürlichen Eigenschaften heiß, kalt, trocken und feucht.. So ist gemäß diesem Schema etwa das Blut heiß und feucht, die gelbe Galle heiß und trocken, die schwarze Galle kalt und trocken und der Schleim kalt und feucht.
Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde die hippokratische Säftelehre durch den Arzt Galen von Pergamon (129–199/202/216) weiterentwickelt und verfeinert. Er fügte den Viererschemata von Elementen, Säften und Qualitäten weitere hinzu und setzte sie in einem System in Beziehung zueinander. Später wurden aus diesem hippokratisch-galenischen Denkmodell die vier Temperamente abgeleitet, die von der spezifischen Zusammensetzung der Körpersäfte bestimmt werden. Beim sogenannten Sanguiniker überwiegt das Blut (lat. sanguis), beim Phlegmatiker der Schleim (griech. phlégma), beim Choleriker die Galle (griech. cholós). Gesundheit und Krankheit wurden nach diesen Modellen gedeutet. Jede Krankheit wurde demgemäß durch ein Ungleichgewicht der Körpersäfte hervorgerufen. Standen die vier Säfte im Gleichgewicht, war der Mensch gesund. Die Deutung einer Erkrankung und ihre Behandlung leiteten sich aus diesem System ab. Durch sein Temperament war der Mensch in besonderer Weise für solche Krankheiten anfällig, die der vorherrschende Saft verursachte. Nach dieser Auffassung wurde etwa die Lepra durch ein Übermaß an schwarzer Galle verursacht. Die Natur der Krankheit galt als trocken und kalt wie der Körpersaft selbst. Leprakranke galten nach zeitgenössischer Sicht als übellaunig und hinterhältig. In dieser Zuschreibung begegnet uns der schwermütige Melancholiker. Er war durch seine seelische Konstitution mehr als andere gefährdet, an der Lepra zu erkranken.
Die Heilkunst wurde nach galenischem Denken allein durch eine Theorie der Medizin zur Wissenschaft. Alle anderen Wissenschaften, vor allem Logik, Ethik und Physik, galten als Diener der Medizin. Diese Prinzipien begründen das sogenannte »Haus der Heilkunde« mit seinen drei Pfeilern Physiologie, Pathologie und Therapie. Die Physiologie bezeichnet die Lehre und Wissenschaft von den natürlichen Lebensvorgängen (res naturales), insbesondere im Hinblick auf die Funktionen des Organismus. Ihr steht die Pathologie gegenüber, die Lehre von den krankhaften Veränderungen im Organismus (res contra naturam). Sie befasst sich – in der Gegenwart als ein medizinisches Teilgebiet – vor allem mit den Ursachen (Ätiologie), mit der Entstehung und Entwicklung von Krankheiten sowie mit deren Beschreibung (Nosologie). Die Theoriemodelle galenischer Physiologie und Pathologie blieben bis in das 17. Jahrhundert hinein nahezu unverändert gültig. Sie unterscheiden sich grundlegend von den Konzepten unserer heutigen Medizin. So war etwa der große Blutkreislauf noch nicht entdeckt worden. Nach der galenischen Vorstellung befand sich das Blut in einem geschlossenen System von Wechselbewegungen, die den Gezeiten des Meeres ähnelten.
Die Therapie gliedert sich ihrerseits in die Diätetik, die Pharmazeutik und die Chirurgie. Obwohl nach Auffassung Galens nur eine einzige Wissenschaft vom menschlichen Körper existiert, hat diese zwei Bereiche – die Gesundheitspflege (Hygiene) und die Heilkunde (Medizin). Erste Aufgabe des Arztes ist es in diesem Ordnungsprinzip, den Körper gesund zu erhalten. Die Behandlung der Krankheiten ist dieser Gesunderhaltung nachgeordnet. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei die Diätetik als die Lehre von der gesunden Lebensordnung und –führung. Es ist das Maßhalten, das nach galenischer Überzeugung Voraussetzung für die Gesundheitspflege (Hygiene) ist. Demnach bildet das rechtes Maß der sogenannten sex res non naturales, nämlich Licht und Luft (aer), Essen und Trinken (cibus et potus), Bewegung und Ruhe (motus et quies), Schlafen und Wachen (somnus et vigilia), Stoffwechsel (excreta et secreta) sowie Bewegungen des Gemüts (affectus animi) die Grundlage für eine gesunde Lebensführung. Kommt es zu Erkrankungen, weil sich der Lebenswandel nicht in der entsprechenden Form gestaltete, so beruht die Behandlung vor allem darauf, das Gleichgewicht der Säfte durch das vorgeschlagene Maßhalten wieder ins Lot zu bringen.