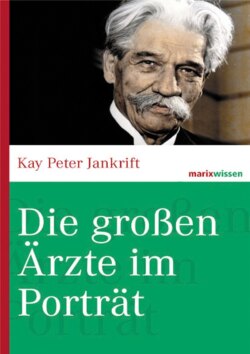Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 14
Jenseits der Klostermauern
ОглавлениеDie Einordnung des Frühmittelalters als »Zeitalter der Klostermedizin« resultiert nicht zuletzt aus der Überlieferungssituation. Die in den Klöstern gepflegte Schriftlichkeit bescherte dem Wirken der Mönchsärzte ein jahrhundertelanges Nachleben und verzerrt so den Blick auf die wahren Gegebenheiten. Für die gesundheitliche Versorgung der frühmittelalterlichen Bevölkerung spielten die Klöster eine ebenso untergeordnete Rolle wie die theoretischen Schriften der Antike. Doch die »Volksmedizin« wurde vor allem mündlich tradiert. Schriftzeugnisse, die Aufschluss über die Laienärzte aus dem Volk und ihr Wirken liefern könnten, fehlen. Dabei sprechen die archäologischen Befunde von Skeletten aus Gräbern der Völkerwanderungszeit von einem hohen Kenntnisstand dieser auf empirischen Grundlagen praktizierenden Heilkundigen. Selbst schwere Schädelverletzungen, hervorgerufen durch Schwerthiebe im Kampf, waren demnach erfolgreich behandelt worden.
Exemplarisch für die normativen Rahmenbedingungen heilkundlicher Betätigung im Frühmittelalter stehen die Bestimmungen der westgotischen leges. Als einziges der Germanenrechte enthält die Lex Visigothorum detaillierte Ausführungen über Ärzte, Kranke und medizinische Behandlungen. Dabei richten sie sich nicht an Mönchsärzte, sondern sind deutlich auf die Alltagsgeschäfte heilkundiger Laien zugeschnitten. Die Bestimmungen zeigen unter anderem, welche Bedingungen an die Aufnahme einer ärztlichen Heilbehandlung geknüpft waren. Der Besuch am Krankenlager musste zuvor vereinbart werden. Erst dann begab sich der Heilkundige zu dem Kranken. Bei seinem ersten Besuch musste er die zu behandelnde Wunde in Augenschein nehmen und die Art der Beschwerden feststellen. Die Vereinbarung des Arztbesuchs stellte bereits eine Art Vorvertrag dar. Im Anschluss an die Diagnose folgte der eigentliche Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Krankem. Der Arzt durfte die Behandlung erst beginnen, wenn er zuvor eine Kaution gestellt hatte. Vermochte der Heilkundige den Kranken nicht entsprechend seiner vertraglichen Verpflichtungen zur Genesung zu führen und starb dieser, verfiel die vollständige Kaution. Zugleich war jeder Anspruch auf Bezahlung für die erbrachten Leistungen verwirkt. Blieb die Behandlung erfolglos, der Behandelte aber am Leben, so waren die vom Arzt zu zahlenden Bußgelder mitunter genau festgelegt. Wenn ein Arzt einen Freien durch einen schlecht durchgeführten Aderlass an seiner Gesundheit schädigte, sollte er eine Strafe von 150 Schillingen zahlen. Handelte es sich um einen Knecht, dessen Gesundheit beeinträchtigt worden war, sollte der Heilkundige einen Ersatzmann stellen.
Freie Frauen durften vom Arzt nur im Beisein eines Elternteils oder eines nahen Verwandten zur Ader gelassen werden. Verstieß ein Heilkundiger gegen diese Bestimmungen, musste er die Verwandten oder den Gatten der Frau mit 10 Schillingen entschädigen. Diese Regelung sollte vermeiden, dass bei der Behandlung »Ungehöriges« vorkomme, heißt es zur Erläuterung im Nachsatz. Die Lex Visigothorum verbot Ärzten ferner den Besuch von Gefangenen. Dabei bezog sich die Verfügung in erster Linie auf inhaftierte Große. Dadurch sollte verhindert werden, dass der Arzt einem Gefangenen, der sich seinem Urteil durch Selbstmord entziehen wollte, etwa durch Gabe eines Giftes in seinem Vorhaben aktiv unterstützte. Dementsprechend hoch war die Strafe bei Zuwiderhandlung: Der Arzt sollte den Verstoß gegen dieses Gesetzt mit seinem eigenen Leben büßen..
Doch regelten die Gesetze auch ärztliche Tarife und die Ausbildung von Lehrlingen. So sollte das erfolgreiche Stechen des Stars mit 5 Schillingen entlohnt werden. Für die Ausbildung sollten 12 Schillinge Lehrgeld entrichtet werden. Angesichts der Höhe fälliger Strafzahlungen im Falle misslungener Behandlungen scheint sich die Vergütung der Heilkundigen eher gering ausgenommen zu haben. Weiterhin wurde bestimmt, dass ein Arzt von niemandem ohne Verhör verhaftet werden durfte. Eine Ausnahme bildete lediglich die Anklage der Tötung. Bis zu seiner Anhörung in anderen Schuldsachen blieb der Arzt unter einen Bürgen gestellt. Die zweifelsohne anhand praktischer Erfahrungen entwickelten Bestimmungen erlauben nicht nur einen Blick in das Spektrum möglicher Eingriffe und ärztlichen Fehlverhaltens, sie zeigen an anderer Stelle auch die Bedeutung magischer Vorstellungen für die frühmittelalterliche Medizin außerhalb der Klöster. Die Gesetze erwähnen beispielsweise an anderer Stelle den unter Strafe gestellten Diebstahl von Särgen zum Gebrauch als Heilmittel. Der Dieb musste den geschädigten Erben des Toten eine Strafzahlung von 12 Schillingen hierfür entrichten. Sofern ein Knecht den Sarg auf Befehl seines Herrn gestohlen hatte, sollte der Auftraggeber für den Schaden aufkommen. Fiel für einen Freien die Strafe für den Sargdiebstahl noch vergleichsweise milde aus, kam die Bestrafung eines Knechts, der aus eigenem Antrieb gehandelt hatte, einer Verurteilung zum Tode gleich. Zunächst musste er dem Leichnam zurückgeben, was er aus dessen Grab entwendet hatte. Anschließend sollte er für seinen Frevel mit 100 Peitschenhieben büßen. Falls die Praxis der Norm tatsächlich folgte, dürfte kein Deliquent dieses überlebt haben.
Obwohl die übrigen Germanenrechte Heilkundige und Behandlungen nicht erwähnen, ist doch davon auszugehen, dass sich in der Lex Visigothorum zumindest in Teilen eine medizinische Kultur widerspiegelt, wie sie im frühen und hohen Mittelalter überall im Abendland existierte. In den erzählenden Quellen jener Zeit stoßen wir denn auch auf versprengte Hinweise auf diese heilkundigen Laien, so etwa am Ende des 6. Jahrhunderts auf Marileif, den Leibarzt des Merowingerkönigs Chilperich I. Den Ausführungen ist zu entnehmen, dass Marileif einer Familie von Unfreien entstammte. Es müssen seine empirischen heilkundlichen Fähigkeiten gewesen sein, die ihm einen sozialen Aufstieg und zudem einigen Wohlstand bescherten. Auch das Wirken jüdischer Heilkundiger ist für diese Zeit bereits in den Quellen bezeugt.