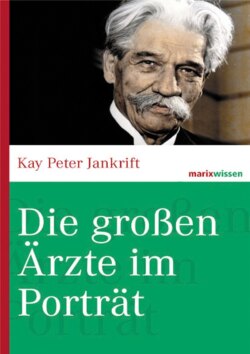Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 16
Das Ende der Klostermedizin, die mittelalterlichen Universitäten und die Aufspaltung der Heilkunde
ОглавлениеAls im Zeitalter der Kreuzzüge die Entdeckung des Aristoteles und der reichen Wissensschätze aus dem Orient die Entwicklung des Geisteslebens wie der Heilkunde vorantrieben, ging zugleich die Ära der Klostermedizin nach mehr als fünf Jahrhunderten ihrem Ende entgegen. Ihre letzte große Vertreterin war die berühmte Äbtissin Hildegard von Bingen († 1179). Ihr ganzheitliches Weltbild, in dem sich Mikro- und Makrokosmos miteinander zu einer universellen Einheit ergänzen, durchzieht ihr heilkundliches Werk wieder. Die Gestalt des Menschen ist nach dieser Konzeption ein verkleinertes Abbild des Kosmos. Der Mensch erscheint eingebunden in den großen Rahmen der kosmischen Kräfte, kann jedoch Einfluss auf diese ausüben. Dabei bilden Körper und Seele in ihrer Beziehung zueinander ebenfalls eine Einheit. Das geistig-visionäre Gerüst der Ordnung von Mikro- und Makrokosmos fand seinen Niederschlag auch in Hildegards Vorstellungen von Bau und Funktion des menschlichen Organismus, der Entstehung von Krankheit und schließlich deren effizienter Behandlung. Als Triebkraft allen Gedeihens in der Natur wirkte nach Auffassung Hildegards eine »Grünkraft«, die sie viriditas nannte und die sich je nach Lebensform unterschiedlich manifestierte. Beim Menschen zeigte sie sich als eben jene Lebenskraft, die etwa eine Fortpflanzung ermöglicht. Pflanzen verlieh die viriditas neben Wachstum zugleich Heilkraft. Die Heilkunde der Hildegard von Bingen erstreckte sich wie die ihrer antiken Vorbilder auf pflanzliche, tierische und mineralische Arzneimittelbestandteile, deren therapeutische Wirkung sie ausführlich beschreibt. Dennoch bekräftigte auch sie im Einklang mit all ihren Zeitgenossen, dass deren Verabreichung nur durch göttlichen Willen eine Genesung des Kranken herbeiführen könne. Dabei finden sich Ansätze zu einer Form der Behandlung, die Anklänge an die viel spätere Homöopathie Samuel Hahnemanns († 1843) zeigt. Entgegen der Lehren Galens, Krankheiten mit Mitteln zu behandeln, die der Natur der Krankheit gegenüberstanden (Contraria contrariis), folgte Hildegard der sogenannten Signaturenlehre. Diese besagte das genaue Gegenteil der galenischen Empfehlung: Heilmittel, die der Natur der Krankheit ähnelten, waren der Signaturenlehre zufolge am wirksamsten für die Heilung. Aus ihrer Beschäftigung mit Heilkunde und Gesundheitspflege erwuchsen zugleich Hildegards Vorstellungen vom idealen Arzt. Er sollte Barmherzigkeit und Stärke verkörpern. Seine heilkundliche Ausbildung erfolgte in einem engen Lehrer-Schüler-Verhältnis und sollte den angehenden Arzt dazu befähigen, seiner Tätigkeit über die medizinische Betreuung hinaus ihren Platz innerhalb des göttlichen Heilsplans zuzuweisen. Gleich einem Priester sollte er seinen Dienst auf die spätere Heilserfahrung orientieren.
Doch die Zeit der Klostermedizin ging unweigerlich ihrem Ende entgegen. Mit einer Reihe von Konzilsbeschlüssen wurden im 12. und 13. Jahrhundert die heilkundliche Ausbildung von Klerikern und deren Ausübung der Heilkunde verboten. Den Beginn machte die Synode von Clermont im Jahre 1130, deren Beschlüsse rund dreißig Jahre später in Tours bestätigt wurden. Die Beschlüsse des vierten Lateranums versetzten im Jahre 1215 der Klostermedizin den normativen Todesstoß. Besonders die von Klerikern praktizierte Chirurgie geriet in den Brennpunkt der Kritik. Die Kirche, so lautete der Tenor der Konzilien, schrickt vor dem Blut zurück. Von nun an ging die Heilkunde zusehends in weltliche Hände über. Daneben aber führten die Bestimmungen der Konzilien zu einer scharfen Trennung zwischen der praktisch-angewandten Chirurgie und der theoretischen, inneren Medizin. Diese Trennung blieb nicht ohne Konsequenzen für die heilkundliche Professionalisierung.
Die Chirurgie hatte einen schweren Stand als Lehrfach an den noch jungen Universitäten und wurde zeitweise völlig aus dem Lehrplan verbannt. Stattdessen erlernten die auch als Wundärzte bezeichneten Chirurgen ihr ärztliches »Handwerk« bei einem Meister und schlossen sich in Zünften zusammen. Ihnen fiel die Hauptrolle bei der gesundheitlichen Versorgung der spätmittelalterlichen Gesellschaft zu. In zahlreichen Schriftzeugnissen aus den Städten ganz Europas lässt sich ihr Wirken in vielfältiger Gestalt seit dem Spätmittelalter nachweisen. Manche standen in städtischen Diensten oder wirkten wie der berühmte Ambroise Paré († 1590) an den Höfen der Herrscher und auf deren Schlachtfeldern. Ihr Tätigkeit war festgelegt auf die äußere Wundbehandlung. Strikt verboten war ihnen die innere Verabreichung von Arzneien.
Hierzu waren nur die sogenannten Physici, die universitär gebildeten Ärzte befugt, die an den medizinischen Fakultäten mit dem theoretischen Wissen der antiken Autoritäten vertraut gemacht wurden. Sie hatten zumeist wenig Bezug zur Praxis und hatten keinen nennenswerten Anteil an der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Zwar beschäftigten die meisten Magistrate seit dem späten Mittelalter einen universitär gebildeten Physicus als Stadtarzt, doch versorgte dieser zumeist nur die Familien der Ratsherren und hatte im besten Fall noch die Oberaufsicht eines städtischen Hospitals inne. Für die gewöhnlichen Stadtbewohner war eine Konsultation bei ihm zu kostspielig. Sie suchten ihre Hilfe bei den Heiligen, die sie im Gebet und auf Pilgerfahrten um Genesung baten. Häufig stellten sich die gelehrten Ärzte so wie Arnald von Villanova († 1311) oder Guy de Chauliac († 1368) in den Dienst weltlicher oder geistlicher Herrscher.
Vorreiter der medizinischen Ausbildung an den noch jungen Universitäten war die wohl schon vor dem Jahre 1000 bestehende Medizinschule von Salerno gewesen, wo vor allem Geistliche die Heilkunde ausübten und wo sich das Heilwissen aus dem ganzen Mittelmeerraum konzentrierte. So blieb denn auch die altehrwürdige Schule erhalten, als der Staufer König Manfred von Sizilien († 1266) alle Schulen seines Königreichs schloss, um die 1224 eingerichtete Universität von Neapel zu fördern. Zwischen 1150 und 1250 waren aus den Zusammenschlüssen von Magistern und Scholaren, den universitären Lehrern und ihren Schülern, die sich unabhängig von der Einflussnahme weltlicher und geistlicher Herrscher ihren Studien widmen wollten, erste Universitäten in Bologna, Paris und Oxford entstanden. Diese erhielten bald medizinische Fakultäten. Zunächst im Jahre 1219 in Bologna, dann etwa 1220 in Montpellier, 1228 in Padua, 1229 in Toulouse, 1274 in Paris, 1303 in Avignon, 1305 in Orléans und 1339 in Grenoble. Das Deutsche Reich hinkte bei dieser Entwicklung weit hinter Italien, Frankreich und der Iberischen Halbinsel hinterher. Erst Kaiser Karl IV. gründete in seiner Residenzstadt Prag 1348 die erste Universität des Reichsgebiets. Die Kölner Universität wurde 1388 ins Leben gerufen. Zu dieser Zeit gab es in Italien bereits 15, in Frankreich 8 und auf der Iberischen Halbinsel 6 Universitäten. Auf den Britischen Inseln hatten die berühmten Universitäten von Oxford und Cambridge ihren Lehrbetrieb aufgenommen.
Eine umfangreiche Medizinalgesetzgebung tritt uns etwa zeitgleich mit der Geburt der ersten medizinischen Fakultäten im sogenannten Liber Augustalis des Stauferkaisers Friedrich II. († 1250) entgegen. Schon ein Jahrhundert zuvor hatte sich Roger II. († 1154) darum bemüht, mit strengen Vorschriften die Qualität ärztlicher Tätigkeit in seinem Königreich sicherzustellen und so seine Untertanen vor gesundheitlichem Schaden zu bewahren. Im Liber Augustalis finden sich nun ausführliche Bestimmungen über Art und Dauer des ärztlichen Studiums nebst speziellen Erweiterungen für die Chirurgen, deren Ausbildung auch die Sektion von Leichen zwingend vorsah. Daneben trennten sich auf Grundlage der Bestimmungen Medizin und Pharmazie. Laut der Vorschriften muss der Arzt den Apotheker kontrollieren. Er darf jedoch keine eigene Apotheke unterhalten.