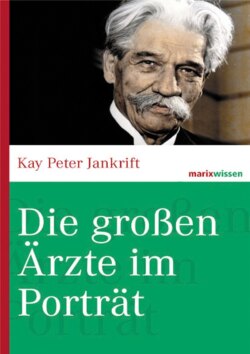Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 15
Heilwissen aus dem Orient
ОглавлениеNur wenige Jahre vor dem Beginn der Kreuzzüge in den Vorderen Orient am Ende des 11. Jahrhunderts gelangten die Schätze orientalischen Heilwissens allmählich in das Abendland und prägten nachhaltig die weitere Entwicklung der Medizin. Eine »arabische Medizin«, von deren Rezeption im hochmittelalterlichen Westen in vielen Geschichtswerken noch immer die Rede ist, hat es im strengen Wortsinn nie gegeben. Auch der von einigen Wissenschaftlern vorgeschlagene Begriff der »islamischen Medizin« wird der Sache kaum gerecht. Viele der Heilkundigen, deren medizinische Schriften während des hohen Mittelalters in das Abendland gelangten und die den Kern orientalischer Medizin bildeten, waren keine Araber und nicht wenige von ihnen nicht einmal Muslime. Vor allem Perser, Juden, orthodoxe Griechen, syrische Christen, Berber und Tadschiken hatten im Orient das Erbe der griechischrömischen Heilkunde bewahrt und weiterentwickelt. Bevor die ursprünglich griechischen Werke schließlich ihren Weg ins Arabische fanden, wurden sie von orientalischen Christen ins Altsyrische übertragen. Diese Sprache war unter den orientalischen Völkerschaften des Frühmittelalters vom Mittelmeer bis zum Persischen Golf sowie von Südpalästina bis zum iranischen Hochland weit verbreitet. Erst im 9. Jahrhundert setzte eine umfassende und intensive Übersetzertätigkeit wissenschaftlicher Texte ins Arabische ein, die während des 10. Jahrhunderts andauerte. Innerhalb des islamischen Herrschaftsraumes, der sich fast von Indien entlang der nordafrikanischen Küste bis auf die Iberische Halbinsel spannte, war das Arabische zur Kultur- und Verkehrssprache geworden. Nicht allein Muslime, auch Juden und Christen griffen im Alltag wie in der Wissenschaftsvermittlung auf die arabische Sprache zurück, wie das große Werk des jüdischen Arztes und Religions-philosophen Maimonides (gest. 1204) eindrucksvoll zeigt. Das während des Hochmittelalters in den Westen gelangte Heilwissen ist in diesem Sinne also am treffendsten als arabischsprachige oder orientalische Medizin zu bezeichnen.
Durch Constantinus Africanus († 1086), einen in Nordafrika geborenen und wahrscheinlich zum Christentum konvertierten muslimischen Kräuterhändler, der um 1070 an die Schule von Salerno und von dort zum Montecassino kam, wurden die wichtigsten Werke orientalischer Heilkunst durch Übersetzungen im Westen zugänglich gemacht, darunter die Schriften des jüdischen Arztes Isaak Judaeus (um 850) und der Liber pantegni des ‘Alī ibn al-‘Abbās al-Mağūsī, genannt Haly Abbas (Mitte des 10. Jahrhunderts). Das große Übersetzungswerk des Constantinus Africanus wurde im 12. Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel durch Gerhard von Cremona († 1187) und seinen Kreis fortgesetzt. Toledo hatte sich bald nach seiner Rückeroberung durch die Christen im Jahre 1085 zu einem abendländischen Zentrum des Wissenstransfers und der Übersetzungen aufgeschwungen. Dort übersetzte Gerhard unter anderem den bedeutenden Canon medicine Ibn Sīnā (Avicenna, gest. 1037), den Constantinus Africanus noch nicht in den Westen gebracht hatte und der bald den Liber pantgeni an Bedeutung überflügelte. Hinzu kamen die Schriften des Ar-Rāzī (Rhazes, gest. 925), die wie auch das große Werk zur Chirurgie des Abū‘l-Qāsim Halāf ibn al-‘Abbās az-Zarāwī (gest. um 1010), im Westen als Abulcasis bekannt, jahrhundertelang den heilkundlichen Unterricht bestimmen sollten und später an den medizinischen Fakultäten der Universitäten Einzug hielten.