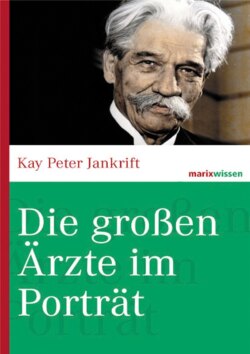Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 19
ОглавлениеHIPPOKRATES VON KOS
(ca. 460–ca. 375 v. Chr.)
Inbegriff des idealen Arztes
Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meinem Vermögen und meinem Urteil, fernhalten aber werde ich mich davon, sie zu Schaden und Unrecht zu treffen. So heißt es in jenem berühmten Eid, dessen Autorschaft mit dem griechischen Arzt Hippokrates von Kos verbunden ist und dessen Namen unsterblich gemacht hat. Der hippokratische Eid bezeugt das Streben antiker Ärzte nach ethischen Normen für die Behandlung Kranker zu Zeiten, in denen eine staatliche Kontrolle des Medizinalwesens und seiner Vertreter noch nicht existierte. Hippokrates steht gleichsam als Inbegriff des idealen Arztes am Anfang der langen Entwicklungsleiter zur Medizin unserer Gegenwart. Keineswegs einig ist sich die Wissenschaft allerdings in der Frage, welche der mehr als 60 überlieferten Schriften des sogenannten hippokratischen Corpus tatsächlich aus der Feder des griechischen Heilkundigen stammen. Denn nur wenig ist über das Leben des Hippokrates bekannt.
Der Nachkomme des Asklepios
Den Ausführungen des Soranos von Ephesos zufolge, der am Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. ebenfalls als Arzt wirkte und eine Biographie seines hochgeachteten Vorgängers verfasste, wurde Hippokrates um 460/459 v. Chr. auf der Insel Kos vor der kleinasiatischen Küste geboren. Der legendenhaften Überlieferung zufolge entstammte er der Ärztesippe der Asklepiaden, die den griechischen Heilgott Asklepios als ihren Stammvater betrachtete. Laut Soranos handelte es sich bei Hippokrates um einen Asklepios-Nachkommen in der 19. Generation.
Der Begriff Asklepiades bezeichnete zu dieser Zeit den Arzt. In einem später entstandenen Mythos erscheint Asklepios schließlich als Sohn des Gottes Apollon und einer irdischen Frau. Kultstätten des Asklepios, sogenannte Asklepeia, sind seit dem späten 6. Jahrhundert v. Chr. belegt. Kranke suchten dort durch einen Tempelschlaf (enkoimesis) Linderung von ihren Leiden. Das zentrale Heiligtum war Epidauros, wo die in archäologischen Grabungen zutage geförderten Tafeln bis heute Zeugnis über die Heilungen im Tempel ablegen.
Eine besondere Rolle im Asklepioskult spielte die Schlange. Ihre Häutung, das Abstreifen der alten Haut, stand symbolisch für eine Verjüngung und Erneuerung durch die göttliche Heilkraft. Zugleich besaß das Reptil in den Augen der Zeitgenossen Qualitäten, über die auch ein Arzt verfügen sollte: Scharfsinn und Wachsamkeit. Sofern es gezähmt war, wohnte ihm auch die für den Heilkundigen nötige Milde inne. Darüber hinaus fand Schlangenfleisch als Bestandteil vieler Arzneien Verwendung. So wurden neben anderen Tieren vor allem zahme, ungiftige Schlangen in den Asklepios-Heiligtümern gehalten. Nicht zuletzt sorgte der Gott gemäß der Überlieferung in Gestalt einer Schlange für die Verbreitung seines Kultes weit über Epidauros hinaus. Die Verbindung zwischen Asklepios und der Schlange fand gleichsam ihren ikonographischen Niederschlag. Seit dem 4. Jahrhundert wurde der Gott unter anderem mit einer Schlange dargestellt, die sich um einen Stab windet. Dieser Äskulapstab hat die Zeiten als Symbol der Heilkunst bis in unsere Gegenwart hinein überdauert. Als Hippokrates im 5. Jahrhundert v. Chr. seine Kunst auszuüben begann, waren die Asklepios-Heiligtümer bereits gewachsene Institutionen.
Ein Leben in kultureller Blütezeit
In die vermeintliche Lebensspanne des Hippokrates, der seinen Beruf entsprechend den Gepflogenheiten der Zeit als wandernder Heilkundiger ausgeübt haben dürfte, fallen die Vollendung der attischen Demokratie wie auch die großen Kämpfe der Athener gegen Sparta und Persien. Im Jahre 449 gelang unter der Führung des Kimon in der Doppelschlacht bei Salamis der entscheidende Sieg gegen die Perser. Der Kalliasfriede des Jahres 448 erklärte die griechischen Städte Kleinasiens und Zyperns als auch weiterhin dem Perserreich zugehörig, sicherte ihnen aber die Wahrung ihrer Autonomie zu. Die Ägäis wurde zum griechischen Binnenmeer. Nur ein Jahrzehnt zuvor hatte die attische Demokratie mit der Zulassung der 3. Klasse zum Archontat, der gewählten Regierungsführung, ihre Vollendung erfahren.
Die ersten Jahre von Hippokrates‘ ärztlicher Tätigkeit dürften von der großen kulturellen Blüte des 5. und 4. Jahrhunderts, der klassischen Zeit, bestimmt gewesen sein. Zu seinen bekanntesten Zeitgenossen zählen etwa die Philosophen Sokrates (469–399 v. Chr.) und Plato (427–347 v. Chr.), die Literaten Sophokles (497–406 v. Chr.), Euripides (480 –406) und Aristophanes (445–385 v. Chr.) sowie die Geschichtsschreiber Herodot von Halikarnassos (484–425 v. Chr.) und Thukydides (460–396 v. Chr.). Den Ausführungen Platos und später des Aristoteles (384–322) zufolge war Hippokrates als Arzt und heilkundiger Lehrer bekannt. Angesichts des renommierten Umfeldes großer Denker und anderer, offenbar zur Zufriedenheit der Kranken praktizierenden Heilkundiger betrachteten ihn seine Zeitgenossen aber wohl kaum als außergewöhnlich.
Zwischen Legende und überlieferter Lehre
Erst in späteren Generationen sind all die Legenden und Anekdoten in das hippokratische Corpus eingeflossen, die das künftige Bild des Arztes prägen sollten. Die Phantasie kannte hierbei keine Grenzen. Einem Überlieferungsstrang zufolge soll Hippokrates die Bibliothek von Kos verbrannt haben. Andere Stränge wiederum künden von seinen außergewöhnlichen Heilerfolgen. Nicht minder legendär sind die Beschreibungen seiner äußeren Erscheinung, die sich in einer Fülle fiktiver Darstellungen von der Büste bis zum Münzbild niedergeschlagen haben. Hippokrates wird als bärtiger Kahlkopf beschrieben, der sein Haupt stets zu bedecken pflegte. Angaben zu dem hohen Alter, das man ihm gemeinhin zubilligt, schwanken zwischen 85 und 109 Lebensjahren.
Ungeachtet dessen, welche der Schriften des hippokratischen Corpus tatsächlich aus der Feder des namengebenden Hippokrates stammen, beeinflussten diese Werke die Entwicklung des medizinischen Denkens im euro-mediterranen Raum für mehr als zwei Jahrtausende. Im Mittelpunkt der hippokratischen Lehre stehen die vier Körpersäfte Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle als menschliche Grundelemente. Solange diese Säfte im Gleichgewicht stehen, bleibt der Mensch gesund (Eukrasie). Geraten sie in ein Ungleichgewicht (Dyskrasie), wird er krank. Für die Hippokratiker sind jedoch nicht länger übernatürliche und magische Kräfte an der Entstehung solchen Ungleichgewichts verantwortlich. Vielmehr handelt es sich um natürliche Vorgänge, denen der Arzt mit seiner Kunst entgegenwirken kann, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Diese geistigen Grundprinzipien sollten in den folgenden Jahrhunderten immer weiter verfeinert werden. Verwiesen wurde dabei immer wieder auf ihren legendären Begründer, den idealen Arzt Hippokrates.
Quellen:
Gerhard Fichtner, Corpus Hippocraticum. Verzeichnis der hippokratischen und pseudohippokratischen Schriften, Tübingen 1996.
Œuvres complètes d´Hippocrate, traduction nouvelle avec le texte grec Émile Littré, 20 Bde. Paris 1839–1861 [Nachdrucke: Amsterdam 1961–1963 u. 1973–1991].
Weiterführende Literatur:
Florian Steger, Asklepiosmedizin. Medizinischer Alltag in der römischen Kaiserzeit (Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung. Beihefte 25), Stuttgart 2004.
Ursula Weißer, Hippokrates (ca. 460–ca. 375 v. Chr.), Galen (129–ca. 200 oder nach 210 n. Chr.), in: Hrsg. Dietrich von Engelhardt u. Fritz Hartmann, Klassiker der Medizin. Erster Band: Von Hippokrates bis Christoph Wilhelm Hufeland, München 1991, S. 11–29.