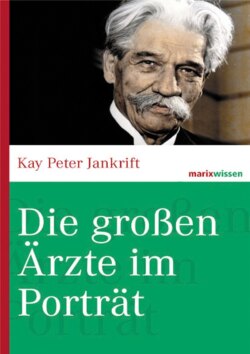Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 11
Griechisch-römische Heilkunde im 1. nachchristlichen Jahrhundert
ОглавлениеNeben den Schriften des hippokratischen Corpus und des Galen bildeten die heilkundlichen Abschnitte der großangelegten Naturkunde des römischen Offiziers Caius Plinius Secundus († 79), besser bekannt unter dem Namen Plinius der Ältere, die umfangreiche Schrift über die Heilmittel des etwa zeitgleich wirkenden Militärarztes Pedanios Dioskurides (Mitte des 1. Jh.) sowie die Medicina des Celsus für Jahrhunderte einen wesentlichen theoretischen Baustein der Gesundheitspflege, Heil- und Arzneimittelkunde.
Die Naturalis Historia, das bedeutendste Werk des Plinus umfasst 37 Bücher, von denen mehr als die Hälfe der Beschreibung von Heilmitteln aus dem Pflanzen- und Tierreich sowie deren Wirkung gilt. Im Laufe des 4. Jahrhunderts entstand aus einem überarbeiteten Auszug des großen Textcorpus die sogenannte Medicina Plinii. In ihren drei Büchern werden Krankheiten und deren Behandlungen vom Kopfschmerz über die Gicht bis hin zu Fieber und Dermatosen beschrieben. Die Medicina Plinii erfreute sich einer weiten Verbreitung und scheint im Rang eines ärztlichen Ratgebers für den Hausgebrauch gestanden zu haben, der zur Selbstmedikation genutzt wurde. Das Werk blieb lange in Gebrauch, wobei es abermals im Laufe der 6. Jahrhunderts einige Veränderungen durch Ergänzungen aus anderen medizinischen Schriften erfuhr. Seitdem wurde es auch unter dem Namen Physica Plinii – irrtümlich auch als Plinius Valerianus – bekannt.
Nicht weniger große Bedeutung erlangte das in seiner lateinischen Übersetzung Materia medica genannte Werk aus der Feder des im kilikischen Anarzabbos geborenen Pedanios Dioskurides. Es behandelt mehr als 1000 Arzneimittel pflanzlichen, tierischen und mineralischen Ursprungs. Von Galen als richtungsweisende Grundlage anerkannt, fand die große Arzneimittelkunde des Dioskurides über rund 1600 Jahre in zahlreichen Übersetzungen, insbesondere ins Lateinische, Arabische, Hebräische und Syrische, sowie in verschiedenen Bearbeitungen und Paraphrasen Verbreitung. Erst die von dem schwedischen Botaniker und Mediziner Karl von Linné (1707–1778) aufgestellte botanische Nomenklatur verdrängte die klassische Arzneimittellehre des Dioskurides.
Große Bedeutung für die weitere Entwicklung der Medizin hatte auch das Werk unter dem Titel De medicina des Aulus Cornelius Celsus. Es schlummerte während der mittelalterlichen Jahrhunderte in einem Dornröschenschlaf, um in der Frührenaissance verstärkt aufgegriffen zu werden. Die Medicina, entstanden in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts, enthält in ihren acht Büchern einen Abriss der bisherigen Medizingeschichte. Vor allem aber behandelt sie ausführlich die Prinzipien gesunder Lebensführung und Krankheitsvorbeugung, innere Erkrankungen, Krankheitsbehandlungen und die Chirurgie. Medizinhistorisch ist das Werk auch deswegen bedeutsam, weil es sich bei ihm um die einzige vollständig erhaltene Medizinalschrift für die Zeit zwischen der Redaktion des hippokratischen Corpus und dem ersten nachchristlichen Jahrhundert handelt.