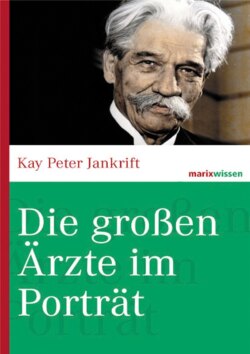Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 12
Frühmittelalterliche Klöster. Bewahrung eines antiken Erbes in Stätten des Heils und der Heilung
ОглавлениеMit der Beseitigung des weströmischen Kaisertums 476 im Zuge der großen Völkerwanderung und der Errichtung germanischer Nachfolgerreiche auf den Trümmern des Imperium Romanum bricht mit Hinblick auf die Überlieferung die dunkelste Zeit für die Medizingeschichte an. Die frühmittelalterlichen Jahrhunderte sind in der medizinhistorischen Forschung bis heute die am wenigsten bekannte Epoche. Angesichts der weitreichenden Beherrschung des Griechischen unter den Gebildeten während der Blütezeit Roms war die Ausformung einer eigenständigen lateinischen Medizinalliteratur weitgehend unterblieben. Der überwältigende Teil der bis zum Ende des 5. Jahrhunderts überlieferten medizinischen Fachliteratur war in griechischer Sprache verfasst. Nach der Völkerwanderung war das Griechische aber weitgehend in Vergessenheit geraten. Eine herausragende Rolle für die Bewahrung des antiken Heilwissens kam somit jahrhundertelang den Klöstern zu. Dies hat nicht zuletzt dazu geführt, dass die Phase bis nach dem Jahre 1000 oft als »Zeitalter der Klostermedizin« oder »vorsalernitanische Periode« bezeichnet wird. Mit der Einrichtung der sogenannten Medizinschule von Salerno nahe Neapel im 11. Jahrhundert wurde schließlich ein Neuanfang in der Wissensvermittlung gesetzt, der an die verschütteten antiken Wurzeln anknüpfte. Die Medizin nahm im Hinblick auf das Modell der sieben freien Künste (septem artes liberales), in die sich die mittelalterliche Wissenschaft nach den Konzepten der Zeitgenossen unterteilte, eine besondere Stellung ein. Der um das Jahr 560 geborene Enzyklopädist und spätere Bischof Isidor von Sevilla wies der Medizin den Platz einer secunda philosophia zu, einer zweiten Philosophie. Ihre Kenntnis, so Isidor, setzte die aller anderen Wissenschaften bereits voraus.
Das frühmittelalterliche Abendland war geprägt von der Kultur der Klöster als geistiger Zentren. Wie auch die Kathedralschulen spielten die Klöster eine Hauptrolle beim Kopieren überlieferter Schriften und der Bewahrung des antike Erbes mittels Übersetzung. Dabei wurden die Texte interpretiert und mit christlichen Vorstellungen überformt. Neben dem Gleichgewicht der Säfte spielte göttliches Wirken eine zentrale Rolle für die Gesundheit. Der Aspekt von Krankheit als Sündenstrafe gewann an Bedeutung. Der Arzt vermochte ohne himmlischen Beistand keine Heilung herbeizuführen. Und Christus, der Christus medicus, wirkte als der höchste aller Ärzte. Richtungsweisend für die Bewahrung des antiken Heilwissens, seine Nutzbarmachung nach christlichen Wertvorstellungen und den Umgang mit den Kranken spielte dabei zunächst das 529 durch Benedikt von Nursia gegründete Kloster Montecassino. Benedikt erhob in seiner für die Mönchsgemeinschaft geschaffenen Regel, der Regula Benedicti, die Fürsorge für Kranke, Schwache und Arme nach dem christlichen Gebot der Nächstenliebe zu einer Grundlage klösterlichen Lebens. Klöster waren zugleich Stätten des Heils wie Stätten der Heilung. Die Pflege der Seele, die Cura animae, wurde dabei gleichrangig mit der des Körpers, der Cura corporis, gesehen. Die Grundlage hierzu bildeten die Ausführungen im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums: »Ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. […] Ich war hungrig, und ihr habt mich gespeist.« Im 36. Kapitel der Benediktsregel gibt der Ordensgründer umfangreiche Anweisungen für den Umgang mit den kranken Mitbrüdern. Darin heißt es: »Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen: Man soll ihnen so dienen, als wären sie wirklich Christus; hat er doch gesagt: Ich war krank, und ihr habt mich besucht, und: Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aber auch die Kranken mögen bedenken, dass man ihnen dient, um Gott zu ehren; sie sollen ihre Brüder, die ihnen dienen, nicht durch übertriebene Ansprüche traurig machen. Doch auch solche Kranke müssen in Geduld ertragen werden; denn durch sie erlangt man größeren Lohn. Daher sei es eine Hauptsorge des Abtes, dass sie unter keiner Vernachlässigung zu leiden haben. Die kranken Brüder sollen einen eigenen Raum haben und einen eigenen Pfleger, der Gott fürchtet und ihnen sorgfältig und eifrig dient. Man biete den Kranken, sooft es ihnen gut tut, ein Bad an; den Gesunden jedoch und vor allem den Jüngeren erlaube man es nicht so schnell. Die ganz schwachen Kranken dürfen außerdem zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit Fleisch essen. Doch sobald es ihnen besser geht, sollen sie alle nach allgemeinem Brauch auf Fleisch verzichten. Der Abt sehe es als eine Hauptsorge an, dass die Kranken weder vom Cellerar noch von den Pflegern vernachlässigt werden. Auf ihn fällt zurück, was immer die Jünger verschulden.« (Zitiert nach: Birgit Frohn, Klostermedizin, München 2001, S.18 f.)
Für die kränklichen und schwachen Brüder galten im klösterlichen Alltag besondere Bestimmungen. Lautete die Devise des Ordensgründers auch »Bete und arbeite« (ora et labora), galt dies durchaus in Abstufung des körperlichen Vermögens. Stehen die Ausführungen zum Umgang mit kranken Mitbrüdern auch im Mittelpunkt der Regel, so existieren doch auch Bestimmungen zum Verhalten gegenüber Gästen. Arme und Fremde sollten gemäß der Regel mit besonderer Herzlichkeit aufgenommen werden, denn mit ihnen werde Christus selbst aufgenommen.