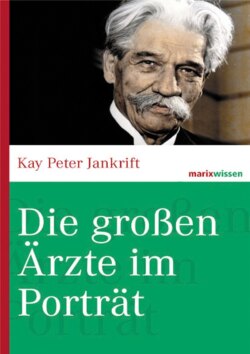Читать книгу Die großen Ärzte im Porträt - Kay Peter Jankrift - Страница 13
Der Klosterplan von Sankt Gallen und die klösterliche Krankenversorgung
ОглавлениеEindrücke einer idealtypischen Klosteranlage mit ihren verschiedenen Möglichkeiten zur Unterbringung Kranker und Bedürftiger vermittelt der berühmte Klosterplan von Sankt Gallen, der um 820 auf der Insel Reichenau im Bodensee entstanden ist. Bei der Betrachtung fällt zuerst die große, im Westen von zwei Rundtürmen flankierte Klosterkirche ins Auge. Um den Kernbereich des Klosters herum, dessen Betreten den Mitgliedern der Mönchsgemeinschaft vorbehalten war, findet sich eine Anzahl weiterer Gebäude. Darunter auch die Hospitalanlagen im Osten und Westen. Der Sankt Gallener Plan erlaubt dabei eine Unterscheidung dreier in ihrem Zuschnitt unterschiedlicher hospitalischer Einrichtungen: Im Südwesten das sogenannte Hospitale Pauperum, das zur Aufnahme von Armen, Pilgern und sonstigen Bedürftigen bestimmt war, im Nordwesten das Hospitium für gehobenere Gäste, die zu Pferde ankamen, schließlich im Osten des Klausurbereichs das sogenannte Infirmarium, das allein den kranken Mitbrüdern vorbehalten war. Das Infirmarium glich einem Kloster im Kleinen mit speziellen Zusatzeinrichtungen. In der Regel verfügte das Infirmarium über eine eigene Küche für die Kranken und einen zugehörigen Speisesaal, eine eigene Kapelle sowie Bade- und Aderlasseinrichtungen. Darüber hinaus gab es eine Unterkunft für den Arzt und eine Apotheke. Die Lagebezeichnungen änderten sich entsprechend in die entgegengesetzte Richtung, wenn der Kreuzgang anders als im Sankt Gallener Klosterplan im Norden der Kirche angelegt war. In diesem Fall läge das Hospitale Pauperum also im Nordwesten. Mehr als die Hälfte aller mittelalterlichen europäischen Klöster folgte diesem durch die Benediktsregel vorgegebenen Anlageschema. Als Idealplan eines Klosters lassen sich auf der Sankt Gallener Grundrisszeichnung viele zusätzliche Details erkennen. So etwa Zimmer für reisende Mönche am nördlichen Seitenschiff und Unterkünfte für kranke Novizen im östlich gelegenen Noviziat. Außerdem gab es mitunter gesonderte Quartiere für Schwerkranke nahe dem klösterlichen Kräutergarten im Nordosten, die auf dem Plan nicht dargestellt werden. Bisweilen existierte zudem ein eigenes Haus für die heilkundliche Versorgung kranker Laienbrüder im Westen einer benediktinischen Klosteranlage. In einiger Entfernung von den gemeinschaftlichen Einrichtungen befand sich ein Gebäude zur Beherbergung Leprakranker.
Die heilkundliche Behandlung der kranken Mitbrüder oblag einem sogenannten Infirmarius, der bei der Durchführung seiner Aufgaben durch einen Laienbruder (famulus) unterstützt wurde. Die Behandlung orientierte sich an Galens Konzept der Diätetik mit ihrem rechten Maß an den sex res non naturales. Deshalb wurde unter anderem dafür gesorgt, dass die Betten regelmäßig aufgeschüttelt wurden und die Kranken eine ausgewogene Kost erhielten. Im Gegensatz zu ihren Mitbrüdern war kranken Mönchen der Genuss von Fleisch gestattet. Fleischhaltige Speisen dienten gemäß der Säftelehre einer Vermehrung des als heiß und feucht geltenden Blutes. Auch Wein stand auf dem Speiseplan der Kranken. Bäder durften sie sich richten lassen, soviel es ihnen gut tat – ganz im Gegensatz zu den übrigen Mönchen, die sich nach Auffassung des Heiligen Benedikt beim Baden zurückhalten sollten.
Kranke Brüder waren vom übrigen Konvent getrennt. Sie nahmen weder an den gemeinsamen Chorgebeten teil, noch speisten oder schliefen sie in den gleichen Räumen mit den Gesunden. Eine Hauptrolle bei der Krankenbehandlung spielte der Aderlass, der sich ebenfalls an den Prinzipien der Säftelehre orientierte. Alle Mönche eines benediktischen oder zisterziensischen Klosters wurden zur Verfrischung der Säfte viermal im Jahr zur Ader gelassen.
Einige der »Mönchsärzte«, die im Kloster ihren Dienst versahen, sind namentlich bekannt. Doch nur bei den allerwenigsten lassen sich biografische Hintergründe rekonstruieren oder Eindrücke ihres Wirkens gewinnen. Eine der wenigen Ausnahmen bildet dabei der Arzt Notker von Sankt Gallen († 975). Aufgrund seiner heilkundlichen Fähigkeiten wirkte er oft am Hof der ottonischen Herscher. Berühmt ist eine Anekdote geworden, die Notkers herausragende medizinische Kenntnis unterstreicht. Der bayerische Herzog Heinrich I. (gest. 955), ein Bruder des Kaisers Otto des Großen, soll dieser zufolge dem gelehrten Mönchsarzt den Urin einer schwangeren Hofdame als seinen eigenen präsentiert haben. Die Harnschau, bei der die Farbe des Urins und die erkennbaren Sedimente zeitgenössischen Vorstellungen zufolge Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand erlaubten, war während des gesamten Mittelalters eines der zentralen Diagnoseverfahren. Notker fiel nicht auf das Verwirrspiel herein. Wortgewandt prophezeite er dem Herzog, er werde binnen dreißig Tagen ein Kind zur Welt bringen. Jenseits von solchen Anekdoten zeigen archäologische Befunde von Skeletten mittelalterlicher Klosterfriedhöfe die großen Fähigkeiten der Heilkundigen, komplizierte Brüche und schwerste Verletzungen so zu behandeln, dass die meisten Kranken geheilt wurden.