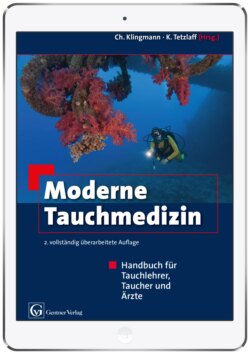Читать книгу Moderne Tauchmedizin - Kay Tetzlaff - Страница 11
Оглавление1 Historische Betrachtung
K.-P. Faesecke
Wenn der Mensch als warmblütiges und lungenatmendes Säugetier ein Medium aufsucht, das primär die Domäne kaltblütiger und kiemenatmender Lebewesen bildet, ist es nicht verwunderlich, dass eine Fülle von Reaktionen und Veränderungen in seinem Organismus einsetzt, die einerseits zu lebenserhaltenden Reflexen zählen, andererseits aber fast unmittelbar lebensbedrohlich sind.
Nachdem jahrtausendelang Unterwasseraktivitäten nur einer unerschrockenen Schar professioneller oder kriegerischer Sonderlinge vorbehalten waren, ist seit der Entwicklung massentauglicher Tauchgeräte in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine Sportart entstanden, die die medizinische Wissenschaft immer noch und immer wieder herausfordert, wenn es um die Erkennung, Behandlung und Verhütung von tauchspezifischen Gesundheitsstörungen geht, die durchaus noch immer nicht vollständig erklärbar sind.
1.1 Tauchen im Altertum
Der Mittelmeerraum ist nicht nur allgemein als die Wiege der abendländischen Kultur anzusehen, sondern ließ auch die ersten maritimen Aktivitäten wie Schiffbau, Fischerei und Seehandel entstehen. Besonders begehrt waren bereits in der Antike Luxusartikel wie Perlen, Purpurschnecken (zum Färben von Prachtgewändern), Schwämme und heilkräftige Algen, die nur durch Taucher zu gewinnen waren. Sie praktizierten die älteste Form des Apnoetauchens, wobei einzelne Individuen durch Konstitution und Training sicherlich erstaunliche Tauchtiefen und -zeiten erreichen konnten. Homer beschreibt in der „Ilias“ die Eleganz des Tauchers beim Kopfsprung ins Wasser; bei der u. a. von Shakespeare beschriebenen Angeltour von Marc Anton und Cleopatra spielten Taucher eine wichtige Rolle und Aristoteles hat sich in seinen Schriften mit der Frage beschäftigt, wie der Taucher unter Wasser Luft mitführen könnte. Bei solchen Überlegungen spielten vornehmlich militärische Aspekte eine Rolle: Wie konnte sich jemand unerkannt einem feindlichen Schiff nähern und es dann z. B. durch Anbohren des Rumpfes versenken? In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass in der weiteren Evolution der Tauchtechnik durch die Jahrhunderte immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen und die Vorbereitungen dafür Anstoß zu Neuentwicklungen gaben. Das lässt sich bis heute für das „technical diving“ im Sporttauchbereich nachvollziehen.
Dass sich in überlieferten Schriften abenteuerliche Berichte über Unterwassererlebnisse finden, ist eher orientalischer Fabulierkunst zur Verherrlichung der Herrscher als realer Technologieanwendung zuzuschreiben: So soll sich beispielsweise Alexander der Große in einer gläsernen Kugel mehrere Stunden unter Wasser aufgehalten haben …
Es sind von den Ärzten jener Zeit keine medizinischen Beobachtungen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Unterwasseraktivitäten überliefert worden, bis auf eine, die Eingang in die lateinische Umgangssprache fand: Dort wurde der Taucher als „urinator“ bezeichnet; die harntreibende Wirkung des Eintauchens ins Wasser war also schon im Altertum bekannt. Im Übrigen ist es nachvollziehbar, dass beim damaligen medizinischen Kenntnisstand keine im heutigen Sinne physiologischen, d. h. funktionsorientierten Erkenntnisse zu gewinnen waren.
1.2 Das Mittelalter
Kaum eine menschliche Aktivität ist solchen extremen Interaktionen von physikalischen Gesetzen und physiologischen, also körperlichen Antworten darauf, unterworfen wie das Tauchen. Solange die Naturwissenschaft sich nicht emanzipiert hatte und das Experiment an die Stelle mystischen Hokuspokus getreten war, konnte man keinen Erkenntnisfortschritt erwarten. Auch die Medizin war weit davon entfernt, ein überzeugendes und nachprüfbares Bild vom Inneren des Menschen zu besitzen, noch viel weniger von den Funktionszusammenhängen der einzelnen Organe. Und so sind aus dieser Zeit allerlei Mythen und Heldensagen von Tauchern überliefert, auch zunehmend aus dem nordischen Raum, die sich durch die Jahrhunderte erhalten haben, jedoch keinen Beitrag zur Klärung medizinischer Zusammenhänge leisteten.
1.3 Das Zeitalter der Entdeckungen
Seit der Entdeckung Amerikas öffneten sich neue Horizonte für die Menschen Europas; Forschung wurde nicht mehr verteufelt, und die Medizin machte sich auf, mit wissenschaftlichen Methoden den Menschen zu entdecken und die Geheimnisse seiner Organsysteme zu entschlüsseln. Es war dem Physiker Boyle vorbehalten, im Jahre 1660 bei Tierexperimenten mit der gerade erfundenen Luftpumpe eine Zufallsbeobachtung zu machen, die im Nachhinein dem Formenkreis der neurologischen Dekompressionserkrankungen zuzurechnen ist: Im Auge einer kleinen Schlange, die er in einem Glaskolben einem erheblichen Unterdruck ausgesetzt hatte, beobachtete er eine sich bewegende Blase, während sich das Tier wie in Krämpfen wand. Als gewissenhafter Forscher verzeichnete er diese Beobachtung, konnte aber keine Erklärung dafür liefern. Erst 200 Jahre später wurde diese Textstelle für einen deutschen Mediziner Ausgangspunkt für eine schlüssige Erklärung der Dekompressionsproblematik. Ein Ergebnis der Forschungen von Boyle ist jedoch jedem Taucher präsent: Der reziproke Zusammenhang zwischen Umgebungsdruck und einem eingeschlossenen Volumen wird bei jedem Abtauchen und Wiederauftauchen eindrucksvoll, z. B. im Mittelohr, demonstriert.
1.4 Kolonialismus und Bergungstaucher
Der einsetzende Kolonialismus, d. h. die Ausbeutung der gerade entdeckten überseeischen Länder durch die europäischen Seefahrtsnationen, bewirkte im Nebeneffekt die Entstehung der eigentlichen Berufstaucherei. Es kam immer wieder zu Schiffsverlusten auf unbekannten Riffen und an nebligen Küsten, bei denen die oft sehr kostbare Ladung aus Übersee nicht dem Meer überlassen werden sollte. Zunächst mit den überlieferten Verfahren des Apnoetauchens versuchten wagemutige Männer, gegen hohe Prämien aus den relativ geringen Tiefen alles zu bergen, was sich zu Geld machen ließ oder für den Schiffsneubau zu gebrauchen war. Bald suchte man dann aber nach Methoden, die Einsatzdauer unter Wasser zu verlängern, und erprobte verschiedene Methoden, atembare Luft mitzunehmen oder nach unten zu schaffen. Am erfolgreichsten war dabei die Methode des englischen Astronomen Halley, der im Jahre 1690 ein glockenförmiges, unten offenes Holzfass mit Gewichten beschwerte und auf den Boden der Themse absenkte, wobei er und zwei weitere Männer aus der in dieser „Taucherglocke“ gefangenen Luft atmen konnten (Abb 1.1). Mittels kleinerer bleibeschwerter Fässer wurde immer wieder neue Luft von oben herabgelassen und in die Glocke entleert.
Abb. 1.1: Der englische Naturforscher Edmund Halley gilt als Erfinder der Taucherglocke (1690)
Die von den Männern berichteten Schmerzen in den Ohren stießen als Laienbeobachtungen in der örtlichen Ärzteschaft allerdings nicht auf weitergehendes Interesse.
Hinweis. Bei der Betrachtung der historischen Wechselbeziehungen zwischen Medizin und Tauchen ist bis heute immer wieder festzustellen, dass die medizinische Wissenschaft nur in ganz seltenen Fällen von sich aus Interesse an den pathophysiologischen Fragestellungen der Überdruckexposition zeigt. Nur wenn das öffentliche Interesse sich an gehäuften Zwischenfällen entzündete oder wenn militärische Fragestellungen unaufschiebbar waren, fanden sich Wissenschaftler, die sich mit einzelnen Aspekten dieser besonderen Arbeitsumwelt befassen mochten. Valsalva hat 1704 das nach ihm benannte Manöver nicht etwa für Taucher erfunden, sondern um bei Kindern mit Mittelohrentzündung nach Durchlöchern des Trommelfells den Eiter herauszublasen …
1.5 Verkehrswege und Druckluftarbeiter
Mitte des 19. Jahrhunderts nahm eine neue Technologie einen enormen Aufschwung, die letztendlich das Prinzip der Taucherglocke aufnahm und ins fast Gigantische steigerte: Die Caissontechnik ermöglichte es, unter Wasser trockenen Fußes z. B. Gründungspfeiler für Brücken über tiefe und breite Gewässer zu bauen, die für die Verkehrserschließung der alten und der neuen Welt erforderlich waren. Nachdem ein französischer Bergwerksingenieur bei einer überschwemmten Kohlengrube dieses Verfahren erfolgreich eingesetzt hatte, finden sich bei Pol und Watelle (1854) die ersten medizinischen Erörterungen über einige der dort aufgetretenen Probleme, wie die Einwärtswölbung der Trommelfelle und die Möglichkeit, den auftretenden Schmerz verschwinden zu lassen, die Verlangsamung der Pulsfrequenz, die druckfallbedingte Abkühlung der Schleusenluft und die erste Selbstbeschreibung von tagelang anhaltenden Gelenkbeschwerden. Es wurden kurze Zeit danach auch die ersten unerklärbaren Todesfälle bei den französischen Bergleuten, die in Überdruck gearbeitet hatten, beschrieben.
Angeregt von diesen Publikationen, unternahm der deutsche Physiologe Hoppe dann Tierexperimente, die Boyle schon vor ihm durchgeführt hatte, nur dass Hoppe daraus die richtigen Schlüsse zog: Er publizierte 1857 die noch heute gültige These, dass die Druckerniedrigung im Organismus Gasblasen freisetzen kann. Diese bewirken je nach Lokalisation unterschiedliche klinische Symptome, die durch erneutes Verbringen in Überdruck zum Verschwinden gebracht werden können. Trotzdem dauerte es noch vier Jahrzehnte, bis dieser Gedanke in der Caissonpraxis angewendet wurde. In der Zwischenzeit verloren viele Druckluftarbeiter ihr Leben oder fristeten ihr Dasein als Krüppel, so beim Bau der Mississippibrücke in St. Louis oder in New York, wo die örtlichen Druckluftärzte keine Vorstellung von der Entstehung oder der Behandlung der damals „Caissonkrankheit“ genannten Gesundheitsstörung hatten. Diese Baustellen brachten allerdings einen Begriff hervor, der heute jedem Sporttaucher geläufig ist: Wegen der gebeugten Schonhaltung, mit der die befallenen Arbeiter die Personenschleuse verließen und die an die damals angesagte Damenmode „(Grecian) Bend“ erinnerte, wurden sie von ihren Arbeitskameraden mit diesem Ausdruck verspottet, der heute im angelsächsischen Sprachgebrauch nicht nur für die (einfachen) Gelenk- und Muskelschmerzen verwendet wird, sondern sogar bis zu „skin-“ und „brain-bends“ verfremdet wurde (Abb 1.2).
Abb. 1.2: Eine Damenmode des 19. Jahrhunderts war Namensgeberin für die klassische Dekompressionspathologie
In Norddeutschland wurden bei diversen Caissonprojekten wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, und die Kieler Universitätsklinik trat unter Professor Quincke im Jahre 1889 mit einer ersten Doktorarbeit über die so genannte Druckluftlähmung an die Fachöffentlichkeit.
1.6 Höhenflüge und Sauerstoff
Zur gleichen Zeit zogen in Frankreich bei den sehr beliebten Ballonfahrten die unerklärlichen Zwischenfälle, die sich ereigneten, wenn bestimmte Höhen erreicht waren, das Interesse der Öffentlichkeit auf sich. Nachdem es dabei zu Todesfällen gekommen war, nahm der Inhaber des Physiologie-Lehrstuhls an der Pariser Sorbonne sich des Problems an. Paul Bert fand schnell heraus, dass es nicht die bloße Druckabnahme in der Höhe war, die sich lebensgefährlich auswirken konnte, sondern dass die damit einhergehende Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks für die eintretende Bewusstlosigkeit verantwortlich war. Nach seiner nahe liegenden Empfehlung, bei solchen Aufstiegen Sauerstoff in Glasflaschen mitzuführen und aus ihnen in der Höhe zu atmen, stellte er sich der Frage, wie denn Sauerstoff im Überdruck auf den Organismus wirken würde. Das Fazit seiner Experimente in Druckkammern an verschiedenen Tierspezies und auch an sich selbst war die heute allgemein nach ihm benannte zentralnervöse generalisierte Krampfneigung, ähnlich dem epileptischen Anfall. Es muss allerdings herausgestellt werden, dass die Drücke, mit denen diese Symptome erzeugt wurden, sich in Bereichen bewegten, die sehr unrealistisch waren (zum Teil bis über 8 bar mit fast reinem Sauerstoff). Daher haben seine Ergebnisse für über hundert Jahre die tauchmedizinische Forschung eher nachteilig beeinflusst, weil die daraus abgeleitete Sauerstoffphobie, zusammen mit der Erhöhung des Brandrisikos, die segensreiche Nutzung des Sauerstoffs als Dekompressionsgas, vor allem in der Druckluftarbeit, bis heute in vielen Ländern ausschließt.
1.7 Die Royal Navy wacht auf
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die entscheidenden Impulse für die ärztliche Beschäftigung mit Fragen der Überdruckexposition von der Anwendung der Caissontechnik ausgegangen. Zum einen hatte man die Baustellen praktisch vor Augen, während das Geschehen auf See wenig Aufmerksamkeit erhielt; der Hauptgrund war allerdings die Dosisabhängigkeit der Caissonkrankheit. Das Ausmaß der Übersättigung ist abhängig vom einwirkenden Druck und der darin verbrachten Zeit. Zwar waren die Caissonarbeiter im Allgemeinen in geringeren Drücken als die Taucher beschäftigt, aber ihr Arbeitstag war deutlich länger, so dass die Menge des aufgenommenen Stickstoffs für die Auslösung des bekannten Spektrums an Symptomen ausreichend war. Erst als die in der Taucherei üblichen Handpumpen durch mechanisch angetriebene Kompressoren ersetzt wurden und die Möglichkeit, Druckluft in eisernen Flaschen aufzubewahren, den Tauchern deutlich größere Einsatztiefen und eine längere Verweildauer ermöglichten, kam es um die Wende zum 20. Jahrhundert in Großbritannien zu einer Häufung von Taucherkrankheiten, die man bis dahin nur aus der Caissonarbeit kannte. Der Anlass dafür war ein militärischer: Die Erprobung des Torpedos als Unterwasserwaffe führte zu zahlreichen Verlusten dieses teuren Geräts in erheblichen Wassertiefen, so dass die Marinetaucher in bis dahin für unerreichbar gehaltene Drücke absteigen mussten.
Der englische Marineminister beauftragte seinen Bruder John Haldane, den berühmtesten britischen Physiologen seiner Zeit, mit einem umfangreichen Forschungsprogramm zur Aufklärung dieser Zwischenfälle und der Ausarbeitung von Präventionsmaßnahmen. Dafür standen ihm fast unbeschränkte Mittel an Menschen und Material zur Verfügung. Ausgehend von der täglichen Tauchererfahrung, dass ein Aufenthalt bis maximal etwa 10 m Wassertiefe nach dem Auftauchen keinerlei Gesundheitsprobleme auslöste, und zwar unabhängig von seiner Dauer, postulierte Haldane, dass der menschliche Organismus offenbar eine Halbierung des Umgebungsdrucks toleriert, ohne dass klinisch fassbare Symptome auftreten.
Haldane war der Erste, der den Körper in fünf fiktive Kompartimente mit unterschiedlich langen „Halbwertszeiten“ einteilte, und schuf auf dieser Basis die ersten Austauchtabellen, wobei die stufenweise Dekompression im Vergleich zur linearen sich als praktikabler erwies. Die von ihm gewählte Einteilung in 10-Fuß-Abstände findet sich noch heute weltweit; im deutschen Sprachraum wurde sie in 3-Meter-Stufen umgerechnet. Er testete diese Tabellen zunächst in einer Druckkammer mit Ziegen (Abb 1.3), nachdem sich Hunde als ungeeignet herausgestellt hatten (sie simulierten Bends, weil sie gelernt hatten, dass sie dann aus den Tests herausgenommen wurden), und setzte die Erprobungen danach mit Navy-Tauchern im offenen Wasser in seiner schottischen Heimat fort. Die Aussagekraft dieser Expositionen bleibt indes fragwürdig, weil es sich um ausgesuchte, d. h. positiv selektionierte Taucher handelte, die unter Wasser keine Arbeit im physikalischen Sinne verrichteten, sondern mit dem Kran abgesenkt und nach einer bestimmten Zeit unter Einhaltung der vorher festgelegten Stufen wieder aufgewinscht wurden. Sofern sich bei mehreren Tauchern dabei gesundheitliche Störungen zeigten, wurden die Zeiten entsprechend modifiziert. Die Tabellen reichten bis in eine Wassertiefe von knapp 70 m, wofür nach einem Aufenthalt von maximal 12 min eine Dekompressionsdauer von 32 min vorgesehen war. Die US-Marine wiederholte diese Tests 10 Jahre später vor Hawaii; als Ergebnis wurde das erste U.S. Navy Diving Manual veröffentlicht, das jahrzehntelang auch für die internationale Berufstaucherei Maßstäbe setzte. Einer davon war die in den Tabellen vorgeschriebene maximale Auftauchgeschwindigkeit von 18 m pro Minute, die keiner wissenschaftlichen Überlegung entsprang, sondern durch die Leistung des verwendeten Bordkrans von 60 Fuß/min vorgegeben war (Abb 1.4).
Abb. 1.3: Versuchstiere leisteten einen entscheidenden Beitrag zur Erprobung der ersten Austauchtabellen (Haldane 1908)
Abb. 1.4: Erprobung der US-Navy Diving Tables (1915): Der Bordkran benötigte eine Minute für 60 Fuß = 18 Meter
1.8 Hundert Jahre medizinische Tauchforschung
Die technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Überdruckexposition hatten im Verlauf des 19. Jahrhunderts viele medizinische Fragen aufgeworfen, die nur ansatzweise von der Wissenschaft geklärt werden konnten. Es handelte sich ja im weitesten Sinne um arbeitsmedizinische Herausforderungen, denn es ging um den Schutz der Taucher und Druckluftarbeiter vor den gesundheitlichen Risiken und Folgen ihrer Tätigkeit. Nur wer sich exponierte, war gefährdet; aber die Arbeitswelt war schon damals voller Gefahren, und die Aufgeschlossenheit der wissenschaftlichen Medizin gegenüber diesen Fragen war wenig ausgeprägt.
Allerdings gilt dies nicht für den Bereich der militärischen Taucherei: Hier wurde von den führenden seefahrenden (englischsprachigen) Mächten schon früh in Forschung investiert; nicht zuletzt trug die zunehmende Bedeutung der UnterwasserKriegsführung dazu bei. Während im gewerblichen Bereich die gesundheitlichen Voraussetzungen für Berufstaucher nur vage definiert waren, ging es bei der Frage der militärischen „Tauglichkeit“ um die Vorhersage künftiger Bewährung bei bestimmten Einsatzanforderungen.
Die führende Position der US-amerikanischen Marine zeigt sich schon an der Aufzählung wichtiger Entdeckungen und Verfahren, die seit den zwanziger Jahren weltweiten Einfluss hatten:
■ 1919: Erprobung von Helium als Inertgas zur Verringerung des Atemwiderstands in großen Tiefen;
■ 1931: Erkennung der arteriellen Luftembolie als eigenständiges Krankheitsbild (Folge der Lungenüberdehnung bei U-Boot-Rettungsübungen);
■ 1935: Aufklärung des Phänomens „Tiefenrausch“ als stickstoffinduziert durch den US-Marinearzt Behnke (noch in den Sechzigern beharrte der führende deutsche Anästhesiologe [Prof. R. Frey] öffentlich auf der konkurrierenden CO2-Theorie);
■ 1936: Anwendung von Sauerstoff bei 2 bar Überdruck als Therapiegas bei der Rekompression von Bends;
■ 1939: operativer Einsatz von Helium zur Vermeidung der Stickstoffeffekte bei Einsätzen über 70 m mit Sauerstoffdekompression im Wasser;
■ 1957: Formulierung des Prinzips „Sättigungstauchen“ durch Bond;
■ 1969: Experimente zur Flüssigkeitsatmung durch Kijlstra.
Auch in zahlreichen zivilen Einrichtungen wurde im Auftrag und mit Geldmitteln der US-Marine geforscht, wie zu Fragen der maximal tolerierbaren Sauerstoffdosis, der größten erreichbaren Tauchtiefe, bei der Menschen noch einsatzfähig sein würden, oder der Wassertiefe, aus der ein Aufstieg nach Sättigung in Luft noch ohne Dekompressionsstopps möglich sein würde. Bei allen Projekten in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war ohne Zweifel der „Kalte Krieg“ der Motivationsfaktor; für den zivilen Bereich ergab sich nur wenig Stimulation. Eine Ausnahme sollte die Arbeit von Bühlmann bleiben, der zunächst mit Keller zusammen auf die Finanzmittel und die Einrichtungen der US-Marine angewiesen war, aber dann in Zürich eine bis heute nachwirkende Forschungsseinrichtung etablierte.
Kompaktinformation
Erst das 20. Jahrhundert hat die Tauch- und Überdruckmedizin als Spezialität hervorgebracht, wobei in der ersten Hälfte die Tauchmedizin militärisch dominiert und definiert war, während die Arbeit in Druckluft in die Zuständigkeit der sich allmählich emanzipierenden Arbeitsmedizin fiel. Es gab weltweit zu keiner Zeit eine Institution, die für alle Aspekte der Überdruckexposition, sei es trocken oder nass, eine umfassende Zuständigkeit reklamieren konnte, so dass bis heute nur einzelne Mosaiksteine zusammengetragen wurden, die noch immer kein kohärentes Bild ergeben.
In Großbritannien waren ebenfalls die Streitkräfte auf dem Forschungssektor aktiv; durch die zunehmende Einsatzhöhe der Kampfflugzeuge rückte die Frage der Langzeitsauerstoffexposition in den Vordergrund, wobei sich der Sohn von Haldane als Wissenschaftler profilierte. Für die im 2. Weltkrieg zuerst von Italien, dann auch von Großbritannien und Deutschland eingesetzten Kampfschwimmer war ebenfalls die Frage der Sauerstofftoleranz von lebenswichtiger Bedeutung.
Ebenso wurde die technische Entwicklung von kleinen, autonomen Drucklufttauchgeräten nebst Zubehör wie Maske, Flossen und Harpunen, die sich im mediterranen Frankreich der 30er und 40er Jahre vollzog und die Voraussetzung für die Etablierung einer Freizeitaktivität war, die heute als Sporttauchen bezeichnet wird, maßgeblich von drei Marineoffizieren, nämlich LePrieur, Tailliez und Cousteau vorangetrieben.
Die deutsche Marine hatte erst spät die Bedeutung von U-Boot- und tauchmedizinischer Forschung erkannt. Nur wenige relevante Beiträge sind überliefert und verschwanden nach dem 2. Weltkrieg in den Archiven der Alliierten, die sich zusätzlich auch die wenigen namhaften Forscher für ihre eigenen Dienste sicherten. In der Bundesrepublik Deutschland wurde bereits mit Beginn der Wiederbewaffnung die Notwendigkeit für eine marineeigene Untersuchungs- und Forschungskapazität, die sich mit allen Taucherfragen befassen sollte, erkannt; das daraus (nach einigen Vorläufern seit 1957) entstandene Schifffahrtsmedizinische Institut der Marine hat unter seinen Leitern Wandel und Seemann nicht nur die tauchende Bundeswehr, sondern fast dreißig Jahre lang auch den zivilen Bereich des gewerblichen Tauchens und der Druckluftarbeit maßgeblich mitgestaltet: Die in der Berufstaucherei als Austauchtabellen eingeführten Verfahren waren bis zum Ende der 80er Jahre deckungsgleich mit den Tabellen der Bundeswehr; die gesundheitlichen Eignungsvorschriften (der sog. „G 31“) waren zunächst überwiegend von Marineärzten ausgestaltet worden, die ebenfalls in den einschlägigen Ausschüssen der Arbeitsschutzverwaltungen und zuständigen Berufsgenossenschaften maßgeblich vertreten waren. Die Anfänge der hyperbaren Sauerstofftherapie waren ebenfalls dort zu finden – gleichermaßen die Initiative zur Gründung der deutschen tauchmedizinischen Fachgesellschaft (1984) – und wenn man gegenwärtig die Liste der hierzulande publizistisch aktiven Tauchmediziner betrachtet, so findet sich bei ihnen zum überwiegenden Teil eine, wenn auch manchmal kurze, Marinehistorie; die Tendenz ist jedoch abnehmend.
In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts setzte dann eine Entwicklung ein, deren Dynamik gewisse Parallelen zum Goldrausch hundert Jahre früher aufweist: Es begann die Erkundung und Gewinnung von Erdöl und Erdgas im so genannten Offshore-Bereich, zunächst in der Nordsee, später auch im Golf von Mexiko, vor Brasilien, Indien usw. Dieser Bereich erstreckt sich bis in 200 m Wassertiefe und war ohne Taucher nicht zu erobern. Besonders in der Nordsee ereigneten sich in den ersten wilden Jahren gravierende Zwischenfälle, die häufig tödlich ausgingen, so dass schon bald die Regierungen der Anliegerstaaten zusammen mit den Betreibern der Exploration nach Problemlösungen suchten. Es entstanden zahlreiche üppig ausgestattete Einrichtungen mit einem breit angelegten Forschungsspektrum; darunter auch in Geesthacht bei Hamburg und Porz bei Köln, obwohl Deutschland bei der Verteilung der Ölvorkommen leer ausgegangen war. Regelmäßige internationale Tagungen sorgten für regen Austausch von Gedanken und Daten, allerdings stark dominiert von den englischsprechenden Ländern. Inzwischen hat diese Dynamik erheblich nachgelassen; durch Mittelkürzungen sind einige Einrichtungen geschlossen worden, andere arbeiten mit reduziertem Personal weiter; Deutschland hat sich aus diesem Forschungsgebiet gänzlich verabschiedet.
Es war vor 30 Jahren kaum absehbar, dass der relativ überschaubare, weltweit aktive Kreis von Taucherärzten innerhalb kurzer Zeit von einer neu entstandenen Fachrichtung überdruckexponierter Mediziner nicht nur zahlenmäßig dominiert werden sollte: Mit der weltweit exponentiellen Zunahme hyperbarer Behandlungseinrichtungen, die die von der Tauchmedizin etablierte segensreiche Wirkung des Sauerstoffs im Überdruck auf eine Fülle von mehr oder weniger plausiblen Indikationen übertrugen, veränderte sich auch das internationale Erscheinungsbild der Tauchmedizin. Aus vielen HBO-Zentren kamen allerdings im Laufe der Zeit auch für die Taucherei nützliche Erkenntnisse, und ihre wichtige Funktion für die Behandlung akuter Druckfallerkrankungen ist unbestritten.
1.9 Zukünftige Herausforderungen
Die aktuelle Situation der Tauchmedizin in Deutschland lässt sich etwa so beschreiben: Der gewerbliche Bereich umfasst eine über die Jahre relativ konstant bleibende Zahl von einigen hundert Exponierten, deren Arbeit durch einschlägige Regularien sicherheitsoptimiert ist, wobei die überwiegende Mehrheit selten tiefer als 10 m tätig ist. Dort besteht mehr Fortbildungs- als Forschungsbedarf.
Die gesundheitlichen Herausforderungen und Risiken der Arbeit in Druckluft, die anfänglich die Tauchmedizin wesentlich stimuliert hatten, stellen gegenwärtig nur einen peripheren und auch weltweit vernachlässigten Aspekt der Überdruckmedizin dar. Das steht in deutlichem Gegensatz zum tatsächlichen Bedarf einer Branche, die auf der ganzen Welt unter Anwendung der 150 Jahre alten Drucklufttechnik immer tiefere und längere Tunnel für das steigende Verkehrsaufkommen der Ballungsräume und Wirtschaftszentren baut.
Die tauchmedizinische Forschung beschäftigt sich auch weltweit inzwischen fast ausschließlich mit den Herausforderungen von Millionen von Sporttauchern. Dieser Bereich zeigt ein ungebrochenes Wachstum, wobei die technische Weiterentwicklung der Ausrüstung mittlerweile extreme Möglichkeiten bietet, was die Tiefe und Dauer von Unterwasserexkursionen betrifft. Die Akzeptanz des Tauchcomputers als Sicherheitsfaktor und Schutzengel lässt auch den weniger Erfahrenen schneller an seine individuellen Grenzen kommen und darüber hinaus vorstoßen.
Das Jahrtausende alte Apnoetauchen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Extremsportart entwickelt und überrascht die Medizin mit Rekordleistungen, die mit überkommenen Vorstellungen nicht zu erklären sind. Höhlentaucher erarbeiten sich individuelle Dekompressionsprofile, die eine Vielzahl differenzierter Gasgemische erfordern: eine logistische Herausforderung, die keine Fehler verzeiht. Die Verwendung von Nitroxgemischen wird zunehmend selbstverständlich, wobei der ursprünglich beabsichtigte Sicherheitszuwachs leicht ins Gegenteil umschlagen kann.
In der inzwischen deutlich zurückgegangenen Zahl hyperbarer Behandlungseinrichtungen spielen Aspekte der Tauchmedizin für Patienten und Begleiter wohl eine entscheidende Rolle, vor allem das Barotrauma und die Toxizitätsgrenzen des hyperbaren Sauerstoffs, die aber inzwischen überall zur Routine zählen dürften. Die zentralen Fragen der Indikationsstellung, der Durchführung der Behandlung und Verlaufskontrolle fallen dann in die jeweiligen organsystemorientierten klinischen Fächer.
Das Fehlen einer universitären Fachinstitution, an der sich die Tauch- und Überdruckmedizin im öffentlich-rechtlichen Rahmen orientieren könnte, hat in den letzten Jahren zu der erfreulichen landesweiten Vielfalt von individuellen Beiträgen aus Kliniken und Praxen geführt, die überwiegend aus persönlichem Interesse und Anteilnahme am Tauchsport oder auch durch die klinische Konfrontation mit gesundheitlichen Problemen von Tauchern entstanden sind. Dabei muss inzwischen der fließende Übergang zu den nichtmedizinischen Fächern nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern als Erweiterung der eigenen Kompetenz begrüßt werden: Die moderne Tauchmedizin braucht den Input von Psychologen, Verhaltensforschern, Soziologen und auch Juristen, um die Erwartungen, die zu Recht an sie gestellt werden, umfassend zu erfüllen.
Die Tauchmedizin bleibt für alle beteiligten Fachexperten eine permanente und faszinierende Herausforderung, weil diese noch weit davon entfernt sind, auf zum Teil Jahrhunderte alte Fragen eine überzeugende Antwort zu wissen: Was sind z. B. „bends“? Wir können sie beschreiben, behandeln, auch verhüten, aber nicht im Letzten erklären.
Das frühere Bemühen einzelner Autoren, das gesamte Gebiet der Pathophysiologie des Tauchens abzudecken, hat schon lange in der Medizin keinen Platz mehr, und so gilt es, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken und durch Strukturen wie Fachgesellschaften und wissenschaftliche Veranstaltungen den Erkenntnisgewinn und den Output für die Nutzer zu optimieren. Der Volkssport Tauchen wird dieses Fach zu neuer Bedeutung bringen, weit über die bisherige militärische und gewerbliche Perspektive hinaus.
Weiterführende Literatur ____________________________
1. Bert P: Barometric Pressure. Columbus, Ohio, 1943 (Reprint Bethesda, Maryland 1978 der engl. Übers. von M.A. und F.A. Hitchcock; Original: La Pression Barométrique, Recherches de Physiologie Experimentale. Paris 1878)
2. Davis RH: Deep diving and submarine operations. Siebe, Gorman & Co., Cwmbran (Reprint 1981)
3. Haldane JS, Boycott AE, Damant GCC: The prevention of compressed-air illness. J Hyg 1908; 8: 342–443
4. Heller R, Mager W, v. Schroetter H: Luftdruckerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten Caissonkrankheit. Bd. 1-2. Hölder, Wien, 1900
5. Stelzner H: Tauchertechnik. Coleman, Lübeck, 1931