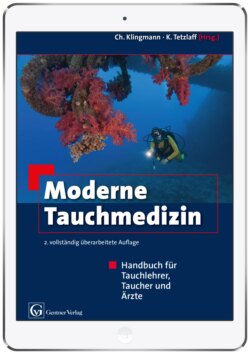Читать книгу Moderne Tauchmedizin - Kay Tetzlaff - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3 Temperaturhaushalt
H. Liedtke
Die Möglichkeit einer Überhitzung während eines Tauchganges mit einer kritischen Erhöhung der Kernkörpertemperatur ist im Bereich des Sportauchens unter Verwendung angepasster Ausrüstung auch unter tropischen Bedingungen faktisch nicht gegeben. Auch bei Temperaturen von 30 °C ist das Wasser mit seiner hohen Wärmeleitfähigkeit ein Medium, das dem Körper Wärme entzieht. Dennoch besitzt das Sporttauchen in warmen Regionen einige Besonderheiten, die durchaus direkte medizinische Relevanz haben.
Anders als im Sporttauchen verhält es sich, wenn im Bereich des Berufstauchens zum Kontaminationsschutz beim Tauchen z. B. in Faultürmen von Klärwerken oder anderen sehr warmen Einsatzorten Trockentauchzüge und Taucherhelme getragen werden müssen. Unter solchen extremen Umständen ist eine Überhitzung des Tauchers durchaus möglich.
Fällt die Kernkörpertemperatur eines Menschen auf einen Wert unter 35 °C sprechen wir von einer Hypothermie. Dabei unterscheidet man die medizinisch induzierte künstliche Hypothermie, die bei bestimmten Operationen am offenen Herzen oder bei der Behandlung von Patienten nach Reanimation Anwendung findet, von der unabsichtlichen bzw. akzidentellen Hypothermie. Dass die Hypothermie auch günstige Effekte haben kann, ist eine wichtige Erkenntnis für das Verständnis der Reanimation von Ertrinkungsunfallopfern und/oder schwer hypothermen Patienten. Nur die rasch einsetzende Hypothermie ist es, die es dem Nervengewebe des Gehirns trotz Kreislaufstillstand möglich macht, Sauerstoffmangel deutlich länger ohne Schädigungen zu überstehen. Dadurch ist es immer wieder zu beobachten, dass Patienten auch nach langer Zeit unter Wasser ohne bleibende Schäden gerettet werden. Die Hypothermie ist sehr häufig mit Ertrinkungsunfall assoziiert. Dabei kann die Hypothermie Ursache oder Folge des Ertrinkungsunfalls sein (s. Kap. 12).
3.1 Überhitzung (Hyperthermie)
3.1.1 Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
Beim gesunden Menschen liegt die normale Körpertemperatur zwischen 36 und 37 °C. Alle lebenswichtigen Vorgänge unseres Körpers laufen nur optimal in diesem engen Regelbereich. Schwankungen nach oben sind mit Erreichen von Temperaturen dauerhaft über 40,6 °C nicht mit dem Leben vereinbar. Zum Regelwerk der Temperatursteuerung gehören vor allem die hypothalamische Region des Gehirns, die Temperatursensoren der Haut, Schweißdrüsen, Blutgefäße und die Atmung. Steigt die Umgebungstemperatur, wird durch Schwitzen Verdunstungskälte erzeugt und über weitgestellte Blutgefäße Wärme abgegeben. Werden diese Mechanismen überfordert, kommt es zur Überhitzung und nachfolgend zum Kreislaufversagen durch Hitzekollaps. Gelingt es nicht, die Kernkörpertemperatur von 40,6 °C zu senken, kann es durch einen so genannten Hitzschlag zum Multiorganversagen mit häufig tödlichem Ausgang kommen.
3.1.2 Gefahren beim Tauchen in warmem Wasser bzw. warmen Regionen
Dehydratation. Die Dehydratation (Austrocknung) hat praktische Relevanz für das Tauchen in warmen Regionen und ist als schwerwiegender Kofaktor in der Entstehung einer Dekompressionserkrankung anzusehen.
Eine wesentliche Ursache der Dehydratation ist eine dem warmen Umfeld nicht adaptierte Tauchausrüstung. Taucher aus Mitteleuropa reisen mitunter mit 7-mm-Neopren-Anzügen in tropische Tauchdestinationen, legen diese viel zu lange vor dem Tauchgang an (da sie z. B. als Neulinge auf einem Tauchboot glauben, schnell angezogen sein zu müssen, obwohl noch 45 min Fahrt vor ihnen liegen) und verlieren in dieser Zeit enorm an Flüssigkeit durch die regulatorisch einsetzende erhöhte Schweißsekretion.
Außerdem ist unter solchen Umständen die Entwicklung eines Hitzekollapses vor dem Tauchgang gegeben. Die Taucher werden plötzlich bewusstlos und weisen einen kaum tastbaren Puls auf.
Therapie. Meistens kann durch das Anheben beider Beine wieder genügend Blut in den Kreislauf zurückverlagert und das Bewusstsein wiedererlangt werden. Die weitere Behandlung besteht im sofortigen Ausziehen des Tauchanzuges und in der Kühlung der Körperoberfläche durch Verdunstung von Wasser (feuchte Handtücher, angefeuchtete leichte Kleidung, kühle Dusche, kühle Luftzufuhr) und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.
Wichtiger ist jedoch die einfache Prävention solcher Situationen durch angepasste Tauchausrüstung und deren An- und Ablegen zu einem Zeitpunkt kurz vor und nach dem Tauchgang. Weiterhin ist die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme durch den Taucher vor und nach dem Tauchgang eine zentrale präventive Maßnahme. Aus tauchmedizinischer Sicht kann Tauchern nur empfohlen werden, auf diesen Umstand sorgfältig zu achten.
Hinweis. In den von der Klinik des Autors betreuten tauchmedizinischen Zentren auf den Malediven und den Seychellen propagieren wir gemeinsam mit den ansässigen Tauchbasen das „Two-Tank“-Prinzip: „One for air and one for water“. Dem Taucher wird damit vermittelt, die gut gefüllte Trinkflasche als selbstverständlichen Bestandteil seiner tropischen Tauchausrüstung zu betrachten.
3.1.3 Sonnenstich
Eine Sonderform der hyperthermen Krankheitszustände ist der isolierte Hitzschlag des Kopfes, auch als Sonnenstich oder Heliosis bezeichnet. Dieser wird durch die direkte Einstrahlung (langwelliger Lichtbereich bzw. Wärmestrahlung) von Sonnenlicht auf den unbedeckten Kopf und Nacken ausgelöst und entspricht mit den resultierenden Symptomen dem klinischen Bild einer Hirnhautentzündung (Meningitis). Typisch sind Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, Nackenschmerzen (Meningismus), Müdigkeit und starkes Krankheitsgefühl. In der Akutphase ist die Körpertemperatur dabei fast immer normal. Hervorzuheben ist, dass vor allem Kleinkinder durch ihr, gegenüber Erwachsenen, relativ großes Kopfvolumen und die große Kopfoberfläche, verbunden mit spärlichem Haarwuchs, in den ersten Lebensjahren besonders gefährdet sind. Personen mit Glatze oder extrem kurzen Haar sind ebenfalls stark gefährdet. Die Prophylaxe besteht im Tragen einer geeigneten Kopfbedeckung bzw. im Vermeiden direkter Sonneneinstrahlung auf den Kopf.
Therapie. Ist es zu einem Sonnenstich gekommen, wird der Betroffenen von sich aus die Bettruhe suchen. Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol als Tablette oder Zäpfchen können und sollten gegeben werden. Die Symptome klingen dann innerhalb von 24 h stark ab und der Patient bedarf keiner weiteren Behandlung. Entscheidend ist jedoch, dass der Patient kein Fieber hat und tatsächlich eine erhebliche Menge Sonnenstrahlen abbekommen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, der Patient aber sonstige Sonnenstichsymptome zeigen, muss der Patient dringend einer ärztlichen Untersuchung bzw. Behandlung zugeführt werden, da möglicherweise eine viel gefährlichere Hirnhautentzündung (Meningitis) als Sonnenstich fehlgedeutet werden könnte.
Hinweis. Sonnenstichsymptome in Kombination mit Fieber können vor allem bei Kindern auf eine Meningitis hindeuten und müssen dringend ärztlich abgeklärt werden.
Fallbeispiel. Ein junges Ehepaar aus Mitteleuropa reist mit seinem 6 Monate alten Säugling auf die Malediven zum Tauchurlaub. Da das Kind an den gemeinsam durchgeführten Tauchgängen nicht teilnehmen kann, wird es mit Sonnenschutzcreme behandelt und nackt in einem Kinderwagen ohne Kopfbedeckung und ohne Obhut im Schatten der Ufervegetation am Strand vorübergehend abgestellt. Die Eltern des Kindes haben jedoch nicht bedacht, dass bei ihrer zweistündigen Abwesenheit (14.00 bis 16.00 Uhr) sich die Sonnenposition ändert und damit auch der Schattenbereich. Somit ist das Kind wahrscheinlich ca. 45 min direkt der äquatorialen Sonne ausgesetzt. Gegen 22.00 Uhr wird dann das sehr krank wirkende Kind einem Arzt vorgestellt, der die Symptome einer Hirnhautentzündung diagnostiziert und eine umgehende Verlegung in ein örtliches Krankenhaus vornimmt. Dies geschieht auch deshalb, weil auf die Nachfrage des Arztes, ob das Kind zu viel Sonne abbekommen haben könnte, die Eltern wegen ihres offenbar entstandenen Unrechtsbewusstseins, dieses verneint haben. Der ärztliche Kollege hat somit die einzig richtige Entscheidung getroffen und das Kind einer Krankenhausbehandlung zugeführt, auch wenn sich nachträglich herausstellte, dass dies so nicht notwendig gewesen wäre.
3.2 Unterkühlung (Hypothermie)
3.2.1 Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
Anders als bei der Erhöhung der Körpertemperatur, die mit der Temperatur von 42,8 °C ein tödliches Maximum erreicht, ist bei der Unterkühlung ein wesentlich größerer Wechsel des Temperaturbereichs überlebbar. Dennoch gilt auch hier, dass bei Unterschreiten der normalen Kernkörpertemperatur von 36–37 °C der menschliche Organismus zunehmend funktionellen Einschränkungen unterliegt, die im Extremfall tödliche Auswirkungen haben können. Um den Körper vor Auskühlung zu schützen, wird über den Hypothalamus u. a. das Kältezittern aktiviert. Zittern ist eine spezielle Form muskulärer Aktivität, die dazu dient, Wärme zu produzieren.
Überlebenszeiten im Wasser
In Tabelle 3.1 ist zu erkennen, dass mit steigender Wassertemperatur die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich ansteigt. Viele Todesfälle treten deshalb auf, weil durch das Schwimmversagen aufgrund erkaltender Muskulatur, verminderter Nervenleitfähigkeit und mangelnder Bewegungskoordination das Opfer in eine aufrechte Position im Wasser kommt und das Gesicht des erschöpften Opfers ins Wasser einbzw. untertaucht und dann zu seinem Ertrinken führt. Die Kernkörpertemperatur ist in diesen Fällen noch nicht kritisch gesunken! Mit einer geeigneten Auftriebshilfe, die den Körper in einer ohnmachtssicheren Lage hält (z. B. aufgeblasene Tarier- bzw. Schwimmweste mit Kragen), können deutlich höhere Überlebenszeiten erreicht werden. Unterkühlung kann aber auch von Vorteil sein, da das Gehirn im unterkühlten Zustand weniger Sauerstoff benötigt. Überlebt wurden beispielsweise Zeiten von bis zu 60 min unter Wasser, bis zu 390 min Dauer einer Herz-Lungen-Wiederbelebung und bis 13,7 °C Körperkerntemperatur (Gilbert et al. 2000).
Tabelle 3.1: Zeit, die bis zur Rettung vergehen kann bei einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 50 % (Oakley u. Pethybridge 1997)
| Wassertemperatur | Molnar (1946) | Golden (1976) | Hayward (1975) | Tikuisis (1994) | Mit Auftriebshilfe |
| 5 °C | 1,0 h | 1,0 h | 2,2 h | 2,2 h | 17 |
| 10 °C | 2,2 h | 2,0 h | 2,9 h | 3,6 h | >24 |
| 15 °C | 5,5 h | 6,0 h | 4,8 h | 7,7 h | >24 |
Individuelle Einflüsse und Kofaktoren
Das Verhältnis zwischen Körperoberfläche und Körpermasse ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Ausbildung einer Unterkühlung. Kinder haben beispielsweise eine relativ große Körperoberfläche im Vergleich zur geringen Körpermasse und kühlen daher wesentlich schneller aus. Taucher mit wenig Körperfett sind eher gefährdet zu unterkühlen als Taucher mit einem hohen Körperfettanteil.
Reglos im Wasser zu treiben bedeutet, einen geringeren Wärmeverlust zu haben als bei hektischen Bewegungen. Deshalb wird empfohlen, sich im kalten Wasser ohne Aussicht auf Selbstrettung möglichst nicht zu bewegen, sofern geeignete Auftriebsmittel zu Verfügung stehen.
Hinweis. Aus Einzelfallberichten Geretteter (Estonia-Katastrophe 1994) ist bekannt, dass diese einen Hauptgrund für ihr Überleben in ihrer starken mentalen Verfassung sahen, die mit dem unbedingten Willen verbunden war, bis zur Rettung durchzuhalten.
Menschen, die zum Zeitpunkt des einsetzenden Kältereizes stark alkoholisiert sind, spüren häufig noch ein Wärmeempfinden oder frieren nicht so stark. Diese Beobachtung führt leider immer wieder zu der Interpretation, dass Alkohol eine Hypothermie verhindern kann oder diese schneller beendet. An dieser Stelle sei betont, dass das wohlige Wärmeempfinden im Bauch bei der Aufnahme von hochprozentigem Alkohol keinerlei Erhöhung der Körpertemperatur herbeiführt. Die zentrale Wirkung des Alkohols basiert auf einer Veränderung der „Sollwertgröße“ im Hypothalamus des zentralen Nervensystems. Dieses körpereigene Temperaturkontrollzentrum wird durch Alkohol lediglich „verstellt“, so dass das Kälteempfinden und auch das Einsetzen des Zitterns verzögert bzw. ausgeschaltet werden. Dadurch wird die Phase der leichten Hypothermie von den unterkühlten Patienten nicht erlebt und diese werden infolgedessen nicht rechtzeitig nach wärmenden Möglichkeiten suchen. Im Falle des Tauchens würde das bedeuten, dass ein alkoholisierter Taucher einen Tauchgang wegen fehlender starker Kälteempfindungen nicht schnell genug abbrechen könnte und sich somit in die ernste Gefahr einer Hypothermie begibt.
Hinweis. Alkohol wärmt nicht und begünstigt das Entstehen einer gefährlichen Unterkühlung!
3.2.2 Wärmeprotektion beim Sporttauchen
Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Wasser (25fach höher als die von Luft) und die hohe spezifische Wärme ist es notwendig, in einem Temperaturbereich zwischen 0 und 30 °C Maßnahmen zu treffen, die einen ausreichenden Wärmeschutz sicherstellen. Bei einem 60-minütigen Tauchgang in 30 °C warmen Wasser sind diese natürlich weniger wichtig als bei einem Tauchgang in sehr kaltem Wasser. Grundsätzlich gilt es dabei jedoch zu beachten, dass bei extrem langem Aufenthalt auch in relativ warmem Wasser eine Hypothermie entstehen kann.
Nasstauchanzüge sind die am häufigsten benutzten Tauchanzüge im Sporttauchbereich. Durch die im Neopren eingelagerten Luftblasen entsteht eine Isolationsschicht, die vor Auskühlung schützt. Zusätzlich entsteht durch das zwischen dem Anzug und der Haut vom Körper aufgewärmte eingeschlossene Wasser eine weitere Isolationsschicht. Nachteilig ist jedoch, dass gemäß dem Gesetz von Boyle-Mariotte die Gasblasen des Neoprens mit zunehmender Tauchtiefe kleiner werden und somit die Wärmeprotektion der Anzüge sinkt. Hersteller solcher Anzüge bieten diese in verschiedenen Dicken von 0,5–7 mm Neopren an.
Trockentauchanzüge sind am effektivsten zur Wärmeprotektion bei längerem Aufenthalt in sehr kaltem Wasser. Der Körper ist hier in einer eingeschlossenen trockenen Luftschicht und kann darüber hinaus noch mit warmer bzw. heizbarer Unterkleidung effektiv gegen Auskühlung geschützt werden. Das Tauchen mit einem solchen Anzug macht jedoch besondere Fertigkeiten und Kenntnisse des Tauchers notwendig, da die Luft im Anzug beim Ab- und Auftauchen abgelassen bzw. zugeführt werden muss.
Ein wesentliches Problem der Wärmeprotektion bei extrem langen Tauchgängen in Trockentauchanzügen ist durch die Urinausscheidung gegeben. Gelingt es nicht, den Urin durch spezielle Ventile aus dem Tauchanzug heraus bzw. in einem geschlossenen System zu halten, kommt es zur Feuchtigkeitsansammlung im Anzug und damit zu erheblichem Wärmeentzug.
Grundsätzlich sind beide Typen von Tauchanzügen geeignet, vor gefährlicher Hypothermie zu schützen. Im Ernstfall sichern die Anzüge über Stunden im eiskalten Wasser das Überleben, während ohne Wärmeschutz die Überlebenszeit nur kurz wäre.
Hinweis. Wichtig ist bei Kaltwassertauchgängen, auch die Hände ausreichend vor Auskühlung zu schützen, damit nicht durch Kälteeinwirkung die resultierende Gefühllosigkeit und die Bewegungseinschränkung der Hände zu Schwierigkeiten beim Bedienen der Tauchausrüstung führen.
3.2.3 Wie erkennt man eine Hypothermie?
Die Einteilung der Hypothermie in verschiedene Schweregrade ist einerseits sehr sinnvoll, da je nach Schwere der Hypothermie verschiedene Vorgehensweisen resultieren, andererseits ist eine Einteilung anhand der gemessenen Körpertemperatur vor allem im Bereich der notfallmedizinischen Maßnahmen am Unfallort häufig nicht praktikabel. Herkömmliche Fieberthermometer können nur eine Temperaturabnahme bis ca. 35,0 °C messen. Um einen Abfall der Kernkörpertemperatur auf wirklich gefährliche Werte nachweisen zu können, benötigt man geeignete Thermometer, die z. B. über die Temperatur des Trommelfells oder über elektronische Sonden (Magen, Darm, Harnblase) einen niedrigen Wert der Kernkörpertemperatur anzeigen können. Die Temperatur der Haut ist in diesen Fällen irrelevant.
Einteilung nach Schweregrad und Temperatur:
| ■ Leichte Hypothermie: | 35–33 °C |
| ■ Mittelschwere Hypothermie: | 33–30 °C |
| ■ Schwere Hypothermie: | >30 °C |
Für die Akutversorgung eines unterkühlten Patienten ist die Einschätzung anhand des klinischen Bildes (Symptome) wesentlich relevanter.
Ein wichtiges Kriterium in der Einschätzung des Schweregrades der Hypothermie ist das Kältezittern. Dieser physiologische Mechanismus zu Erhöhung der Körpertemperatur setzt nur ein bei einer leichten Abkühlung auf Werte unter 36 °C und ist nur möglich bis ca. 32–33 °C. Sinkt die Körpertemperatur weiter, verliert der Körper die Fähigkeit des Zitterns und damit die Möglichkeit, sich selbst zu erwärmen.
Hinweis. Unter dem Verdacht einer Unterkühlung ist ein Mensch, der nicht zittert, entweder warm oder lebensbedrohlich kalt!
Kompaktinformation
Einteilung der Unterkühlung nach Schweregrad und Symptomen
1. Leichte Hypothermie
– Vollständig bei Bewusstsein, kreislaufstabil
– Starkes Zittern
2. Mittelschwere Hypothermie
– Bewusstseinseinschränkungen (verzögerte oder wirre Antworten)
– Verlust der Orientierung, Amnesie, auch Bewusstlosigkeit möglich – Verlust der Fähigkeit, sinnvoll an der eigenen Rettung mitzuwirken (Rettungsring halten, Seil erfassen, bestimmte Richtung schwimmend einschlagen, Kopf über Wasser halten)
– Kaum noch Zittern, eher rigide Muskeln (ähnlich der Leichenstarre)
– Deutliche Abnahme der Herzfrequenz
– Störungen der Erregungsbildung und -leitung am Herzen
– Deutliche Abnahme der Atemfrequenz
3. Schwere Hypothermie
– Bewusstlosigkeit
– Weite Pupillen, evtl. lichtstarr, keine Sehnenreflexe
– Herzrhythmusstörungen von extremer geringer Herzfrequenz (10–20/min) bis hin zu Kammerflimmern. Stark gesunkener Blutdruck ohne tastbare Pulse, kaum noch Eigenatmung, 1–2 Atemzüge pro Minute, Patienten sehen aus, als ob sie tot wären
3.2.4 Behandlung der Hypothermie
Erstmaßnahmen
■ In allen Fällen einer Hypothermie sollte jeder Patient unabhängig vom klinischen Schweregrad aus dem Wasser in eine horizontale Position gebracht werden. In jedem Fall sollte man den Patienten dabei äußerst schonend bewegen. Dabei muss unbedingt eine vertikale Lage des Opfers vermieden werden, um der Gefahr des so genannten Bergetodes (Afterfall) entgegenzuwirken. Hierbei kommt es zu einem Versacken des Blutes in der unteren Körperhälfte und damit zu einem totalen Kreislaufzusammenbruch, an dem der Patient versterben kann.
Hinweis. Etwa 20 % aller Todesfälle bei Hypothermien im Wasser treten kurz vor, während oder kurz nach der Rettung auf.
■ Nach Überprüfung von Bewusstsein und Herz-Kreislauf-Funktion gegebenenfalls mit Maßnahmen der Reanimation beginnen. Allerdings sollte nur dann eine externe Herzmassage durchgeführt werden, wenn überhaupt keine Pulsaktivität festgestellt werden kann, da sonst das evtl. sehr langsam schlagende und sehr empfindliche Herz durch die Herzdruckmassage zum Flimmern gebracht werden kann.
■ Überprüfen, ob der Patient zittert oder nicht. Wer stark genug zittert, wird auch von allein wieder warm! Zusätzlich sollte man bei dem nicht bewusstlosen Patienten die Bewusstseinslage differenziert überprüfen. Dazu kann man dem Patienten Fragen zum Ort, seiner Person und zur Sache stellen. Anhand der gewonnen Ergebnisse kann man Rückschlüsse auf den Schweregrad der Hypothermie ziehen.
■ Alle nassen Kleidungstücke sind vorsichtig zu entfernen und weitere Wärmeverluste unbedingt zu vermeiden. Dazu sind verschiedene Methoden, wie Zuführung warmer Luft, Wärmepackungen, Kameradenerwärmung, Schlafsäcke oder Decken, anwendbar. Keine Wärmepackungen über 40 Grad! Sonst besteht die Gefahr von Hitzeläsionen der sehr vulnerablen kalten Haut.
■ Bei schwerer und mittelschwerer Hypothermie sollte prähospital keine aktive Wiedererwärmung durch heiße Bäder oder Duschen durchgeführt werden, da hier sonst die Gefahr besteht, dass kaltes Blut aus der Peripherie des Körpers plötzlich in das noch etwas wärmere Herz gelangt, was zu einem Kreislaufversagen führen kann (Afterdrop)!
Erste medizinische Hilfe
Hinweis. Medizinische Hilfe ist bei leichter Hypothermie meist nicht notwendig.
Bei schwerer und mittelschwerer Hypothermie gibt es einige notfallmedizinische Besonderheiten.
■ So sollte man auf die intravenöse Gabe von Ringer-Laktat bei diesen Patienten verzichten, da die kalte Leber nicht in der Lage ist, Laktat zu metabolisieren und somit die Gefahr einer Übersäuerung steigt.
■ Zentrale Venenkatheter sollten so gelegt werden, dass es nicht zur Irritation des Herzens durch Seldinger-Drähte oder Katheter kommt, da hiermit ein Kammerflimmern ausgelöst werden kann.
■ In der Reanimation bei schwerer Hypothermie sollte auf Katecholamine (Adrenalin) verzichtet werden, da diese die Gefahr des Kammerflimmerns erhöhen.
■ Die elektrische Defibrillation bleibt wirkungslos, solange der Patient hypotherm ist. Unter solchen Bedingungen sind auch rhythmisierende pharmakologische Maßnahmen (Amiodaron, Lidocain) kaum mit Aussicht auf Erfolg verbunden.
Grundsätzlich sollten daher alle elektrokardiografischen Anomalien außer der Asystolie (Nulllinie) erst dann behandelt werden, wenn der Patient wiedererwärmt ist.
Hinweis. Der Notarzt muss einen schonenden schnellen Transport ggf. auch unter Reanimation durchführen und dabei vorzugsweise ein medizinisches Zentrum mit Möglichkeiten extrakorporaler Wiedererwärmung ansteuern.
Behandlung im Krankenhaus
Die in der Vergangenheit propagierte Erwärmung mit der Herz-Lungen Maschine wird auf Grund unerwünschter Effekte wie die allgemeine Zellschädigung durch Reperfusion zunehmend kritischer beurteilt (World Congress on Drowning 2002). Dennoch sind invasive Verfahren wie die Erwärmung mit der Herz-Lungen Maschine nach wie vor zu wählen, wenn die Patienten einen Kreislaufstillstand aufweisen.
Konservative Verfahren sind bei Patienten mit noch vorhandener Kreislauffunktion geeignet, diese sicher wieder zu erwärmen. Röggla et al. (2002) konnten an 36 Patienten, die eine Kernkörpertemperatur zwischen 20–28 °C aufwiesen, in 92 % erfolgreich eine konservative Wiedererwärmung mit Luft mit 1 °C pro Stunde durchführen.
Die konvektive Wiedererwärmung durch warme Luft mittels geeigneter Wärmedecken und Warmluftgebläse hat sich unter den konservativen Verfahren eindeutig als das Verfahren der Wahl etabliert.
Diese Methode ist einfach und preiswert in der Anwendung und faktisch in allen Krankenhäusern vorhanden. Ein weiter Vorteil ist, dass alle bisherige Erfahrungen dafür sprechen, dass es bei der Anwendung dieser Methode keinen Afterdrop gibt.
Kompaktinformation
Bei der Behandlung von schwer unterkühlten Patienten gilt es, sich nicht entmutigen zu lassen. Lange Reanimationszeiten und ein Transport unter den Bedingungen einer Reanimation sind bei diesen Patienten immer wieder erfolgreich! Es gilt daher weiterhin die alte rettungsmedizinische Grundregel „Niemand ist tot, bis er warm und tot ist“. Nur diese Strategie ist in der Lage, unnötige Todesfälle von unterkühlten Patienten innerhalb der Rettungskette vom Unfallort bis zum Krankenhaus zu vermeiden. Dabei ist damit zu rechnen, dass viele Patienten, trotz aller Bemühungen, am Ende der mitunter langen Rettungskette vom Unfallort bis zum geeigneten Krankenhaus verstorben sind.
Fallbeispiel. Ein 54-jähriger männlicher, adipöser Sporttaucher begibt sich mit einer Gruppe von Tauchern ohne Sicherheitsleine zu einem Eistauchgang in einem zugefrorenen See. Die Eisdecke ist nicht komplett. Rings um das Ufer ist ein Streifen von ca.12 m eisfrei. Bereits vor dem Tauchgang berichtet der Taucher nach Angaben seiner Tauchpartner über Unwohlsein. Der Tauchgang wird dennoch durchgeführt. Wie alle seine Tauchpartner trägt auch dieser Taucher einen Trockentauchanzug. Etwa 10 min nach Beginn des Tauchganges in ca. 10–12 m Tiefe trennt sich der Taucher von seinem Partner und signalisiert, dass er auftauchen will. Der Partner gibt das OK-Zeichen und lässt seinen Partner allein auftauchen. Zeugen am Ufer berichten später, den Taucher bei seinem Aufstieg gesehen zu haben, als er in das nur dünne Eis mit seiner Lampe ein Loch zu schlagen versuchte. Nachdem seine Hand die Eisdecke durchstoßen hat, hörten seine vom Ufer sichtbaren Bewegungen jedoch auf. Die Zeugen schließen daraus jedoch nicht auf eine Gefahrensituation. Von seiner Position aus hätte der Taucher, ca. 30 m unter dem Eis schwimmend, freies Wasser erreichen können.
Erst als seine Tauchpartner den Tauchgang ca. 50 min später beenden, bemerken sie das Fehlen des Tauchers. Da aber alle Luftvorräte der Gruppe aufgebraucht wurden, sind sie nicht in der Lage, den Taucher zu suchen. Daraufhin wird der Notruf ausgelöst. Die nach weiteren 20 min eintreffende Feuerwehr kann durch den ebenfalls am Unfallort eintreffenden Rettungshubschrauber (BK117) über Funk zu dem sichtbar unter dem Eis treibenden leblosen Taucher dirigiert werden. Die Bergung des Tauchers erfolgt 90 min nach dem letzten Lebenszeichen. Der Taucher ist bewusstlos, die Haut ist kalt, die Pupillen sind weit, Pulse sind keine tastbar, im EKG zeigt sich eine Nulllinie. Der Luftvorrat seiner Tauchausrüstung beträgt 160 bar.
Der Notarzt des Rettungshubschraubers beginnt mit der Reanimation und vermutet bei dem Patienten Beinnahertrinken mit schwerer Hypothermie. Aus technischen Gründen ist die Bestimmung der Kernkörpertemperatur nicht möglich. Der Tauchanzug ist in der oberen Körperhälfte jetzt aufgeschnitten. Nach 30 min erfolgloser Reanimation entschließt sich der Notarzt, den Patienten unter den im Hubschrauber extrem schwierigen Bedingungen einer fortgeführten Reanimation zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus zu fliegen. Nach ca. 15 min Flugzeit und weiteren 15 min Reanimation im Krankenhaus (nunmehr insgesamt 60 min Reanimation und 135 min nach dem letzten Lebenszeichen) wird bei dem Patienten mittels Temperatursonde im Blasenkatheter die Kernkörpertemperatur ermittelt, die 36,2 °C beträgt. Damit ist keine Indikation mehr zur Fortführung der bis dahin erfolglosen Reanimation gegeben. Der Taucher wird für tot erklärt.
Fazit: Abgesehen von der völlig desolaten Planung und Durchführung des Eistauchganges durch den Taucher und seine Partner ist festzustellen, dass der Trockenanzug in Kombination mit einer mäßigen Fettleibigkeit des Tauchers diesen vollständig vor einer Hypothermie geschützt hat. Da die Hypothermie aber nicht ausgeschlossen werden konnte, hat der Notarzt völlig richtig die Entscheidung getroffen, in der Klinik zweifelsfrei die Kernkörpertemperatur bestimmen zu lassen (… niemand ist tot, bis er warm und tot ist!).
Tipps für Tauchlehrer
1. Zur Vermeidung eines Hitzestaus erfolgen Aufbau und Transport des schweren Tauchgeräts in bequemer Kleidung und nicht in der prallen Sonne.
2. Schnorcheltaucher sind auf die besondere Gefährdung durch Sonnenbrand hinzuweisen.
3. Sonnenhut und Sonnencreme können ebenso Bestandteil einer vollständigen Tauchausrüstung sein wie ausreichender Kälteschutz (z. B. auch im Sommer unter der Temperatursprungschicht).
4. Hochgeschlossene Neopren-Bekleidung erleichtert den Aufenthalt im kalten Wasser, ebenso nützlich sind Tauchzeitbegrenzungen, eine Thermoskanne mit warmem Wasser und zwei erste Stufen.
5. Der Tauchlehrer sollte bei Anzeichen einer beginnenden Auskühlung seiner Tauchschüler umgehend zum Ausstieg zurücktauchen.
6. Winddichte Jacken dürfen auch über dem nassen Neopren-Anzug getragen werden.
7. Ein Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen und Atmen trockener Luft (v. a. an Land) begünstigt Dekompressionserkrankungen. Eine gefüllte Trinkflasche gehört daher zur Ausrüstung vorbildlicher Tauchlehrer und fortschrittlich denkender Taucher.
8. Alkohol hat im unmittelbaren Umfeld einer Tauchbasis und an Bord eines Tauchschiffes nichts verloren.
Weiterführende Literatur ____________________________
1. Bierens JJLM (Hrsg.): Handbook on drowning. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 2006
2. Edmonds C, Lowry C, Pennefather J: Diving and subaquatic medicine. Butterworth & Heinemann, Oxford, 1992
3. European Resuscitation Council: Kreislaufstillstand unter besonderen Umständen: Elektrolytstörungen, Vergiftungen, Ertrinken, Unterkühlung, Hitzekrankheit, Asthma, Anaphylaxie, Herzchirurgie, Trauma, Schwangerschaft, Stromunfall. Sektion 8 der Leitlinien zur Reanimation 2010 des European Resuscitation Council. Notfall Rettungsmedizin 2010; 13: 679–722
4. Gilbert M, Busund R, Skaqseth A et al.: Resuscitation from accidental hypothermia of 13.7 degrees C with circulatory arrest. Lancet 2000; 355: 375–376
5. Oakley EH, Pethybridge RJ: The prediction of survival during cold immersion: results from The UK National Immersion Incident Survey. INM Report No. 97011, 1997
6. Röggla M, Frossard M, Wagner A et al.: Severe accidental hypothermia with or without hemodynamic instability: rewarming without the use of extracorporeal circulation. Wien Klin Wochenschr 2002; 114: 315–320