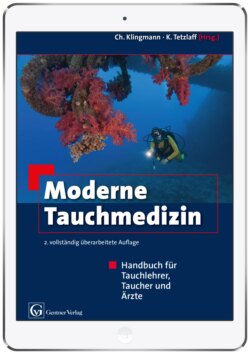Читать книгу Moderne Tauchmedizin - Kay Tetzlaff - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление8 Technisches Tauchen
M. Waldbrenner
In den letzten Jahren hat das „technical diving“ oder technische Tauchen vermehrt an Popularität gewonnen. Eine formale Definition existiert bisher nicht, doch versteht man heute darunter meist komplizierte und lange Tauchgänge jenseits der Sporttauchgrenzen, die oft mit technischen Hilfsmitteln und anderen Gasen als Nitrox und Pressluft durchgeführt werden. Ebenso enthalten diese Tauchgänge meist erhebliche Dekompressionsverpflichtungen und der direkte Aufstieg zur Oberfläche ist verwehrt.
Häufig sind es „zielbezogene“ Aufgabenstellungen, die zu diesen Tauchgängen führen, also tief liegende Wracks, Erforschung einer Höhle und andere tiefe Ziele.
8.1 Was versteht man unter technischem Tauchen?
Sicher kann man sagen, dass militärische Tauchgänge in der Vergangenheit unter dem heutigen Begriff des technischen Tauchens zu subsumieren wären, denn sie hatten eine „Mission“, wurden oft mit technischem Gerät (Kreislauftauchgerät) und meist mit „Mischgas“, damals Nitrox oder Sauerstoff durchgeführt.
Der Begriff „technical diving“ wurde 1991 von Michael Menduno, Herausgeber der Zeitschrift Aquacorps, wie folgt definiert: “… a discipline that uses special tools and methods to improve underwater safety and performance enabling a diver to conduct operations in a wide range of environments and perform tasks beyond the scope of recreational diving“, also „ … eine Disziplin, bei der spezielle Hilfsmittel und Methoden zur Erhöhung der Tauchsicherheit und der Leistungsfähigkeit eingesetzt werden, die es ermöglichen, Tauchgänge in einer Vielzahl von Umgebungen durchzuführen, weit über die Möglichkeiten des Sporttauchens hinaus“.
Später wurde diese Definition dann zu den folgenden Punkten zusammengefasst:
■ tiefer als 40 m,
■ andere Atemgase als Pressluft,
■ direkter Aufstieg zur Oberfläche unmöglich (Höhle, Wrack oder erhebliche Dekompressionsverpflichtung),
■ spezielles technisches Equipment und Ausbildung über den Stand des Sporttauchens hinaus notwendig,
■ Wechsel des Atemgases während eines Tauchgangs.
Diese Definitionen sind jedoch ebenfalls unscharf, denn demnach wäre ein Nitroxtauchgang per Definition ein technischer Tauchgang, ebenso wie ein Eistauchgang, da ja auch hier der direkte Weg zur Oberfläche versperrt ist. Tatsächlich werden diese Tauchgänge aber heutzutage als reine Sporttauchgänge betrachtet. Daher wird es immer einen Graubereich zwischen dem Sporttauchen sowie dem technischen Tauchen geben und diese Grenze wird sich auch weiter verschieben.
8.2 Motivation
Als George Mallory, ein britischer Bergsteiger, 1923 gefragt wurde, warum er auf den Mount Everest steigen wollte, antwortete er, „weil er da ist“. Diese Einstellung führte schon oft dazu, dass Menschen die Grenzen des bisher Erreichten überschreiten wollten. Heute gibt es allgegenwärtig Grenzen, die zum Teil durch Vernunft, oft aber durch reine Willkür festgelegt wurden. Und es gibt immer wieder Menschen, die nach dem „Warum?“ fragen und die bereit sind, diese Grenzen für sich zu verschieben.
Beim Tauchen geht es nicht darum, einfache Tieftauchgänge durchzuführen, auch wenn diese unter technische Tauchgänge fallen, sondern meist gibt es eine weitere Motivation, wie zum Beispiel ein unbetauchtes Wrack, eine unerforschte Höhle oder Ähnliches, zu erkunden (Abb 8.1). Die Rekordsucht ist im technischen Tauchen meist verpönt, da es sich bei dieser ja ausschließlich darum dreht, ein hohes Risiko einzugehen.
Abb. 8.1: Höhlentaucher mit Scooter und Stageflaschen in Höhle (Foto: David Rhea)
8.3 Tiefe
Inzwischen werden im Bereich des Hobbytauchens (denn es wird immer noch als Hobby ausgeführt) regelhaft Tiefen von 100 m aufgesucht. Dies galt früher als extrem tief; heute gibt es wahrscheinlich an jedem Wochenende etliche Taucher, die diese Grenze überschreiten. Aber man sollte sich gerade deshalb immer wieder vor Augen führen, dass ein Fehler in 100 m Tiefe nur eine sehr geringe Überlebenschance lässt. Wenn man nur den Gasverbrauch in diesen Tiefen berechnet, wird einem klar, wie schnell die Uhr tickt. Für das Kreislaufgerätetauchen sei in diesem Zusammenhang das Stichwort „Bail-out“, also offene Notfallreserve, erwähnt. Hierunter versteht man die Gasmenge, die nicht für den eigentlichen Tauchgang verplant wird, sondern für den Ausfall von Equipment als zusätzlicher Gasvorrat mitgeführt wird. Welche Faktoren beeinflussen nun unsere Tauchgänge in die Tiefe?
8.4 Druck
In jeder Tiefe herrscht ein hydrostatischer Druck, der näherungsweise mit p = (D/10) + 1 angegeben werden kann, wobei D die Tiefe in Metern darstellt. Die 1 kommt als Offset für den atmosphärischen Druck hinzu.
In 70 m Tiefe haben wir also p = (70/10) + 1 = 7 + 1 = 8 bar an hydrostatischem Druck, der auf uns wirkt, ebenso wie auf die gesamte mitgeführte Ausrüstung. Diese Tatsache ist zwar in der Theorie vielen Tauchern klar, aber etliche Ausrüstungsgegenstände sind möglicherweise niemals für solche Drücke konzipiert. Ein Beispiel dafür sind einige Tauchlampen, aber auch Finimeter und alte Tiefenmesser. Auch wenn der Prüfdruck bei einigen Geräten 10 bar beträgt, so muss sorgfältig getestet werden, ob diese Belastungen auch im harten Einsatz unter Wasser gelten. Taucheruhren werden manchmal nur bis zu einem bestimmten Druck in einer Kammer getestet. Allein das Tragen am Arm und das Drücken der Bedienknöpfe unter Wasser ist hierbei schon nicht vorgesehen. Schließlich rechnete früher einfach niemand damit, dass diese Geräte dann auch tatsächlich in solchen Tiefen eingesetzt werden.
8.5 Atemgase
Wie im Kapitel über Nitrox bereits erwähnt, bringt Sauerstoff auch Nachteile mit sich, wie zum Beispiel die Tiefenbegrenzung, die vom Anteil des verwendeten Sauerstoffanteils im Atemgas abhängig ist. Während beim Nitroxtauchen der Sauerstoffanteil künstlich erhöht wurde (hyperoxisch), wird er in den Tauchgasen für größere Tiefen unter den natürlichen Volumenanteil von 21% gesenkt (hypoxisches Gemisch). Ab einem Volumenanteil von weniger als 17% soll ein solches Gas an der Oberfläche nicht mehr geatmet werden, da sein Sauerstoffanteil für das Gehirn nicht mehr ausreichend ist. Eine Bewusstlosigkeit mit Ertrinken wäre die Folge. In 10 m Tiefe, also bei rund 2 bar, ist der Partialdruck eines Gemisches mit 12% O2 bereits wieder 2 × 0,12 bar = 0,24 bar und damit voll lebenserhaltend, während dieses Gasgemisch an der Oberfläche zur Gefahr werden könnte. Somit muss bei hypoxischen Gemischen also nicht nur auf die maximale, sondern auch auf die minimale Verwendungstiefe geachtet werden.
Wenn man unser Gemisch mit 12% Sauerstoffanteil betrachtet, worin besteht dann der Rest des Volumens? Auf jeden Fall nicht nur aus Stickstoff, denn dies sollte bereits beim Nitroxtauchen eliminiert werden. Also suchte man vor vielen Jahren bereits nach Ersatzgasen als „Füllgas“ und experimentierte mit Wasserstoff, Helium und einigen anderen Gasen. Die COMEX in Frankreich führte 1988 Experimente mit Gemischen unter Verwendung von Wasserstoff auf bis zu 534 m Tiefe durch, allerdings nur in einer Druckkammer. Da Wasserstoff im Gemisch mit Sauerstoff als Knallgas bekannt ist, war dessen Handhabung nicht unkritisch. Helium war in seiner Verarbeitung beim Füllen und Tauchen deutlich sicherer als der explosive Wasserstoff. Die Versuche der COMEX endeten erst in einer Tiefe von mehr als 700 m im Jahre 1992. Auch dabei wurden verschiedene Hydrelioxmischungen (Sauerstoff, Wasserstoff, Helium) verwendet.
Im heutigen technischen Tauchen wird meistens Trimix eingesetzt. Hierbei sagt der Name Trimix jedoch nicht direkt etwas über die Zusammensetzung der Gase aus, sondern lediglich, dass es sich hierbei um ein Gemisch aus drei Gasen handelt. Diese sind im Normalfall Sauerstoff, Helium und Stickstoff.
Wann wird nun welches Gemisch verwendet? Der Sauerstoffpartialdruck soll in der Zieltiefe in einem normoxischen bis leicht hyperoxischen Bereich liegen, während die Narkosetiefe meist flacher als 30 m gewählt wird. Mit Narkosetiefe ist der Anteil des Stickstoffs im Atemgas gemeint, der zu den Symptomen des Tiefenrauschs führt und auch als Stickstoffnarkose bezeichnet wird. Damit kann man nun genau ausrechnen, welche Volumenanteile an Sauerstoff und Stickstoff das Atemgas enthalten darf. Der Rest zu 100% wird dann mit Helium aufgefüllt. In den frühen Jahren des Trimixtauchens wurden oft Narkosetiefen von 40 m und tiefer gewählt. Dies lag vor allem am damaligen Unwissen über die Verwendung von Helium. Inzwischen verwenden es die meisten Taucher bei 30 m und weniger, bei sehr anspruchsvollen, langen Tauchgängen auch bis hin zu schwimmbadähnlichen Tiefen. Je komplexer die Tauchgänge, desto klarer sollte der Kopf sein.
Aber warum wird der Stickstoff nicht komplett aus dem Atemgas entfernt, also Heliox getaucht, ein Gemisch aus Sauerstoff und Helium? Weil Stickstoff zu einer minimalen Narkose führt und diese minimale Narkose durchaus zweckmäßig sein kann, denn schließlich haben wir auch an der Oberfläche einen physiologischen Stickstoffpartialdruck von etwa 0,79 bar und außerdem verringert dieser Stickstoffpartialdruck durch seine dämpfende Wirkung das Auftreten eines HPNS-Syndroms (s. unten). Insgesamt muss aber wegen der Gefahr eines Tiefenrauschs beachtet werden, dass Stickstoff ein im technischen Bereich eher unerwünschtes Gas ist.
8.6 HPNS
Das High-pressure-nervous-Syndrom stellt eine ernstzunehmende Gefahr bei extrem tiefen Tauchgängen dar. HPNS äußert sich in extremem Zittern der Extremitäten bis hin zur Unfähigkeit, einfachste Handgriffe durchzuführen. Damit ist es hinsichtlich seiner Gefährlichkeit als ernstes Problem einzustufen. Anfangs dachte man noch, dass das Helium für HPNS ursächlich ist, später ergaben Tests dann den Druck an sich als Ursache. Genauer gesagt: Das schnelle Ansteigen des Drucks führt zum HPNS durch eine direkte Auswirkung auf Zellmembranen.
Leider kann man meist nicht beliebig langsam absteigen und sollte sich deshalb dieses Problems bewusst sein. Indem man mindestens eine Narkosetiefe von einigen Metern beibehält, lässt sich das Einsetzen von HPNS dämpfen, d. h., es wird eine Narkose gegen diese Überreizung eingesetzt. Die Gefahr eines HPNS wird im Allgemeinen bei Tiefen ab 120 m als gegeben angesehen.
8.7 Gasdichte
Ein weiterer Aspekt bei heutigen tiefen Trimix-Tauchgängen ist die zunehmende Gasdichte in der Tiefe. Bei Stickstoff wirkt sich dies stärker aus als bei Helium, aber prinzipiell gilt für jedes Gas, dass es bei hohem Druck dichter und damit „zähflüssiger“ wird. Bei Pressluft ist dies ausgeprägter als bei Trimixen mit hohem Heliumanteil.
Die Gasdichte von Stickstoff beträgt bei 37 °C und 1 bar Druck 1,1017 g/l, bei Helium liegt dieser Wert lediglich bei 0,1572 g/l. So wird hier ein weiterer begrenzender Faktor von Stickstoff deutlich.
Durch die hohe Gasdichte fällt nicht nur das Atmen schwerer, sondern es wird auch die Belüftung der Lunge schlechter, da die Strömungen in den kleinen Bronchien und Bronchiolen nicht mehr laminar, sondern turbulent erfolgen. Im Kreislaufgerätetauchen spielen diese Gasdichten und Strömungsverhältnisse ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Auch hier ist Stickstoff als eines der minderwertigen Gase für extreme Tauchgänge anzusehen!
Aufgrund des vergleichsweise geringen Atemwiderstands von Helium-Gemischen wird sich unbewusst ein erhöhtes Atemminutenvolumen einstellen, was in Luftverbrauchsberechnungen berücksichtigt werden sollte.
8.8 Dekompression
Alle geatmeten Gase lösen sich im Blut und in den menschlichen Geweben. Diese Löslichkeit hängt vom Löslichkeitskoeffizienten und vom Umgebungsdruck ab. Reduziert sich nun dieser Umgebungsdruck, wie zum Beispiel beim Vorgang des Auftauchens, so überschreitet die Sättigung einen kritischen Wert und das Gas geht aus der Lösung. Es kann zur Gasblasenbildung kommen. Diese Blasen können – abhängig von ihrer Größe, Anzahl und Lokalisation – unter Umständen Symptome verursachen. Früher dachte man, dass Taucher bereits eine Dekompressionskrankheit hätten, sobald Gasblasen venös feststellbar waren. Diese Meinung ist inzwischen dadurch revidiert, dass es Tausende von Tauchern mit Tauchgängen gibt, bei denen eine symptomlose Dekompression mit sehr kurzen Profilen getaucht wurde, aber trotzdem Bläschen venös nachweisbar waren. Die venösen Gasblasen werden im „Lungenfilter“ aufgefangen und dort sehr effektiv abgeatmet. Dies geht allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze. Zusätzlich verringert sich die Gasaustauschfläche, wenn der Lungenfilter überlastet wird. Da ein persistierend offenes Foramen ovale zusätzlich zu einer Arterialisierung von Gasbläschen führt, resultiert aus dieser Erkenntnis ein wichtiger Grundsatz: keine tiefen, technischen, dekompressionspflichtigen Mischgastauchgänge mit einem offenen Foramen ovale! Da ca. 25% der Menschen ein solches PFO aufweisen, sollten alle Taucher, insbesondere aber jene, die komplizierte, dekompressionspflichtige Tauchgänge durchführen, sich auf ein solches PFO testen und ihre Tauchtauglichkeit untersuchen lassen (Abb 8.2). Heutige Dekompressionszeiten können durchaus mehrere Stunden betragen.
Abb. 8.2: Anspruchsvolles Tauch- und Dekompressionsprofil, das durch den Höhlenverlauf vorgeschrieben wurde. Die roten Kreise entsprechen Warnhinweisen des Computers, z. B. bei zu schnellem Aufstieg. Der blaue Kreis ist eine individuell gesetzte Wegmarke, die man bei einem Umkehrpunkt oder einem interessanten Ereignis setzen kann
8.9 Kosten
Tatsächlich sind technische Tauchgänge durch die verwendeten Ausrüstungsgegenstände und Gase teurer als Sporttauchgänge, aber das teuerste ist und bleibt immer noch die Fahrt zum Tauchplatz. Dagegen spielen die Gaskosten in Europa nur eine untergeordnete Rolle. Wenn man beim Equipment oder den Gasen aus Preisgründen die Sicherheit vernachlässigt, sollte man lieber einem weniger teuren Tauchgang den Vorzug geben.
8.10 Ausrüstung
Im technischen Tauchen werden fast ausschließlich Trockentauchanzüge verwendet. Die Mehrzahl der Taucher benutzt Trilaminatanzüge. Als Anzuggas kommt wegen der besseren isolierenden Wirkung Argon zum Einsatz, bei sehr langen Tauchgängen im kalten Wasser werden auch elektrische Anzugsheizungssysteme eingesetzt. Diese verfügen im Regelfall über Heizleistungen zwischen 50 und 75 W. Leider werden auch Heizsysteme mit 20 W und weniger angeboten, diese führen jedoch eine viel zu geringe Wärmemenge zu. Als Unterzieher werden ausschließlich Hochleistungsunterzieher aus Thinsulate oder anderen Hightech-Kunstfasern verwendet. An den Anzügen sind meist Taschen befestigt, um zusätzliches Equipment, wie zum Beispiel Unterwasserschreibhefte, mitzuführen. Oft werden zwei Kopfhauben übereinander getragen, da die Auskühlung am Kopf besonders hoch ist.
Bei den Flossen werden häufig die bewährten Gummiflossen von Poseidon (Handelsname Jetfin) oder ähnlich einfache Modelle eingesetzt, oft auch mit Edelstahlfedern statt Gummibändern um die Fersen. Dies verhindert das Hängenbleiben mit den Flossenverschlüssen in Schnur oder Draht.
Die häufig verwendeten Masken besitzen einen Maskenkörper aus schwarzem Silikon, um störende Reflektionen von den Tauchlampen des Partners zu verhindern. Ein Neoprenmaskenband ist wegen seiner Beständigkeit den normalen Gummibändern vorzuziehen. Außerdem kann sich hier am Verschluss nichts verfangen. Schnorchel werden im technischen Tauchen nicht verwendet.
Bei Tauchgängen in Seen und im Meer werden in Normalfall Bojen bzw. Hebesäcke mitgeführt und eine Leinenrolle, um diese nach oben schießen zu lassen. Diese Bojen dienen den Begleitbooten und Supporttauchern als Markierung der Tauchergruppe, da man ihnen sehr gut während der Dekompression folgen kann. Besonders in strömungsreichen Gewässern sind sie ein absolutes Muss.
Solch eine kleine Leinenrolle, eine Spool, haben auch Höhlentaucher immer in der Hosentasche ihres Trockentauchanzuges. Sie dient dazu, Lücken in der permanenten Leine der Höhle zu überbrücken oder aber als Referenz, wenn man nach der Leine sucht. Große Leinenrollen, so genannte „Reels“, fassen dagegen bis zu 500 m Leine und werden daher meist zum Ausleinen von Höhlen verwendet. Wichtig ist sowohl bei Spools als auch bei Reels, dass deren Handhabung geübt wird, auch insbesondere die Situation des „sich Verhedderns“.
Bei den Lampen kommen fast nur Kanisterlampen zum Einsatz, heute meist mit Ni-Mh-Akkumulatoren und Gasentladungslampen, so genannte HID-Brenner. Es gibt hierbei drei gängige Stärken, nämlich 10 W, 18 W und 21 W, wobei die 18-WHID-Brenner am weitesten verbreitet sind. Da für technische Tauchgänge immer eine Redundanz vorzusehen ist, sollte man auch zwei Ersatzlampen mitführen; hierbei darf man nicht vergessen, dass diese mindestens die Hälfte der Brenndauer der Hauptlampe haben müssen (für den Rückweg).
Im Lampensektor haben sich nun auch die bekannten LED (Light-emitting Diode) etabliert, zuerst bei den Ersatzlampen und anschließend auch bei den Primärlampen. Die gegenüber der HID-Technik nochmals verringerte Stromaufnahme und damit längere Brenndauer war dabei der wesentliche Aspekt. Dies ermöglicht natürlich auch kleinere Akkutanks bei gleicher Brenndauer wie ein HID-Brenner.
Ein natürliches Problem hierbei ist die geringere Fokussierbarkeit des LED-Kopfes im Vergleich zum HID-Lampenkopf. LEDs sind auch wesentlich weniger empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen und Spannungsschwankungen.
Die Technik schreitet hier so schnell vorwärts, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich LED flächendeckend durchgesetzt hat.
In der Akkutechnologie wird fast nur noch NiMH oder gar Lithium-Ionen-Akkutechnik eingesetzt. Allein zu den Vor- und Nachteilen diverser Lampen, Brenner und Akkus könnte man problemlos ein eigenes Buch füllen.
8.11 Rebreather
Rebreather, also Kreislauftauchgeräte, werden gern für lange und tiefe Tauchgänge verwendet, da sie wie ein „Gasverlängerungswerkzeug“ arbeiten (Abb 8.3). Bei der normalen Atmung wird lediglich ein geringer Prozentsatz (ca. 4%) verstoffwechselt, weshalb es sich anbietet, das Atemgas im Kreis zu leiten, CO2 als metabolisches Abfallprodukt chemisch zu binden und den verbrauchten Sauerstoff zu ersetzen. Genau dies bewirkt ein Rebreather, so dass man mit den gleichen Gasvorräten wesentlich längere Tauchgänge durchführen kann als im offenen Kreislauf. Je nach Kreislaufgerätetyp wird nur der verbrauchte Sauerstoff oder ein bereits vorgemischtes Gas zugeführt. Diese Zuführung kann wiederum mechanisch oder elektronisch gesteuert erfolgen und der Kreislauf kann komplett geschlossen oder halbgeschlossen sein. Somit ergibt sich eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für den eigentlich einfachen Vorgang der O2-Zufuhr und der CO2-Bindung. Aus den verschiedenen Funktionsweisen und den zugrunde liegenden Grundprinzipien leiten sich aber auch die Gefahren beim Tauchen mit Kreislaufgeräten ab.
Abb. 8.3: Taucher mit RB80-Kreislaufgeräten kommunizieren während der Dekompression
Da bei den meisten Menschen CO2 den Atemreiz steuert, kann es durch die vollständige Absorption des CO2 zu einem „Leeratmen“ des Kreislaufs kommen, bei dem sämtlicher Sauerstoff verbraucht wird, aber kein Atemreiz erfolgt. Dies führt unweigerlich zum Tod. Ebenso gefährlich kann sich das Gegenteil auswirken, ein Versagen der CO2-Absorption. Dies führt zu einem Anstieg des CO2 auf kritische Werte, d. h. zu einer so genannten Hyperkapnie. Die Folge kann ein Lufthunger bis zur Panik sein, obwohl genug Sauerstoff zur Lebenserhaltung zur Verfügung steht. Kritisch wird es bei körperlicher Anstrengung, wie sie auch bei Panik normal ist, da meist eine Bewusstlosigkeit folgt.
Einige Kreislauftauchgerätehersteller werben damit, dass ihre Geräte den Sauerstoffpartialdruck pO2 konstant halten und damit die Dekompressionszeiten minimieren würden. Dies trifft aber nur in der Theorie auf Sporttauchgänge zu. Bei technischen Tauchgängen wird gerade die Dekompression durch einen gezielten Wechsel der Partialdrücke verkürzt. Würde man den pO2 zur Verkürzung einer Dekompression auf hohem Niveau halten, so würde die Lunge darunter über diese Einwirkzeit ihre Fähigkeiten, Gase effektiv auszutauschen, bereits so stark einschränken, dass der konstante Partialdruck kontraproduktiv wäre.
Obgleich der große Gasvorrat durch den Einsatz von Rebreathern vermeintlich einen immensen Sicherheitsgewinn darstellt, sollte man sich der Gefahren von Kreislauftauchgeräten bewusst sein. Der oft zitierte Vorteil der kleineren Tauchflaschen ist nur ein vermeintlicher Vorteil, da bei technischen Tauchgängen immer ein Gasvorrat für die komplette Rückkehr im offenen Kreislauf mitgeführt werden muss. Somit kann es doch zu ansehnlichen Flaschenmengen kommen.
In dieser kurzen Abhandlung kann nicht auf gerätespezifische Besonderheiten eingegangen werden, aber es wird deutlich, dass Kreislaufgeräte mit Bedacht eingesetzt werden sollten. Zusammengefasst sind Kreislauftauchgeräte sinnvolle Werkzeuge bei technischen Tauchgängen, sofern der Nutzen, also die Quasi-Vergrößerung der Gasvorräte, die Betriebsgefahr überwiegt.
8.12 Scooter
Ein Scooter ist ein Unterwasserfahrzeug, das den Taucher mittels Elektromotor und Akkumulator zieht. Von Sporttauchern werden Scooter oft als reine Spaßgeräte angesehen. Es handelt es sich dabei aber auch um extrem wichtige Werkzeuge für lange und tiefe Tauchgänge. Wo liegen die Vorteile? Man verausgabt sich weitaus weniger, was zu einem geringeren Gasverbrauch und zu einer kürzeren Dekompression führt. Bei gleichzeitiger Verwendung eines Kreislaufgeräts wird auch die Standzeit des Scrubbers durch die geringe CO2-Produktion verlängert. Unter „Scrubber“ versteht man den Atemkalk im Kreislaufgerät, der für eine chemische Bindung des CO2 sorgt. Natürlich muss man alle diese Vorteile bei der Bail-out-Planung bei Ausfall eines Scooters berücksichtigen. Den Rückweg sollte man am besten mittels eines Ersatzscooters antreten oder aber schwimmend planen, wobei dann der höhere Gasverbrauch für den Rückweg und durch die längere Tauchdauer sowohl für die Grundzeit als auch für die Deko einzuplanen ist. Der Scooter selbst sollte für den entsprechenden Tauchgang dimensioniert sein. Dies betrifft die Laufzeit der Akkus und die maximal zulässige Einsatztiefe. In der Praxis haben sich direkt angetriebene Scooter, also solche ohne Getriebeübersetzung, bewährt. Sie sind wesentlich leiser, so dass man beispielsweise akustische Warnungen oder auch Geräusche wie die des Kreislauftauchgeräts besser wahrnimmt. Eine effektive Rutschkupplung ist wichtig, damit der Motorstrom nicht extrem ansteigt, falls etwas in die Schraube gerät oder falls man in die Schraube hineingreifen sollte. Vorteilhaft sind auch Verstellantriebsschrauben, da man die Geschwindigkeit an den Buddy stufenlos anpassen und auch einen Scooter, der sich nicht mehr stoppen lässt, dadurch vom Vortrieb her neutralisieren kann.
Idealerweise besitzt ein Scooter an der Oberfläche einen leicht positiven Auftrieb und unter Wasser einen neutralen bis leicht positiven Auftrieb. Diese Veränderung wird dadurch ermöglicht, dass man den O-Ringen etwas Platz lässt, um sich zu setzen und sich dadurch das Volumen des Scooters verändert. Trotz des hohen Gewichts von Langlaufscootern von mehr als 30 kg lassen sich diese auf ein paar Gramm genau tarieren.
Die Zugkraft sollte bei diesen Unterwasserfahrzeugen über eine Zugschnur auf einen Schrittgurt übertragen werden. Damit lässt sich ein gut tarierter Scooter einhändig fahren und mit der anderen Hand kann man dabei leuchten, Druckausgleich durchführen, Tariermittel bedienen etc.
Für extreme Tauchgänge werden auch mehrere Scooter mitgeführt, zum einen aus Redundanzgründen, aber auch, um die Reichweite zu erhöhen. Also sollten Scooter auch gut zu ziehen bzw. zu „verstauen“ sein.
Wie bei den Tauchlampen haben sich hier auch neuere Akkutechnologien wie Li-Ionenakkus begonnen durchzusetzen.
8.13 Menschliche Bedürfnisse
Tauchgänge außerhalb des Sporttauchbereichs sind oftmals mit einer Dauer von zwölf und mehr Stunden wesentlich länger als normale Sporttauchgänge. Dabei treten natürliche Bedürfnisse wie Harn- und Stuhldrang auf.
Bei männlichen Tauchern haben sich hierzu Kondomurinale mit einem nach außen führenden Auslassventil bestens bewährt. Windeln verfügen nicht über entsprechende Aufnahmereserven und bilden auch Kältebrücken, von der Hygiene ganz zu schweigen.
Um Stuhlgang unter Wasser zu unterdrücken, hat sich die prophylaktische Einnahme von Loperamid als sehr effektiv erwiesen. Obwohl Loperamid ein Opiatderivat ist, wurden bisher bis 125 m Tauchtiefe keinerlei zentralnervösen Nebeneffekte bemerkt. Dies liegt an seiner Molekularstruktur, die ein Passieren der Blut-Hirn-Schranke verhindert.
Frauen sollten entsprechende Produkte aus dem Inkontinenzbedarf verwenden oder aber auf das eigens für Taucher entwickelte SHEP zurückgreifen (Abb 8.4). Dies ermöglicht nun Frauen auch längere und oder entspanntere Tauchgänge (http://www.she-p.com/).
Abb. 8.4: Beispiel für ein SHE-P
Taucher, die ohne ein Urinventil tauchen, sind meist dehydriert, da sie zur Vermeidung des Harndrangs vor dem Tauchgang zu wenig trinken. Dies wirkt sich für den Tauchgang und eine etwaige Dekompression sehr nachteilig aus!
8.14 Ausbildung
Eine fundierte Ausbildung ist beim Tauchen generell, aber insbesondere beim technischen Tauchen unbedingt notwendig. Dies ist nicht mit einem Brevet zu verwechseln, sondern beinhaltet eine Ausbildung mit vielen Übungselementen und der notwendigen Theorie von einem Instruktor, der selbst über jahrelange Erfahrung in diesem Bereich des Tauchens verfügt und nicht nur Ausbildungserfahrung hat. Eine Ausbildung sollte schrittweise, immer wieder ergänzt durch Übungseinheiten, erfolgen. Dabei sollte der Tauchschüler auch eigenverantwortliche Tauchgänge im Rahmen des bereits Erlernten durchführen. Die Ausbildung sollte eigenständige Taucher hervorbringen, die aber auch die Teamfähigkeit erlernen sollten. Die etablierten Verbände bieten in den letzten Jahren vermehrt umfassende Kurse an und reduzieren entsprechend ihre Spezialkurse.
Der Ausbildungsstoff muss insbesondere in den ersten Monaten häufig wiederholt werden, damit lebensnotwendige Handgriffe und Sicherheitsdrills automatisiert ablaufen und im Gehirn freie Kapazitäten für Überlebensstrategien geschaffen werden. Um diesen Vorgang zu unterstützen, sollte auch in der Ausbildung bereits Wert auf eine Standardisierung des Equipments, der Gase und Prozeduren gelegt werden.
8.15 Team
Technische Tauchgänge benötigen oftmals ein Team. Dies beginnt schon über Wasser, oft aufgrund der logistischen Gegebenheiten, sei es die Ausfahrt zu einem neuen Wrack, einer Höhle in einem unzugänglichen Gebiet oder einfach nur die Menge des zu transportierenden Equipments (Abb 8.5). Ebenso fallen häufig spezifische Tätigkeiten an, wie so genannte Setup-Tauchgänge, bei denen Flaschen, Heizröhren und Habitate in der Höhle platziert werden können. Ein Habitat ist eine gasgefüllte Struktur, in der sich während der Dekompression der Oberkörper des Tauchers außerhalb des Wassers befindet. Während der Dekompression übernehmen die Supporttaucher die Kommunikation mit der Oberfläche, sichern die Gasvorräte und versorgen die Taucher. Dies sind keine Hilfsjobs, sondern elementare Bestandteile eines komplizierten Tauchgangs. Daher sollte man auch nur vertrauenswürdige und kompetente Taucher mit diesen Aufgaben betrauen.
Der Tauchpartner ist ebenfalls Teil des Teams. Ihm kommt eine besondere Bedeutung zu. Oft wird argumentiert, dass man nur alleine sichere technische Tauchgänge durchführen könne, da ein schwacher Buddy eher eine Gefahr darstelle. Ein unerfahrener Taucher ist aber natürlich nicht die Alternative, denn es wird ein gleichwertiger Tauchpartner benötigt. Ferner wird argumentiert, man könne durch seine so genannte „Buddy-Bottle“, also eine zusätzliche Tauchflasche, den Tauchpartner ersetzen. Diese Annahme ist falsch. Ein erfahrener Partner macht den Tauchgang einfacher und sicherer. Bleibt z. B. ein Taucher in einer Leine hängen, ist es wesentlich effektiver, sich von seinem Partner helfen zu lassen, insbesondere wenn man sehr viel Equipment mit sich führt. Alle Gaswechsel und Verfahren sind abgesprochen und werden unter Wasser unter gegenseitiger Beobachtung durchgeführt. Dies erhöht die Sicherheit erheblich. Dazu kommt der Erlebnisaspekt, der Austausch der Eindrücke eines gemeinsam durchgeführten Tauchgangs.
Abb. 8.5: Taucher seilen Tauchausrüstung zum Höhleneingang ab
Impressionen eines Höhlentauchgangs. Warum tue ich mir das nur an? Das ist mein erster Gedanke, als ich durch ein Klopfen an der Tür meines VW-Busses geweckt werde. „Micha, Reinhard, aufstehen! Tauchen ist angesagt“. Stimmt, wir sind ja wieder einmal in Frankreich, um einen längeren Höhlentauchgang durchzuführen. Reinhard murmelt neben mir, ob wir wirklich aufstehen sollen. Aber es hilft nichts, der nächste klopft bereits und öffnet die Schiebetür. Also raus aus dem warmen Schlafsack und rein in die kalten Klamotten. Kurz die Zähne geputzt, das muss für heute morgen als Körperpflege reichen. Ich schaue auf die Uhr, es ist kurz vor sechs. Jemand aus dem Team hat bereits Wasser für Tee und Kaffee und das obligatorische Nudelfrühstück aufgesetzt. Alle scherzen und lachen und sind guter Dinge, da bereits am Vortag die Vorbereitungen für diesen Tauchgang zum Großteil abgeschlossen wurden. Reinhard trinkt einen Tee, ich einen Milchkaffee. Es gibt dazu Nudeln mit Hackfleischsoße. Jeden Tag wollte ich das nicht frühstücken, geht es mir durch den Kopf, aber als Energielieferant für einen längeren Tauchgang ist es eine gute Grundlage.
Das erste Team verlässt bereits die Frühstücksgruppe, um vor uns im Wasser zu sein. Wir frühstücken in Ruhe zu Ende und machen uns dann ebenfalls auf den steilen Geröllweg zum Höhleneingang. Jetzt wird es auch allmählich hell, die letzten Sterne verschwinden und man sieht endlich mehr.
Unten abgekommen gehen wir zu dem Punkt, an dem wir unsere Trockentauchanzüge und Unterkleidung deponiert haben. Ich ziehe mich aus, was bei den Temperaturen nicht wirklich erfreulich ist, aber sobald ich die erste Lage Funktionswäsche anhabe, wird es wieder wärmer. Bei der dritten Lage beginnt es schon wieder so kuschelig zu werden, dass ich jetzt gerne nochmals in den Schlafsack kriechen würde.
Das Kondomurinal zum Wasserlassen wird angelegt. Es folgen das Heizhemd, der Unterzieher und die Socken. Dann der Einstieg in den Trocki, Reißverschluss schließen und vorher natürlich das Heizhemd mit dem Stecker im Trocki und das Kondomurinal mit dem Ventil zum Wasserlassen in den Anzug verbinden. Das Heizhemd wird von außen geprüft und der Ohmmeter zeigt 2,3 Ohm, ein guter Wert. Bei Null oder Eins hätte man keinen Kontakt bzw. einen Kurzschluss des Heizhemds. Brus sagt zwischendurch immer, wie weit Reinhard und ich jeweils mit dem Anziehen sind, damit wir in etwa gleichzeitig ins Wasser kommen, da langes Warten lästig und unnötig ist. Diese Kleinigkeiten haben uns in den letzten Jahren die Taucherei mit unserem Team so angenehm gemacht. Alles tickt wie ein Uhrwerk.
Kurz darauf haben wir unsere Kreislauftauchgeräte auf dem Rücken, schalten die Lampen ein und nach einem kurzen Check geht es abwärts. Jetzt treffen wir unter Wasser auch auf das Video und Foto-Team und so winken wir kurz in die Kamera, als wir an ihnen vorbeitauchen. Durch die Setup-Tauchgänge vom Vortag wurde uns über die mittelmäßige Sicht berichtet und so wussten wir schon, was uns erwartet. Das Habitat, unser „Lebensraum“ für die letzten 3 Stunden der Dekompression, ist noch nicht fertig aufgebaut, aber auf unsere Leute können wir uns hundertprozentig verlassen und so schwimmen wir daran vorbei und tauchen langsam tiefer. Der Druckausgleich funktioniert problemlos und auch das Ein- und Ausatemgeräusch des Kreislaufgeräts klingt beruhigend gleichmäßig. Wie lästig wäre es, mittels Messgerät ständig überprüfen zu müssen, ob die Gasmischung korrekt ist, wie es die Hersteller einiger Geräte vorschreiben. Auf 21 m stoppen wir, legen die zum Abtauchen verwendete Flasche mit Trimix 50/25 (50% O2, 25% He) ab und nehmen die Trimixflaschen für den tiefen Teil des Tauchgangs auf. Diese enthalten 12% Sauerstoff und 80% Helium. Im Augenwinkel sehe ich, wie Reinhard zu mir schaut. Es ist ein extrem gutes Gefühl, einen aufmerksamen Tauchpartner zu haben. Jeder nimmt 2 Scooter auf und noch weitere Flaschen sowie die Leinenrolle, um Leine in unberührten Höhlenteilen zu verlegen. Ein kurzes Drücken des Schalters der Scooter erzeugt das leise surrende Geräusch, das dem anderen signalisiert, man sei fertig zur Weiterfahrt. Ich höre Reinhards Scooter und sehe ihn an mir vorbeischwimmen. Ein Blick auf das Unterteil seines Kreislaufgeräts zeigt mir an, dass sein Gerät einwandfrei funktioniert. Ich sehe, dass die Flasche mit der Markierung 100 m in sein Gerät eingestöpselt ist und erkenne somit auch während der Fahrt, dass er das richtige Gas einspeist. Diese Kontrolle beruht auf Gegenseitigkeit. Wir tauchen weiter. Wie viele Taucher hier wohl schon waren? Da diese Höhle einen hohen logistischen Aufwand erfordert, sicher noch nicht mehr als vielleicht zwei Dutzend Taucher vor uns. Mit jeder Minute, die wir weiter in den Berg hineintauchen, werden es weniger.
Mist, die alte Leine ist gerissen, wir brauchen ca. 3 Minuten, um sie zu flicken und setzen unseren Tauchgang fort. Deutlich ist zu sehen, dass diese Leinen unter dem Einsatz von Pressluft verlegt wurden. Nur unter narkotischen Einflüssen würde man solch eine chaotische Leinenführung wählen.
Reinhard gibt mir kurz ein OK-Zeichen, ich antworte zurück. Wir cruisen gemütlich durch dieses dreidimensionale Gangsystem. Das ist wie fliegen, überlege ich. Ein kurzer Blick auf den Bottomtimer zeigt 87 m und 84 Minuten Tauchzeit. Wir sind jetzt bereits weiter als einen Kilometer im Berg. Ich prüfe kurz während der Fahrt das Finimeter und werfe einen Blick auf Reinhard. Sieht alles gut aus. Wir halten an, um die Scooter zu tauschen. Neben mir sehe ich einen Strudelkolk – eine Vertiefung, in der ein Stein liegt, der sich bei Strömung dreht und so tiefer und tiefer in den Berg fräst. Soll ich ihn rausnehmen, überlege ich? Nein, der Stein liegt dort eventuell schon hunderte von Jahren. Seltsame, aber auch spannende Dinge, die die Natur hier veranstaltet. Reinhard betätigt den Trigger seines Scooters und wir fahren nun mit dem zweiten Scooter weiter und ziehen den anderen hinter uns her.
Nach weiteren 40 Minuten sind wir am Ende der Leine angelangt. Reinhard nimmt das Reel und knotet es an die alte Leine. Ich leuchte nach vorne und so fahren wir los. Nun bin ich der Pfadfinder, da ich etwas schneller bin und suche Befestigungspunkte für die Leine. Nach jeder Kurve denke ich: Hier war noch nie ein Mensch vor uns und wir sind die ersten Menschen, die diese Felsen sehen. Ein Kiesbett überquerend, stecke ich mir schnell einen Kiesel in die Seitentasche. Meistens schaue ich sie mir dann später an und werfe sie wieder weg. In diesem Moment finde ich diesen Stein einfach spannend. Es geht wieder bergauf, ich spüre es an den Ohren und schaue auf den Tiefenmesser und das Finimeter. Zu weit hoch dürfen wir nicht, da sonst unser Atemgas hypoxisch wäre, also zu wenig Sauerstoff enthalten würde.
Die Höhle wird enger und enger und irgendwann beschließen wir, dass es für heute reicht und machen das Ende der Leine sorgfältig an einer Felsnase fest. Wir wickeln die Leine mindestens zehnmal um diese Nase herum, so dass den nächsten Tauchern klar wird, dass es sich hierbei um das Ende der Leine handelt. Ich krame währenddessen in meiner Seitentasche nach der kleinen Figur, die wir hier hinten zurücklassen wollen. Die nächsten Taucher sollen ein kleines Mitbringsel haben. Nach kurzen überschlägigen Rechnungen dürften wir jetzt tiefer als 2 km in den Berg eingedrungen sein.
Wir beschließen, diesmal nicht auf dem Rückweg zu vermessen und fahren in Richtung Ausgang zurück. Der Rückweg geht immer schneller und man freut sich über jede Steinformation, die man wieder erkennt. Beim Aufstieg machen wir unsere bewährten Deepstopps, und dann taucht von weitem die erste Dekoflasche auf und hier hängen auch unsere Heizröhren. Als erstes das Dekogas einstöpseln, den Kreislauf kurz spülen, indem man 3- bis 4-mal durch die Nase ausatmet, dann wird die Heizung eingesteckt.
Nach kurzer Zeit spüre ich, wie es warm wird. Reinhard und ich schauen uns an – alles in Ordnung. Er reicht mir einen Getränkebeutel aus seiner Tasche und ich nehme einen kräftigen Schluck. Er fragt, ob wir höher gehen und ich nicke. Von weitem nähert sich bereits der Lichtschein der ersten Supporttaucher und wie immer fragen sie, ob wir etwas benötigen und ob alles klar sei. Wir bestellen Tee und geben einen kurzen Statusbericht. Alles, was wir jetzt an Ausrüstung nicht mehr benötigen, wird uns abgenommen und wir können uns darauf verlassen, dass es oben bereits demontiert und zum Auto transportiert wird. Solch ein effektives Team in Aktion zu sehen, ist einfach eine Wohltat und macht riesigen Spaß. Alleine könnten und wollten wir ein solches Projekt niemals durchführen!
Nach dem Teetrinken und einem Gaswechsel auf 21 m auf Trimix 50/25 nähern wir uns dem Habitat und werden von den Supporttauchern hier erwartet. Einer nach dem anderen zieht sein Kreislaufgerät aus und setzt sich in das Habitat. Auch hier ist es extrem beruhigend, dass jederzeit ein Automat direkt vor uns gehalten wird, um uns im Problemfall Gas zu geben. Im Habitat atmen wir reinen Sauerstoff auf 9 m. Dies ist nur deshalb relativ gefahrlos möglich, weil wir hier im Trockenen sitzen und bei einem eventuellen Krampfanfall nicht ertrinken können. Man muss auch hier immer bereit sein, dem anderen zu helfen, auch wenn dies bisher noch nie nötig war. Nach 12 Minuten mit reinem Sauerstoff wird für ca. 8 Minuten das so genannte „Break-Gas“ geatmet, meist mit 17% Sauerstoff und 55% Helium. Diese Zeit wird trotz dieser Gemischzusammensetzung als vollwertige Dekompressionszeit mitgezählt. Endlich, der erste Supporttaucher taucht im Habitat zwischen uns auf und reicht die Essensröhre nach oben. Reinhard öffnet die Druckausgleichsschraube und mit einem Zischen strömt Gas in die Röhre, damit wir diese auch öffnen können. Nudeln in Tomatensoße. Na ja, Nudeln hatten wir ja zum Frühstück, aber als Vorspeise nicht übel. Der Tee im Trinkbeutel dazu ist noch heiß und es ist ein herrliches Gefühl, warmes Essen und Getränke zu uns zu nehmen. Wir plaudern über den Tauchgang und das Gesehene und so vergeht die Zeit bis zum nächsten Gang recht schnell. Lammkoteletts, lecker und dazu weitere Getränke, um einer Dehydrierung entgegen zu wirken. Wir informieren die Supporttaucher über die geplante Auftauchzeit. Während der Dekompression stellen wir für die Kommunikation mit dem Team die Uhrzeit um, damit wir ein gemeinsames Zeitmaß haben. Pünktlich werden wir abgeholt und von zwei Supporttauchern begleitet, da wir nur ein Backplate und eine Flasche bei uns haben.
Der Aufstieg von 9 m zur Oberfläche ist nervenaufreibend langsam, aber dies ist extrem wichtig. Ich sehne es herbei aufzutauchen, weiß aber, dass wir unsere Ungeduld zügeln müssen, da hier, auf den letzten 10 Metern, der prozentual größte Druckverlust auftritt. Nach 15 Minuten tauchen wir auf und das ganze Team steht oben und begrüßt uns. Immer wenn ich unsere Leute sehe, weiß ich, warum ich mir das immer wieder gerne antue!
Kompaktinformation
■ Was sind technische Tauchgänge? Es gibt keine abschließende und eindeutige Definition, aber im Allgemeinen versteht man darunter Tauchgänge jenseits der Sporttauchgrenzen, bei denen ein direkter Aufstieg zur Oberfläche durch physikalische oder physiologische (Dekompression) Beschränkungen nicht möglich ist und die unter Verwendung von zusätzlichen Hilfsmitteln, wie Mischgas, Scooter, Rebreather, durchgeführt werden. Meist sind es Tauchgänge mit einem bestimmten Ziel, etwa ein tief liegendes Wrack oder eine Höhle, auf das die gesamte Tauchgangsplanung abgestimmt wird.
■ Risiken: Diese liegen meist in der Komplexität der Ausrüstung, der Tauchgangsdurchführung und der Dekompression. Außerdem ist durch den Umstand, dass ein direkter Aufstieg meist nicht möglich ist, jede Fehlfunktion unter Wasser ein erhebliches Risiko.
■ Medizinische Aspekte: Etliche Tauchgänge werden heute jenseits der gebräuchlichen Tabellen und Algorithmen durchgeführt. Dies bedingt natürlich unter Umständen ein erhöhtes Risiko, ebenso HPNS (High-pressure-nervous-Syndrom) bei extrem tiefen Tauchgängen sowie Hyperoxie und Tiefenrausch. Beim Einsatz von Kreislauftauchgeräten kommt ferner noch Hypoxie und Hyperkapnie hinzu. Taucher, die ein PFO haben, sollten keine dekompressionspflichtigen blasenreiche Tauchgänge unternehmen.
Tippus füt Tauchlehrer
1. Gründliche Vorbereitung, einwandfreies Material und strenge Selbstdisziplin erhöhen die Überlebenswahrscheinlichkeit des Tech-Divers an den Grenzen des Möglichen. Der „normale“ Sporttaucher bewegt sich zwar möglichst weit auf der sicheren Seite, sollte aber bei seinen vermeintlich harmlosen Tauchgängen den Ernst der Lage nicht weniger akribisch im Auge behalten.
2. Zurückhaltung: Die meisten Tauchsportverbände sind sich darüber einig, dass Tauchgänge mit Druckluft tiefer als 40 m und geplante Dekompressionstauchgänge im Sporttauchbereich nicht durchgeführt werden sollten (unabhängig vom Ausbildungslevel und auch nicht ausnahmsweise)! Der korrekte Umgang mit Dekompressionstabellen ist dennoch zu erlernen, weil sicherheitsrelevant.
3. Briefing und Check: Einer alles Wesentliche umfassenden kurzen Vorbesprechung (Befinden der Taucher, Zustand der Ausrüstung, Eigenarten des Tauchgewässers und Tauchplatzbeschreibung, Eckdaten des geplanten Tauchgangs, Handzeichen sowie Notfallplan einschließlich Info zur nächsten betriebsbereiten Druckkammer bei Zwischenfällen) folgt eine doppelte Kontrolle der Ausrüstung (der eigenen und der des Tauchpartners) auf Vollständigkeit und einwandfreie Funktion.
4. Je konsequenter der Tauchlehrer Check und Briefing vorexerziert, desto wahrscheinlicher werden seine Schüler diese sinnvollen Routinen weiterleben.
Weiterführende Literatur ____________________________
1. Bove AA, Davis J: Diving medicine. WB Saunders, Philadelphia, 2003