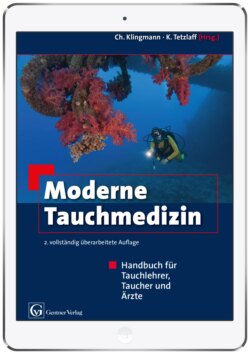Читать книгу Moderne Tauchmedizin - Kay Tetzlaff - Страница 17
Оглавление6 Tauchausrüstung
M. Waldbrenner
Tauchausrüstungen sind so alt wie das Tauchen selbst. Bereits sehr früh experimentierten Taucher mit Schläuchen als Atemwegsverlängerung, mit Luft gefüllten Tierblasen oder Fässern und Eimern, um einen größeren Luftvorrat mit in die Tiefe nehmen zu können. Auch das Sehen unter Wasser sowie die Fortbewegung und der Temperaturschutz nahmen eine kontinuierliche Entwicklung. Diese Entwicklung war ausschließlich durch ihre Zweckgebundenheit funktional bestimmt; modische Aspekte kamen erst sehr viel später, durch den Tauchsport als Hobby, hinzu.
Viele Tauchgeräte, wie z. B. Kreislauftauchgeräte (Rebreather), wurden sehr früh bereits militärisch eingesetzt und erst später für Sporttaucher interessant. Heute existieren beide Welten nebeneinander: die Tauchausrüstung als Arbeitsmittel und auch als Lifestyle-Produkt bzw. Hobby-Ausrüstung. Eine exakte Trennlinie lässt sich hierbei oftmals nicht ziehen, da jeder Mensch und jede Institution mit Tauchaktivitäten eigene Trennlinien zieht und jede Art des Tauchens unterschiedlich eingeschätzt wird.
6.1 Flossen
Die letzten Jahre waren geprägt durch immer neue Flossenarten, mit speziellen Strömungskanälen, bizarren Formen, Knickgelenken und anderen Besonderheiten. Die Vielfalt der angebotenen Produkte für einen simplen „Entenfuß“ ist erstaunlich.
Ebenso bemerkenswert ist die Renaissance der bewährten Gummiflossen, die seit Jahren von Höhlentauchern und der Marine verwendet werden. Da sie nahezu unzerstörbar und sehr effektiv sind, wurde sogar die bereits eingestellte Produktion wieder aufgenommen, so dass sie eine zweite Blüte erleben. Aus medizinischer Sicht muss angemerkt werden, dass diese recht steifen Flossen bei untrainierten Tauchern häufig zu Krämpfen führen. Meist sind aber die Benutzer dieses Flossentyps eher zu den Vieltauchern zu rechnen und damit besser trainiert.
Unterschieden wird ferner zwischen Flossen mit integriertem schuhartigem Fuß, „Schwimmbadflossen“ genannt, und Geräteflossen, die über ein hinten offenes Fußbett verfügen und meist mit einem verstellbaren Gummiband abschließen (Abb 6.1). Immer häufiger sieht man heutzutage auch so genannte „Springstraps“, Edelstahlfedern als Ersatz für das Gummiband, die nicht reißen und keine äußeren Befestigungen haben, mit denen man sich unter Wasser in Leinen etc. verheddern könnte.
Abb. 6.1: Der Klassiker Scubapro Jetfin
Bei erhöhter Krampfneigung sollte auch geprüft werden, ob das Fersenband nicht zu straff eingestellt ist. Viele Taucher klagen dann über Krämpfe im Fuß und in der Wade.
6.2 Maske
Bedingt durch die Natur des menschlichen Auges und physikalische Gegebenheiten benötigt der Mensch unter Wasser eine Sehhilfe, die ihm einen luftgefüllten Hohlraum vor der Augenlinse bietet: die Tauchermaske.
Für das Gerätetauchen sollten ausschließlich Masken mit eingebautem Nasenerker verwendet werden, damit ein Druckausgleich der Luftfüllung in der Maske über die Nase möglich ist.
Der Nasenerker muss gut erreichbar sein, um problemlos das Valsalva-Manöver durchführen zu können. Am wichtigsten ist die Dichtigkeit, die am besten durch einen breiten, weichen Silikonrand ermöglicht wird. Einige Taucher finden durchsichtiges Silikon störend, da es dann bei seitlichem Lichteinfall von schräg hinten (Sonne) zu Reflektionen auf dem Glas kommen kann.
Manche Taucher klagen bei Masken mit getrennten Gläsern nach einiger Zeit über Augen- oder Kopfschmerzen, die wahrscheinlich durch den Nasensteg verursacht werden, auf den die Augen unbewusst fixieren bzw. der für einen leichten Knick zwischen den Glasebenen für beide Augen sorgt.
Taucher mit häufiger Otitis können seit kurzem auf Masken zurückgreifen, die eine Art Ohrmuschelkappe angesetzt haben. Diese ist über eine Röhre mit dem Luftkörper der Maske verbunden, so dass das Ohr trocken bleibt und der Druckausgleich erfolgen kann (Näheres hierzu s. Kap. 11, HNO-Erkrankungen).
Masken mit getrennten Gläsern werden auch mit Visuskorrektur angeboten. Ab einer Fehlsichtigkeit von 1,5 Dioptrien sollte man unbedingt mit korrigierten Gläsern tauchen. Kontaktlinsen sind zwar auch verwendbar, werden aber gerade bei Tauchgängen im Meer oft aus dem Auge gewaschen und gehen dann verloren. Eine Ersatzmaske mit optischen Gläsern oder Linsen für eine Leihmaske gehören ebenfalls in das Urlaubsgepäck.
Eine neu gekaufte Maske sollte durch einmaliges Ansaugen mit der Nase und Luftanhalten auf dem Gesicht haften bleiben. Vor dem Erstgebrauch sollte die Maske von Silikonresten auf den Gläsern gereinigt werden, da diese zum sofortigen Beschlagen führen. Hier kann der Fachhändler die entsprechenden Tipps für das gekaufte Modell geben. Auch eine Reinigung mit diversen „Hausmittelchen“ ist möglich, wie beispielsweise Coca-Cola über Nacht in der Maske stehen lassen, mit Zahnpasta ausreiben oder bei niedriger Temperatur in der Geschirrspülmaschine waschen.
Vor dem Tauchgang sollte man die Innenseite des Maske auf jeden Fall mit einem Antibeschlagmittel, beispielsweise mit Seadrops, oder einfach mit Speichel benetzen.
Für Taucher und Taucherinnen, denen das Gummiband der Maske zu sehr an den Haaren zieht, ist es empfehlenswert, auf ein Neopren-Maskenband umzusteigen, da es ebenfalls fast unzerstörbar und generell sehr empfehlenswert ist.
6.3 Schnorchel
Der Schnorchel (s. auch Kap. 9.1) ist einer der ältesten Tauchausrüstungsgegenstände. Bereits im Mittelalter versuchten die Menschen, mit Bambusrohren unter Wasser zu atmen. Die heutigen Schnorchel bestehen aus einem Atemrohr und einem Mundstück sowie eventuell einem oder mehreren Ventilen, die eingedrungenes Wasser austreiben sollen. Das Mundstück darf keine scharfen Gussgrate oder Kanten haben, um Schleimhautverletzungen im Mundbereich zu vermeiden.
Ob ein Schnorchel mit oder ohne Ausblasventil besser ist, ist die Entscheidung des jeweiligen Tauchers. Die richtige Variante und der bequeme Sitz des Mundstücks lassen sich am besten beim probeweisen Gebrauch im Schwimmbad ermitteln. Abzuraten ist jedoch von Schnorcheln, die an einer Maske angesetzt sind oder am Endstück eine Art Schwimmer zum Verschluss des Rohres aufweisen. Diese Schnorchel sind eher in die Kategorie Spielzeug einzuordnen und für das Sporttauchen absolut ungeeignet, wenn nicht sogar gefährlich.
Noch weitaus gefährlicher sind Verlängerungen des Schnorchels, da diese zu Pendelatmung durch einen hohen Totraum und/oder zu pulmonalen Problemen durch die Druckdifferenz führen können.
Während beim Sporttauchen der Schnorchel oft als unabdingbar angesehen wird, um beispielsweise an der Oberfläche zum Boot zurückzuschnorcheln, wird er im Wrack- und Höhlentauchen wegen der Gefahr des Verhedderns als gefährlich abgelehnt.
6.4 Tauchanzug
Es werden im Allgemeinen drei Arten von Tauchanzügen, je nach Grad des Wasseraustausches, unterschieden.
6.4.1 Nasstauchanzug
Diese Variante des Tauchanzugs ist sicherlich die älteste. Ein Anzug soll schließlich nicht nur vor Auskühlung schützen, sondern bietet seit jeher auch einen mechanischen Schutz gegen nesselnde Meerestiere, Verletzungen durch scharfkantige Steine und anderes.
Aus der Seefahrt war bereits seit langem bekannt, dass über Bord gegangene Seeleute länger in kaltem Wasser überleben konnten, wenn diese z. B. Wollpullover und darüber Ölzeug trugen, so dass durch die Körperwärme das eingeschlossene Wasser erwärmt wurde und sich eine thermische Schutzschicht um den Körper bildete. Nicht anders funktioniert der klassische Nasstauchanzug. Beim Kontakt mit Wasser dringt dieses zunächst an den Armmanschetten, den Reißverschlüssen, Beinen und am Hals in den Anzug ein und verdrängt die darin vorher befindliche Luft. Dieses eingedrungene Wasser wird nun durch die Körperwärme erwärmt und bildet so eine Art warmen Schutzfilm zwischen Körper und Anzug.
Der Nasstauchanzug selbst hat also zwei Funktionen: Zum einen bildet er eine Barriere, damit das angewärmte Wasser nicht wieder abfließt, zum anderen schützt er vor einem Wärmeaustausch zwischen dem kalten Umgebungswasser und dem angewärmten Wasser rings um den Körper. Hinzu kommt natürlich noch die mechanische Schutzfunktion.
Ein guter Tauchanzug sollte deshalb relativ eng am Körper anliegen, um den Wasseraustausch gering zu halten. Kauft man den Anzug zu groß, so wird bei jeder Bewegung das warme Wasser hinausgepumpt und kaltes Wasser strömt ein. Dies führt in Folge sehr schnell zu einem unbehaglichen Kältegefühl. Außerdem darf ein Tauchanzug niemals die Blutzirkulation behindern, da dies unter Umständen weitreichende Folgen, wie beispielsweise eine Dekompressionserkrankung, haben kann.
Der Nasstauchanzug wird unter Umständen durch entsprechende Füßlinge, Handschuhe und Kopfhaube ergänzt. Der Kopfhaube kommt beim Wärmeschutz eine besondere Rolle zu, da über den Kopf bis zu 30% der Wärme abgeführt werden kann. Bei kalten Wassertemperaturen ist eine am Tauchanzug angesetzte Kopfhaube hilfreich, da diese den Wasseraustausch bei Kopfbewegungen im Nacken minimiert.
Hinsichtlich der Form unterscheidet man zwischen verschiedenen Schnitten von Nasstauchanzügen:
■ Shortie: kurzärmeliges Oberteil mit angesetzter kurzer Hose, das meist in den Tropen verwendet wird.
■ Longjohn: langärmeliger Overall mit langen Beinen, meist in warmen Gewässern und/oder beim Vorhandensein von Nesseltieren getragen.
■ Überweste: wird über den Longjohn gezogen und ist mit einer angesetzten Kopfhaube ausgestattet. Ab diesem thermischen Schutz kann man bei entsprechender Neopren-Dicke von einem guten Kälteschutz für kurze Aufenthalte im Ganzjahreseinsatz sprechen. Dazu gehören auch entsprechend warme Füßlinge und Handschuhe.
■ Eisweste: zusätzliche Isolierschicht, meist in Form einer ärmellosen Weste. Man kann durch die Namensgebung nicht unbedingt darauf schließen, dass sie für das Tauchen in eiskaltem Wasser geeignet ist.
6.4.2 Halbtrockenanzug
Im Volksmund wird der Halbtrockenanzug auch als „Halbnassanzug“ bezeichnet. Durch spezielle, wasseraustauschhemmende Maßnahmen wird hierbei lediglich der Wasseraustausch minimiert. Dabei handelt es sich z. B. um eng anliegende Glattneoprenbündchen an den Bein- und Armabschlüssen sowie am Hals. Die Reißverschlüsse sind entweder schon wasserdicht ausgeführt oder durch überlappende Unterlegung mit Glattneopren stärker abgedichtet.
Meist werden die Nasstauchanzüge in Dicken von 5–7 mm verwendet, um eine entsprechende adäquate Isolierung zu gewährleisten, während Halbtrockenanzüge bis hinunter in den Bereich von weniger als 1 mm angeboten werden (Lycraanzüge), die ausschließlich gegen nesselnde Tiere verwendet werden, wie z. B. in Australien während der Quallensaison.
Bei halbtrockenen Tauchanzügen gilt für die Passform das Gleiche wie für die Nasstauchanzüge, es muss hierbei lediglich auf eine gute Überlappung von Handschuhen und Füßlingen zu den Arm- bzw. Beinmanschetten geachtet werden, damit kein starker Wasseraustausch erfolgt oder die Haut direkt der Kälte ausgesetzt wird.
Hinweis. Die Kopfhaube verdient in diesem Zusammenhang eine besondere Erwähnung, denn ein Taucher verliert allein im Kopfbereich bereits mehr als 30% seiner Körperwärme, weshalb an der Kopfhaube niemals gespart werden sollte. Aus diesem Grund verwenden die meisten Höhlentaucher in kaltem Wasser auch zwei übereinandergezogene Kopfhauben.
Generell sollte bedacht werden, dass Neopren altert. Besonders tiefe Tauchgänge zerstören mit der Zeit die Struktur, und das Neopren verliert an Isolation. Daher sollte man die Lebensdauer eines Neopren-Anzugs durchaus kritisch hinterfragen. Meist sind die Anzüge nach 5 Jahren nicht mehr ausreichend isolationsfähig, in Tauchschulen und Basen tritt dieser Effekt entsprechend früher ein.
6.4.3 Trockentauchanzüge
Darunter versteht man Tauchanzüge, die das Wasser vom Körper fernhalten und die eingeschlossene Luft als Isolierungsmaterial verwenden. Da Luft im Gegensatz zu Wasser komprimierbar ist, muss das komprimierte Volumen durch Luft aus der Tauchflasche ersetzt werden. Handelt es sich bei dem Tauchanzug um einen Trilaminatanzug (unkomprimierbares Laminat), spricht man daher auch von einem Konstantvolumenanzug. Während Neopren durch die eingeschlossene Luft in der Tiefe komprimiert wird, bleibt Trilaminat unverändert. Das Komprimieren des Neoprens führt in der Tiefe zu verringerter Wärmeisolierung und auch zu einem reduzierten Auftrieb. Bei Neopren-Anzügen muss daher beachtet werden, dass ein „überbleiter“ Taucher, der sich an der Oberfläche mit voll aufgeblasenem Auftriebskörper noch über Wasser halten kann, in der Tiefe möglicherweise plötzlich in eine lebensbedrohliche Situation gerät, da sein Auftriebskörper ihn nicht mehr an die Oberfläche bringen kann. Dies ist insbesondere bei sehr tiefen Tauchgängen zu berücksichtigen und erklärt, warum hier vorrangig Trilaminat und Anzüge aus vorkomprimiertem Neopren eingesetzt werden.
Das vorkomprimierte Neopren ändert seine Eigenschaften in der Tiefe weitaus weniger und ist daher bei tieferen Tauchgängen praktischer und sicherer. Vor allem von Wracktauchern werden diese „Compressed-Neopren“-Anzüge gern verwendet, da sie stabiler gegen Schnitte an scharfen Wrackteilen sind als vergleichbare Trilaminatanzüge.
Jeder Trockentauchanzug verfügt über ein Einlassventil, um Gas zum Druckausgleich zuzuführen, und ebenso über mindestens ein Auslassventil, um sich ausdehnendes oder überschüssiges Gas wieder abzugeben. Somit ist der Trockentauchanzug ähnlich zu tarieren wie ein Tarierjacket.
Unterzieher
Unter Trockentauchanzügen werden im Normalfall Unterzieher als wärmende Isolierschicht angezogen. Diese sehen meist aus wie ein Ski-Overall und sind die eigentliche Isolationsschicht. Somit kann auch die Isolierung passend zur Wassertemperatur ausgewählt werden. Bei warmem Wasser genügt es auch, einen Jogginganzug unter dem Anzug tragen, bei sehr kaltem Wasser benötigt man einen dicken Thinsulate-Unterzieher, evtl. noch mit einigen Lagen Funktionsunterwäsche darunter.
Hinweis. Trockentauchanzüge und Unterzieher müssen gut passen. Im Zweifel sollte man einem Maßanzug dem Vorzug geben. In der Hocke muss der Taucher noch mit seinen Fingerspitzen die Schulterblätter berühren können, sonst ist die Bewegungsfreiheit zu gering.
6.5 Handschuhe
In tropischen Gewässern sind Handschuhe nicht gerne gesehen oder sogar verboten. Man möchte so vermeiden, dass Taucher Pflanzen und Tiere berühren und sich überall „festhalten“. Ein Paar dünner Lederhandschuhe bietet aber die Möglichkeit, sich z. B. beim Aufstieg an einer rostigen oder scharfen Ankerleine festzuhalten.
In kalten Gewässern sind Handschuhe lebenswichtig, da sie die Greiffähigkeit der Hände und das Gefühl in den Fingern bewahren. Sind diese Eigenschaften durch Unterkühlung verloren gegangen, so ist fast kein sinnvoller Handgriff mehr möglich Wie bei den Taucheranzügen, wird auch bei den Handschuhen nach den Kategorien Nass-, Halbtrocken- und Trockentauchhandschuhe unterschieden.
Selbst in sehr kaltem Wasser verwenden viele erfahrene Taucher vorzugsweise halbtrockene Fünffingerhandschuhe, um ein besseres Gefühl in den Händen zu haben. Welcher Handschuh für wen am besten geeignet ist, muss jeder Taucher selbst ausprobieren. Die Handschuhe sollten auf jeden Fall nicht zu weit geschnitten sein, damit der Wasseraustausch nicht zu groß ist, aber auch nicht zu eng, um die Blutzirkulation nicht zu behindern. Bei Trockentauchhandschuhen empfiehlt es sich, zum gasdichten Anschluss an die Arme des Tauchanzugs die bewährten Ring- oder Bajonettverschlüsse zu verwenden.
6.6 Auftriebskörper
Auftriebskörper, oft Tarierweste oder auch Jacket genannt, sind meist eine Kombination aus dem eigentlichen Auftriebskörper und einer Flaschenbefestigung. Das Jacket dient neben der Flaschenbefestigung dazu, den Taucher in die Lage zu versetzen, seinen Auftrieb zu regulieren. Zum Abtauchen wird Gas aus dem Jacket abgelassen, so dass der Taucher absinkt, sobald sein Auftrieb negativ wird. Dies ergibt auch eine der ersten Anforderungen an einen solchen Auftriebskörper: Er soll den Taucher nämlich auch mit voller Ausrüstung sicher an der Wasseroberfläche halten können. Taucher mit schweren Doppelgeräten und Lampen brauchen hierzu ein größeres Volumen, während der Warmwassertaucher auch mit einem kleineren Volumen auskommt.
Abb. 6.2: Ein Wing in Standardausführung, wie es sich tausendfach bewährt hat
In Europa sollten Auftriebskörper über eine CE-Zulassung verfügen. Das Gas wird über den so genannten Inflator in das Jacket befördert und kann über diesen auch wieder abgelassen werden. Meist gibt es noch einige andere Ablassventile zum schnellen Ablassen des Gases.
Immer mehr setzen sich sog. Wingjackets durch, kurz Wing genannt. Diese Auftriebskörper werden ausschließlich auf dem Rücken, seitlich der Flaschen getragen, daher auch der Begriff Wing (für engl. „Flügel“). Unter Wasser führt dies zu einer perfekten horizontalen Schwimmlage, an der Oberfläche jedoch kippt man damit eher nach vorne, so dass man sich meist zurücklegt, um dann in Rückenlage zu schwimmen. Wer Wings einmal ausprobiert hat, möchte oft nicht wieder auf ein herkömmliches Jacket umsteigen. In Kombination mit einer Rückenplatte (Backplate) haben sich die Wings in den letzten Jahren daher sehr stark verbreitet (Abb 6.2).
Für Einzelflaschen gibt es inzwischen auch „Wings“, die quasi wie ein O die Flasche umschließen. Dadurch kann es nicht zu einer einseitigen Luftverteilung
Kompaktinformation
■ ABC-Ausrüstung: Flossen entsprechend dem Trainingszustand und dem Einsatzzweck (Warmwasser, Geräteflossen etc.) auswählen. Je besser der Trainingszustand, desto härter kann das Flossenblatt sein. Maske muss dicht sein und bequem sitzen. Breiter Silikonrand und gegebenenfalls optische Gläser bevorzugen.
■ Tauchanzug: Je nach Einsatzgebiet und Jahreszeit zwischen Nass-, Halbtrocken- und Trockentauchanzug wählen. Lieber einen Anzug nach Maß, als einen schlecht sitzenden Tauchanzug wählen.
■ Tarierweste: Auftrieb nach Bedarf wählen, aber auf keinen Fall zu wenig. CE-Zulassung sollte vorhanden sein. Wing/Backplate-Kombination durchaus empfehlenswert.
■ Atemregler: Auf CE EN250 achten. Keine Billigware verwenden. kommen, da die Luft ja unten und oben an der Flasche auf die andere Seite wechseln kann. Diese zirkuläre Anordung des Auftriebskörpers hat sich in den letzten Jahren vermehrt im Sporttauchen etabliert.
6.7 Atemregler
Der Atemregler ist wahrscheinlich das wichtigste, aber auch das am meisten überschätzte Ausrüstungsteil. Es gibt heute fast keinen Atemregler mit CE-Zulassung, der wirklich schlecht oder gar gefährlich wäre, gleichwohl gibt es aber eine sehr große Anzahl mit den unterschiedlichsten Vor- und Nachteilen.
Der Atemregler besteht im Regelfall aus der Kombination einer ersten Stufe als Druckminderer des Flaschendrucks (bis zu 300 bar) auf den so genannten Mitteldruck (ca. 10 bar) und der zweiten Stufe als Mundstück mit integriertem Druckminderer auf den Umgebungsdruck. An der ersten Stufe befindet sich ferner häufig ein Druckanzeigegerät (Finimeter), um den verbleibenden Flaschendruck anzuzeigen und meist auch eine zusätzliche zweite Stufe als Ersatzautomat. Dieser sollte nicht, wie oftmals üblich, eine günstigere, weniger leistungsfähige Version des primären Automaten, sondern ein volles gleichwertiges Pendant dazu sein. Wer möchte schon im Notfall aus einer minderwertigen Luftquelle atmen?
Tipps für Tauchlehrer
1. Bei der Erziehung zu nachhaltig sicherem Tauchverhalten muss der Tauchlehrer Akzente setzen, z. B. auch durch bequeme und stets gut gewartete Leihausrüstung.
2. Keine Kompromisse machen: Der Kälteschutz muss vollständig sein; ein Oktopus oder zweite 1. Stufe (bei Wassertemperaturen < 10 °C) muss vorhanden sein, Nachttauchgänge sollten nur mit mindestens 2 Lampen pro Taucher durchgeführt werden.
3. Die neue Tauchausrüstung sollte unter einfachen Bedingungen erprobt werden; v. a. bei Trockentauchanzügen bietet sich für Übungen eine stabile Unterwasserplattform in 5–10 m Tiefe an.
4. Ein für Tauchlehrer in vielen Situationen wertvolles Hilfsmittel ist ein Schwimmkörper, der mittels Rollleine an der Hand mitgeführt wird (Orientierung in der Vertikalen, stabiler Halt etc.).
5. Zur Tauchausrüstung gehören auch Trinkflasche, O2-Koffer, Handy, Mütze.
Weiterführende Literatur ____________________________
1. Dederichs H, Wilhelm R: Tauchausrüstung. Müller Rüschlikon, Cham, 2005
2. Scheyer W: Tauchausrüstung von A bis Z. Delius Klasing, Bielefeld, 2005