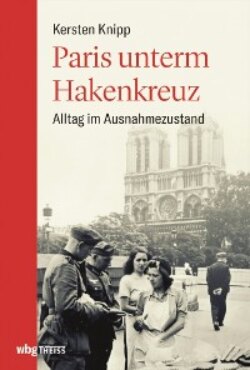Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Drôle de guerre« – Warten auf den Ernstfall
ОглавлениеSie sagen, dieser komische Krieg,
aber er ist eben nicht komisch; er ist düster.
Georges Bernanos
Wohin mit den Dingern? Sie sahen abstoßend aus, hässlich und furchteinflößend zugleich. Zog man sie sich über, war man kein Mensch mehr, war das gesamte Antlitz entstellt, verschwunden hinter einer zweiten Haut, die sämtliche Gesichtszüge auf monströse Weise verformte: die Augen um ein Vielfaches vergrößert, Nase und Mund vereint in einem absurden Rüssel, Haut und Haare verborgen unter einem grau-grünen Überzug, der die allerletzten Anklänge an ein menschliches Wesen tilgte. Gasmasken verliehen ihren Trägern etwas Gespenstisches, Urzeitliches, Außerirdisches, sie überzustreifen war ein radikaler Bruch mit aller Anmut.
»Jede Person mit festem Wohnsitz ist angehalten, für sich selbst und alle mit ihr zusammenlebenden Personen Schutzinstrumente gegen einen Gasangriff in Besitz zu nehmen«, gaben die Behörden im November 1938 bekannt.1 Ein Angriff durch Nazi-Deutschland schien schon wenige Wochen nach dem Münchener Abkommen nicht mehr auszuschließen. Der Schutz der Bevölkerung war dringend geboten, und so wurden die Masken in Massenproduktion hergestellt. Angesichts der potenziellen Gefahren war die Nachfrage groß – und doch: Offen umherlaufen mochte mit der Maske niemand. Es war wichtig, die Masken jederzeit bei sich zu haben. Aber man wollte sie nicht ständig sehen, wollte vor allem nicht ständig mit ihr gesehen werden. Zu brachial, davon waren insbesondere die modebewussten Damen überzeugt, war der Bruch mit dem übrigen Erscheinungsbild. Die ästhetischen Nöte vor Augen, reagierten die Designer umgehend. Rasch entwarfen sie verschiedene Taschen, Etuis und Behälter, in denen sich das lebensrettende Utensil diskret verbergen ließ. Teils in die Länge, teils in die Breite gearbeitet, mit einem Knopf oder einer Verschlusslasche versehen, in Grau, Kaki oder Grün gehalten und wie Handtaschen mit einem über die Schulter zu werfenden Riemchen ausgestattet, verbargen sie das ungeliebte und doch unverzichtbare Teil. Zumindest ästhetisch war der Krieg damit gebannt. Die Schönheit des Menschen würde er vorerst nicht mehr beeinträchtigen.
Doch Schönheit war nicht alles. Der Gedanke an den Schrecken des Krieges ließ sich nicht so leicht verbannen. In den ersten Septembertagen und -wochen war die Nervosität allgegenwärtig. Die von den Behörden herausgegebenen Ratschläge und Mitteilungen zum Selbstschutz enthielten zwar wichtige, im äußersten Fall sogar lebensrettende Hinweise. Sie machten den Bürgern aber auch das Ausmaß der potenziellen Gefahren bewusst. Der Petit Guide de Défense passive (»Kleine Anleitung zur passiven Verteidigung«), gedruckt in einer Auflage von 600.000 Exemplaren, informierte vom Mai 1939 an alle zwei Monate über die wichtigsten Verhaltensmaßnahmen. Dass die Leser diese nicht auf die leichte Schultern nehmen sollten, deutete bereits die Gestaltung an. Auf der Ausgabe vom Dezember war ein Neugeborenes in einer hermetisch abgeschlossenen Tasche zu sehen, die in Höhe des Kopfes ein durchsichtiges Plastikfenster hatte. Oberhalb davon war ein Luftfilter angebracht. Über ein Ventil war sie zudem mit einem Schlauch verbunden, der auf dem Bild direkt zu einer Gasmaske führte, die ein Arzt sich übergezogen hatte. Links von dem Mann stand eine junge Frau – vielleicht die Mutter, vielleicht eine Krankenschwester –, noch ohne Maske auf dem Kopf. Die Angriffe der Deutschen, gab das Foto zu verstehen, machten auch vor den Kleinsten nicht halt, also wappnet Euch, so die Botschaft. Im Inneren illustrierten Zeichnungen den richtigen Umgang mit den Masken. Ausführlich beschrieb das Heftchen, wie man die Maske aufsetzte. Denn nur wenn sie korrekt saß, konnte sie den Träger schützen. Zugleich aber, war dem Petit Guide zu entnehmen, musste man wissen, wann sie zu tragen war und wann nicht. »Während eines Angriffs darf man sich unter keinen Umständen von seiner Maske trennen«, hieß es in dem Begleittext. »Fehlen aber die toxischen Elemente, benutzen Sie die Maske nicht, um sich gegen den Rauch zu schützen, der sie beschädigen kann. Nehmen Sie stattdessen ein feuchtes Tuch.«2 Ähnlich konnte man es auf großen Anschlägen an Häusern und Mauern lesen.
Militärische Übung am Rond Point der Champs Elysées (Foto von 1939).
Gasmasken konnten Leben retten. Entsprechend groß war die Nachfrage. Und auch der Unmut, als sich herausstellte, dass längst nicht genügend Masken produziert waren. Die Versorgung hinkte dem Bedarf Nachfrage hoffnungslos hinterher. Am 1. September 1939 waren knapp 5,5 Millionen produziert worden. Nötig waren aber 16 Millionen allein für die Zivilbevölkerung, dazu noch einmal vier Millionen Ersatzmasken. »Die weitere Verteilung der Masken an Nachzügler ist bis auf weiteres eingestellt«, informierte Le Matin am 4. September, einen Tag nach der französischen Kriegserklärung, seine Leser. »Die Öffentlichkeit wird über die Wiederaufnahme der Verteilung unmittelbar informiert.«3 Bald entschloss sich die Regierung, die Masken zu verkaufen. 70 Francs kostete das Exemplar – für viele Franzosen keine geringe Summe. Das Leben, spotteten sie, hat für Arm und Reich fortan einen unterschiedlichen Preis. Doch nicht einmal mit Geld ließ sich das Überleben bei einem Gasangriff sichern: Im Mai 1940, wenige Tage vor Beginn der deutschen West-Offensive, standen den Bürgern gerade einmal etwas mehr als 10 Millionen Masken zur Verfügung. Doch auch wer eine Gasmaske besaß, mahnte die Zeitschrift Les Veillées des chaumières im Oktober 1940, sollte der eigenen Sterblichkeit gedenken, auch und gerade im Angesicht der Maske. »Der Anblick dieses in unserem Büro oder am Kopfende des Bettes hängenden Objekts sollte eine ständige Erinnerung an den Tod sein, der vom einen auf den anderen Moment kommen kann.«4 Und doch: Die Masken boten Schutz. Ein Beamter im Norden des Landes warnte Mitte September seine Vorgesetzten: Der Umstand, dass sämtliche Mitarbeiter der Verwaltung mit einer Maske ausgestattet worden seien, wecke beim Rest der Bevölkerung Ärger und Neid. »Es wäre darum wünschenswert, wenn die Maskenproduktion im großen Stil so schnell wie möglich vorangetrieben würde, um die Bevölkerung auf diese Weise zu beruhigen, die allgemeine Reizbarkeit zu mindern und jegliche Unruhe und Mutlosigkeit zu vermeiden.«5
Frustration und Ängste konnten die Masken aber auch vielen derjenigen Bürger nicht nehmen, die im Besitz einer solchen Maske waren. Über Gas in der Luft sollten eigens ausgerüstete Warnfahrzeuge informieren, die zu jeder Zeit durch die Straßen fuhren. Das entsprechende akustische Signal war ein kurzer, spitzer Ton, ein Umstand, der Streife fahrende Polizisten zu besonderer Verantwortung zwang: Schalteten sie für einen kurzen Moment das Horn ihres Wagens ein, veranlasste diese zumindest die besonders nervösen Passanten, sich hastig die Maske über das Gesicht zu streifen.
Die Défense passive gab weitere Schutzmaßnahmen bekannt: Drohte ein Angriff, waren vor Verlassen der Wohnung unbedingt Strom und Gas abzustellen. Scheiben waren mit Klebebändern zu verdunkeln, brennbare Gegenstände möglichst aus der Wohnung zu entfernen. Ganze Wohnungseinrichtungen wurden entsorgt, insbesondere Holzmöbel wanderten auf die Straße. Brauchte man sie nicht gerade zum Duschen, waren Badewannen bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Sollte es brennen, konnte man aus ihnen schöpfen. Erste-Hilfe-Etuis wurden angeschafft, ebenso wichtige Medikamente – Brandsalben etwa, sollte man den Flammen nicht schnell genug entkommen. Überall hingen Plakate aus, die den Weg zu den nächstgelegenen Schutzräumen wiesen. Schaffte man es trotz aller Vorbereitungen nicht rechtzeitig zur nächsten Schutzstation, empfahl sich neben dem Keller zur Not ein schmaler Graben im eigenen Garten. Ihn auszuheben kostete zwar ästhetische Überwindung, aber im Zweifel rettete er Leben. In Paris verwandelten sich mehrere Metro-Stationen in potenzielle Schutzräume. Bis zu 30.000 Menschen, so hatte es die Polizei errechnet, fanden in ihnen wie auch den Verbindungsfluren der großen Stationen Schutz. Sie alle wurden von den bereits installierten Sirenen gewarnt – 92 waren es allein in Paris, 128 in den Vorstädten. Ein vierminütiges Intervall steigender und fallender Töne kündigte einen Angriff an, ein drei Minuten anhaltender starrer Ton gab dessen Ende bekannt.
»Alle sprechen von einem Luftangriff«, schrieb Simone de Beauvoir am 4. September in ihr Tagebuch. »Niemals war Paris so schwarz.«6 Die Entschlossenheit, mit der die Wehrmacht in Polen vorging, ließ auch für Frankreich das Schlimmste befürchten. So lösten die Behörden wenige Tage später den ersten nächtlichen Alarm aus. Ein erster deutscher Vorstoß über die Landesgrenze könnte einen direkt folgenden Angriff auf die Hauptstadt einleiten, so die Sorge.
»In der Nacht tritt Gégé (Beauvoirs Freundin Geraldine Pardo, Anm. d. Aut.) in mein Zimmer: die Sirenen. Wir stellen uns ans Fenster. Die Menschen laufen unter einem schönen, mit Sternen übersäten Himmel zu den Schutzräumen. Wir steigen zur Loge hinunter, wo die Concierge schon ihre Gasmaske angelegt hat. Wir gehen wieder hinauf, in der sicheren Annahme, dass es sich um einen falschen Alarm handelt. Ich schlafe bis sieben Uhr.«
Ein Fehlalarm also. Doch worauf ging er zurück? Auf einen technischen Effekt? Oder funktionierte die Verteidigung? »Alle sprechen mit angsterfüllter Stimme vom Alarm der vergangenen Nacht. Man sagt, deutsche Flugzeuge hätten auf einem Aufklärungsflug die Grenze passiert. All das ist nicht sonderlich interessant, im Grunde sogar pittoresk. Man hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass nun tatsächlich Krieg herrscht; man wartet: worauf? Auf den Schrecken der ersten Schlacht?«