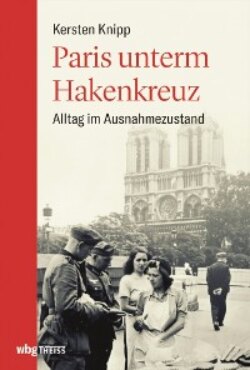Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Folie der Erinnerung: der Erste Weltkrieg
ОглавлениеSo standen die Franzosen ab dem 3. September 1939, einem Sonntag, im Krieg. Unglauben, Verblüffung, Verzweiflung. Am Nachmittag ließen sich die Stunden herunterzählen: noch drei, noch zwei, noch eine. Der Uhrzeiger rückte unaufhaltsam weiter. 17 Uhr: Der Frieden war vorbei. Eine unbekannte Zukunft stand bevor. Und eine nur allzu bekannte Vergangenheit schien sich zu wiederholen, die im Herbst 1918 mit der deutschen Kapitulation ihr Ende gefunden hatte, die nach über vier Jahren die Waffen endlich wieder hatte schweigen lassen. Insgesamt 7,5 Millionen junge Franzosen waren zwischen 1914 und 1918 eingezogen worden, rund 1,3 Millionen gestorben in dieser Zeit.11 »Die Abwesenheit ist in unserem Frankreich überall gegenwärtig«, hatte François Simon, Präsident des Souvenir français, der Gesellschaft zum Gedenken der Kriegsgefallenen, bereits im November 1917 auf dem Ostfriedhof von Rennes erklärt.
»Niemals haben die menschlichen Empfindungen eine derartige Prüfung durch die Trennung erlitten. Über Jahre waren in einem ganzen Volk die Ehefrau vom Ehemann, die Mutter vom Sohn, der Vater von den Kindern, der Sohn von seinen Geschwistern getrennt. Von der Trennung zum Tod ist es oft nur ein Moment. Zahllose Familien haben ihre Mitglieder in jene große Abwesenheit eintreten sehen, die man den Tod nennt.«12
Man hat es errechnet: Während des Ersten Weltkriegs starben an allen Fronten 6000 Menschen täglich. Tag um Tag riss der Tod tausende Menschen aus dem Leben, vernichtete die Hoffnungen und Pläne, die sie mit sich trugen. Er brachte aber auch deren Angehörige aus dem Gleichgewicht, konfrontierte sie mit einem Schicksalsschlag, den, sofern es überhaupt möglich war, zu ertragen enorme Kraft erforderte. Mehrere Seiten umfasste etwa jener Brief, den am 30. April 1915 Henri Boulard erhielt. Der Familienvater aus Paris hatte zwei Söhne, Lucien und Gabriel. Beide wurden im Herbst 1914 im Abstand von einem Monat eingezogen. Beide waren im Südosten von Verdun stationiert. Mehrere Wochen hielten die Eltern per Brief engen Kontakt zu den Söhnen, doch dann riss er ab. Ein am 26. April veröffentlichtes Communiqué des französischen Generalkommandos berichtete von schweren Kämpfen rund um jenen Abschnitt, in dem die Söhne ihren Dienst taten. Die Eltern waren unruhig, ertrugen die Ungewissheit um das Schicksal ihrer Söhne nur mit Mühe. Dann der Brief vom 30. April, verfasst wenige Tage zuvor von einem Kameraden Luciens. Dieser schrieb in aller Behutsamkeit. Zunächst berichtete er von einem Brief, den er selbst kurz zuvor, am 25. April, von einem weiteren Kameraden erhalten hatte. Darin fände sich eine Auskunft über Lucien. Dann erwähnte er den christlichen Glauben des Vaters, in dem er Trost finde, und appellierte an dessen Kraft, um schließlich zum Eigentlichen zu kommen: »Und nun erlauben Sie mir, Ihnen mitzuteilen, was ist: Dem erhaltenen Brief zufolge hat es Gott gefallen, Ihren Sohn Lucien zu sich zu rufen. Es ist hart, was ich Ihnen sage; ich selbst leide und beweine mit Ihnen denjenigen, den ich so wenig gekannt und doch so sehr gemocht habe.«13 Henri Boulard behielt die Nachricht für sich. Seiner Frau gegenüber erwähnte er den Brief nicht – vielleicht handelte es sich ja doch um ein Missverständnis? Stattdessen schrieb er dem zuständigen Bataillonschef. Dessen Antwort traf am 7. Mai ein. Sie bestätigte die schlimmsten Befürchtungen: »Ich teile Ihnen mit Bedauern mit, dass Ihr Sohn Lucien am 20. April auf dem Feld der Ehre gefallen ist; was Ihren Sohn Gabriel angeht, er wurde am 24. April als vermisst gemeldet, es ist anzunehmen, dass er in Kriegsgefangenschaft geriet.«
Briefe wie diesen erhielten Hunderttausende französischer Familien. Sie veränderten das Leben der Angehörigen mit einem Schlag, zwangen sie, mit dem Verlust von Menschen zurechtzukommen, die ihnen unendlich viel bedeuteten. Andere Familien hatten mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, etwa einer jahrelangen Ungewissheit über das Schicksal ihrer Mitglieder. Auch die Familie Lhéritier schickte zwei Söhne in den Krieg: Jules und François.14 Der Ältere war bereits im Herbst 1914 an der Front. Im November 1916 erhielt die Familie eine beunruhigende Nachricht: Jules galt als vermisst. Lebte der Sohn noch oder war er tot? Hoffnung und Verzweiflung wechselten einander ab, verbunden allein durch die ständige, nicht zu überwindende Unruhe, die sich fortan in den Alltag der Familie schlich. Die Hoffnung ließ abschließende Trauerarbeit nicht zu, ein endgültiger Abschied angesichts der Ungewissheit war unmöglich. Die Eltern und die Verlobte schrieben Briefe an die zuständigen Kommandanten, doch die konnten nichts sagen: Von Jules fand sich keine Spur. Nichts wies darauf hin, dass er noch am Leben war, doch auch sein Tod ließ sich nicht bestätigen. Anfang November 1916, ergab die Aussage eines Kameraden, habe Jules noch gelebt. Ein weiterer Kamerad meldete sich: Am 16. November, also elf Tage, nachdem Jules als vermisst gemeldet worden sei, habe er ihn noch gesehen. Doch auch diese Nachricht ließ sich nicht erhärten. Anfragen an das Außenministerium, ob er in Russland in Kriegsgefangenschaft geraten sein könnte, brachten ebenfalls keine befriedigende Antwort. Einer im Frühjahr 1919 geschlossenen Vereinbarung zufolge müssten sämtliche Kriegsgefangenen innerhalb von drei Monaten nach Hause zurückgebracht worden sein. Doch Jules war offensichtlich nicht unter ihnen. Im Juni 1921 dann erhielten die Eltern einen Brief vom Ministère des pensions, jener staatlichen Agentur, die sich um die Kriegsgräber kümmerte: Man sei damit beschäftigt, den Tod eines vermissten Soldaten zu bestätigen. Der Prozess zog sich hin. Am 23. November dann ein weiterer Brief: Jules’ Status als vermisster Soldat habe sich geändert: Er gelte nun als im Kampf gefallener Soldat. Über fünf Jahre hatte es gedauert, bis die Familie Gewissheit erhielt: Der Sohn und Verlobte war tot. Spätere Aufräumarbeiten auf den ehemaligen Schlachtfeldern brachten dann die letzte Bestätigung: Man fand Jules’ Identifikationsmarke an eben jenem Ort, an dem er als vermisst gemeldet worden war.
Nun endlich konnte die Trauerarbeit beginnen. Doch sie war schwer, kaum erträglich. Jules Lhéritier hatte sich kurz vor seiner Einberufung ein Fahrrad gekauft. Als er eingezogen wurde, deponierte der Vater das Fahrrad auf dem Dachspeicher des Hauses. Wenn der Sohn zurückkomme, so die Hoffnung, würde er sich über sein gut erhaltenes Fahrrad freuen. Doch der Sohn kam nicht zurück. Das Fahrrad wurde zu einer Reliquie. Kein Familienmitglied durfte es anrühren. Über Jahrzehnte steht es auf dem Speicher, als Symbol der Lebenslust des Sohnes, seiner Hoffnungen und seiner abrupt aus dem Leben gerissenen Jugend. Das Fahrrad stellte eine Verbindung zu dem Toten her, es einte die Lebenden und Gestorbenen. Es war Zeugnis einer unwiederbringlichen Vergangenheit und garantierte doch, dass diese Vergangenheit zumindest symbolisch in die Gegenwart reichte. Es war, als hafte an diesem Fahrrad noch das Leben des Verstorbenen, als wäre er über seine materielle Hinterlassenschaft mit seinen Angehörigen weiterhin verbunden. Briefe, Portemonnaies, Medaillen: Alle konnten sie zu Objekten des Gedenkens werden, auf lange Zeit bewahrt in Schatullen, Schubladen und Truhen, in Schränken, Kommoden, Regalen. Hinzu kamen als offensichtlichste Erinnerung die Fotos, nach dem Ende der Kämpfe zu Hunderttausenden in (nicht nur) französischen Haushalten aufgestellt. »Meine ganze Kindheit über«, zitierte der Historiker Pierre Barral einen Bericht seines Onkels Lucien Boulard, »habe ich mich wie tausende meiner Zeitgenossen daran gewöhnt, zuhause das Foto eines jungen Soldaten in blauer Uniform zu sehen. Er wurde mit 21 Jahren an der Front getötet – der Bruder meiner Mutter.«15
Die Angehörigen wollten Gewissheit über ihr Schicksal. Lebten die Väter, Ehemänner, Brüder, Söhne noch oder waren sie tot? Wenn sie tot waren: Wie kamen sie ums Leben? Wurden sie von feindlichen Maschinengewehren getötet? Erstickten sie während eines Gasangriffs? Wurden sie von einer Bombe zerrissen? Waren sie sofort gestorben oder zog sich ihr Tod lange hin, womöglich unter quälenden Schmerzen? Hätte eine andere Kriegsführung ihren Tod vermeiden können? Wo befanden sich ihre sterblichen Überreste? War der Vater oder Ehemann womöglich eine der vielen nicht mehr identifizierbaren Leichen, die Schlacht für Schlacht auf dem Feld zurückblieben? Bohrende, quälende Fragen, die sich für zahllose Familien stellten, die ihnen nachts den Schlaf und tagsüber die Seelenruhe raubten – und die doch, teils über Jahre, die Hoffnung nicht ganz sterben ließen: Vielleicht kam der Totgeglaubte ja doch noch zurück, vielleicht ereignete sich am Ende doch noch ein kleines Wunder?
Hinzu kamen die apokalyptischen Bilder aus dem Norden des Landes: die Mondlandschaft rund um Verdun, die gespenstisch in den Himmel ragenden Baumstümpfe, Sinnbilder der totalen Zerstörung, die dieser Krieg entfachte. Sie machten eindrücklich klar, in welchem grauenhaften Inferno die Vermissten ihre letzten Lebensstunden oder Minuten verbracht hatten. Die bestürzenden Bilder der Gueules cassées, der durch Geschosse furchtbar entstellten Gesichter einiger Überlebender des Krieges, verstärkten den Eindruck des Schreckens, den die Menschen nach dessen Ende zu verarbeiten hatten. Die jegliche Individualität verhöhnende Gleichgültigkeit dieses Krieges fand ihre kulturelle Deutung in dem Kenotaph, dem Symbol des leeren Grabes, das die Franzosen vor dem Nationalfeiertag am Arc de Triomphe errichteten. Der unbekannte Soldat wurde zum neuen Helden des Kriegs. Denn angesichts so vieler Toten verbot es sich, einzelne heldenhafte Figuren gesondert zu ehren. Das Gedenken an sie würde das an die zahllosen anderen, anonymen Kämpfer verdrängen. In einer demokratischen Armee, deren Mitglieder allesamt die Freiheit ihres Landes verteidigen, war so etwas nicht mehr denkbar.16 Stattdessen entstanden überall im Land Gräber des unbekannten Soldaten, an denen die Menschen ihrer Vermissten und Toten gedenken konnten. An den Stätten der großen Schlachten, etwa bei Verdun, wurden ossuaires, Gebeinhäuser, für die vielen nicht mehr identifizierbaren Toten eingerichtet. Überall im Land wurden Monumente für die Gefallenen errichtet, die in sie eingravierten Namen der Toten erinnerten an die zahllosen Opfer, waren schmerzhafte Erinnerung, dokumentierten aber auch, wie sehr der Tod die Nation als Ganze getroffen hatte, dass die Trauer alle Bürger verband. Freilich war dies für die jeweils individuelle Trauer oft nur ein schwacher Trost – das offizielle Gedenken, die Rituale konnten den millionenfach empfundenen persönlichen Schmerz bestenfalls im Ansatz auffangen. All dies warf eine bohrende Frage auf: Wozu? Wofür waren so viele Menschen gestorben? Der Schriftsteller Jean Guéhenno gab darauf in seinem 1934 erschienenen Buch Un homme de quarante ans eine bittere Antwort:
»Meine Freunde sind für nichts gestorben. Für weniger als nichts, wenn diese Millionen verderbender Körper Europa vergiften, wenn jedes Grab ein Altar ist, auf dem Rache und Hass kommunizieren, wenn wir seit zwanzig Jahren ich weiß nicht welchem Ruhm des Blutes und des Todes weichen. All dies, in das so viel Herzblut floss, war nur eine nutz- und maßlose Dummheit. Wenn all das nicht gewesen wäre, ginge es der Welt heute besser.«17
Das Gedenken an die Toten mochte über 20 Jahre später abgeklungen sein. Doch die Drohungen und ab dem 3. September 1939 dann auch sehr realen Aggressionen aus Deutschland weckten die Erinnerungen neu. So war die Nachricht vom Krieg bedrückend, fast lähmend. Die älteren Franzosen erinnerten sich deutlich an den Ersten Weltkrieg, die jüngeren kannten ihn aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Gefallene Soldaten wie auch zwischen 1914 und 1918 getötete Zivilisten gab es in jeder Familie, die Lücke, die sie hinterlassen hatten und weiter hinterließen, legte auch nach Jahrzehnten noch eindringliches, sehr persönliches Zeugnis von den Schrecken des modernen Krieges ab. Dass die Deutschen nun wieder einen Krieg begannen, war schwer zu fassen. »Sie sind dieselben geblieben«, schrieb Le Matin am 5. September. »Man hat die Deutschen nicht verändert! Wir finden sie 1939 so wie wir sie 1918 gelassen hatten. Sie waren grausam und stupide, sie sind grausam und stupide geblieben. Vielleicht sind sie noch grausamer und stupider als zuvor.«18