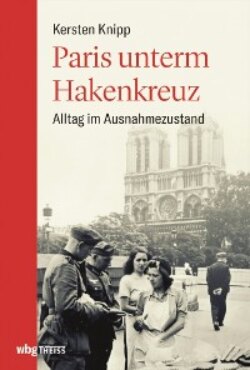Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Reich und Rätsel
Diplomatische Manöver in den 1930ern
ОглавлениеIm Schatten könnte man das Objekt meiner Klagen nicht sehen
Eine allzu schwarze Hinterhältigkeit
Aragon, Sans mot dire
Als Marschall Philippe Pétain am 17. Juni 1940 ans Mikrofon trat, befand sich das Land im freien Fall. Hunderttausende waren auf den Straßen, hatten Hals über Kopf ihre Häuser verlassen, um der Gefahr zu entgehen. Der Feind hatte das Land geradezu überrannt, war in einem nie für möglich gehaltenen Tempo vorgestoßen und hatte weite Landesteile unterworfen. Paris war zur »Offenen Stadt« erklärt, war, in anderen Worten, für den Einmarsch des Feindes freigegeben worden. Ebenso stand es um die anderen Städte des Landes. Die Erfolgsmeldungen der ersten Tage nach der deutschen Offensive hatten sich als falsch erwiesen, waren nach und nach verstummt, nun lag die Wahrheit unabweisbar auf der Hand: Die militärische Führung und mit ihr das Land hatten ein nie dagewesenes Desaster erlitten. Kämpfte man weiter, würde Frankreich in eine Katastrophe stürzen, wären weit mehr als die während der vergangenen Wochen 90.000 Gefallenen zu beklagen. Dem Land stünde ein Vernichtungsfeldzug bevor, dessen Ausmaße man sich kaum würde vorstellen können.
Schluss also mit dem Widerstand. Es war an der Zeit, der Bevölkerung die Wahrheit zu sagen, so sie diese nicht längst schon selbst erkannt hatte: Frankreich hatte den Krieg verloren. Dem Land blieb keine andere Wahl, als sich dem Feind zu ergeben. So gab Marschall Pétain das Unvermeidliche bekannt. »Français!«, wandte er sich an die Zuhörer, »Franzosen!« Als solche, signalisierte der Sprecher, sollten sich die Zuhörer im Moment der Rede fühlen – als Angehörige einer auch in der Niederlage geeinten Nation, als Menschen, die tapferen Widerstand geleistet hatten, nun aber besiegt waren.1 Damit aber auch als Bürger eines Landes, dem schwere Zeiten bevorstünden.
Der Redner verkündete nicht die Niederlage, sondern deren erste Konsequenz, die Regierungsumbildung am Vortag gegen 23 Uhr. Premierminister Paul Reynaud hatte sein Amt nach nicht einmal 90 Tagen abgegeben und Platz gemacht für ihn: Philippe Pétain, den Veteran und Kriegshelden von Verdun, der sich in dieser Situation per Radio an seine Landsleute wandte.
Seit er im Februar 1916 zum Befehlshaber der in die Defensive geratenen französischen Truppen bei Verdun ernannt worden war, war Pétain ein nationaler Held, genoss er ein Ansehen, wie es bislang keinem anderen Franzosen des 20. Jahrhunderts zuteil geworden war. Gewiss, es gab andere große Militärs – Marschall Ferdinand Foch, Marschall Joseph Joffre, General Joseph Gallieni –, doch allenfalls Foch, der auf der Lichtung von Compiègne im November 1918 seine Unterschrift unter den Waffenstillstandsvertrag mit den besiegten Deutschen gesetzt hatte, konnte es an Ruhm mit Pétain aufnehmen. Denn es war Pétain, dessen Name sich in der Erinnerung mit dem französischen Triumph der Schlacht von Verdun verband. Im Februar 1916 war das strategisch bedeutsame Fort Douaumont gefallen. Eine Niederlage der französischen Truppen schien absehbar. In diesem Moment vertraute die Heeresleitung das Kommando dem wenige Monate zuvor zum Général d’Armée, dem ranghöchsten französischen General, beförderten Kommandanten an, der bereits wiederholt sein taktisches Genie bewiesen hatte. Schon die Ernennung flößte den Soldaten Vertrauen ein. »Der Meister kommt, und wie von Zauberhand fassen sich diejenigen wieder, die vorher den Kopf verloren hatten und am Rand der Panik standen«, notierte ein Kommandant. »Von Neuem zu allem bereit, stehen sie gegen das furchtbarste Bombardement, das die Deutschen (im Original: »les boches«) jemals gegen uns losgelassen haben.«2 Der »Meister« und seine Berater bewiesen ihre Kreativität umgehend: Sie schufen das System der »noria« – wörtlich »Schöpfrad« –, ein Versorgungssystem für die Front. Zwischen der Ortschaft Bar-le-Duc und dem rund 60 Kilometer entfernten Verdun ließ Pétain eine Kette von 8000 Lastwagen rotieren, beladen mit allem, was die Soldaten an der Front brauchten. Alle 14 Sekunden startete ein Fahrzeug mit Material oder Soldaten. 90.000 Rekruten und 50.000 Tonnen Kriegsgerät wurden auf dieser Voie Sacrée – der »heiligen Strecke«, wie der Schriftsteller Maurice Barrès sie nannte – Woche um Woche an die Front und nach dem Einsatz von dort wieder zurückgebracht. Ebenso ließ Pétain die in Verdun kämpfenden Divisionen nach einem festen Rhythmus auswechseln – mit der Folge, dass von den 95 Divisionen des Heeres schließlich 80 in Verdun gekämpft hatten, wodurch die Festungsstadt für mehrere Generationen zu einem Ort gemeinsam geteilter Erfahrung wurde. »Verdun« wurde zu einer Erinnerung, die sich mit der Biografie hunderttausender junger Franzosen verknüpfte. Pétain selbst wurde nur wenige Wochen später, im April 1916, zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. »Dank seiner Ruhe, seiner Festigkeit, seinem organisatorischen Geschick vermochte er eine schwierige Situation zu wenden und allen Vertrauen einzuflößen. So leistete er dem Land bedeutsamste Dienste.«3 In ganz Frankreich galt Pétain fortan als »Held«, als »Sieger« von Verdun.
Dieser Mann, geboren 1856 und im Jahr der Niederlage gegen die Wehrmacht 1940 mithin 84 Jahre alt, unternahm es nun, die Franzosen über die Kapitulation zu informieren. Auf Aufforderungen des Staatspräsidenten habe er die Leitung der Regierung übernommen, ließ er seine Landsleute wissen. »Der Zuneigung unserer bewundernswerten Armee gewiss, die mit einem ihrer langen militärischen Traditionen würdigen Heldenmut gegen einen an Zahl und Waffen überlegenen Feind kämpft, … des Vertrauens der gesamten Bevölkerung gewiss, mache ich Frankreich die Gabe meiner Person, um sein Unglück zu mildern.«
Was für ein Wort: »die Gabe meiner Person«. Noch ein weiteres Mal, gab Pétain, 1918 zum Marschall von Frankreich ernannt und damit Träger der höchsten militärischen Auszeichnung überhaupt, damit zu verstehen, würde er seine soldatische Pflicht erfüllen und sich in den Dienst des Landes stellen – dieses Mal nicht als Sieger, sondern als Verwalter der Niederlage. »In diesen schmerzhaften Stunden denke ich an die unglücklichen Flüchtlinge, die in äußerstem Elend über unsere Straßen ziehen. Ich erkläre ihnen mein Mitgefühl und meine Anteilnahme. Schweren Herzens sage ich Ihnen heute, dass wir den Kampf beenden müssen.« Indem der oberste Soldat der Zivilisten gedachte, stellte er ein Band zwischen Armee und Bevölkerung her und unterstrich ihrer beider unverbrüchliche Verbundenheit mit der Republik, die in diesem Moment ihre Niederlage einräumte. Pétains Aufgabe würde es nun sein, die Niederlage zu »verwalten«, das heißt, die Republik mit geringstmöglichem Schaden durch die Zeit der anstehenden Besatzung zu führen. Das aber setzte voraus, dass die französische Regierung die Niederlage offiziell anerkannte und um einen Waffenstillstand ersuchte. Eben das, informierte Pétain die Franzosen, habe er in der vergangenen Nacht getan. Er habe den Gegner gebeten, »mit uns, unter Soldaten, nach dem Kampf und in Ehre« die Möglichkeiten zu erkunden, die Feindseligkeiten zu beenden.« Alle Franzosen, forderte Pétain seine Landsleute auf, »mögen sich während der schweren Prüfungen um die Regierung sammeln, die Angst schweigen lassen und nur auf ihren Glauben an das Schicksal des Vaterlandes hören.«
Nicht einmal zwei Minuten dauerte die Rede, die Frankreichs Schicksal für die nächsten vier Jahre besiegelte. Sie wies das Land in eine Zukunft, die zur Probe für die ganze Nation wurde. Diese Probe ließ manche Bürger zu Helden werden und andere zu Verrätern. Die meisten aber blieben, was sie immer gewesen waren: Menschen ohne Hang und ohne Drang zu den moralischen Extremen, sondern einzig darauf bedacht, ihr Leben den Umständen anzupassen. Sicher war nur: Die Umstände, wie immer sie aussähen, wären ganz andere als die bislang gewohnten. So markierte die Rede nicht weniger als eine Zeitenwende. Darum, schreibt Pétains Biografin Bénédicte Vergez-Chaignon, blieb den Franzosen die Rede als ein Markstein ihrer jeweiligen Biografie in Erinnerung. Sie stand für einen Punkt, an dem etwas unheilvoll Neues begann, an dem das Vertraute dem Unvertrauten wich, das Leben in Freiheit in die Unterwerfung unter eine fremde Siegermacht mündete. So verwob sich diese Rede mit den ganz persönlichen Umständen von Millionen Biographien.
»Man weiß, welches Ereignis diese Rede in der französischen Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellt. Zahlreich sind die Zeugen, die erzählten, unter welchen Umständen sie diese Rede gehört hatten, wie ihre Reaktionen und die ihrer Umgebung ausfielen: Überraschung, Erleichterung, Ungläubigkeit, Schmerz, Unruhe, Verzweiflung, Wut. Das Kommuniqué, sehr neutral gehalten, durch das die Bildung einer durch den Marschall geführten Regierung angekündigt worden war, hatte nichts über dessen Absichten durchblicken lassen. Der Ruf und das Bild Pétains mochten den Franzosen durchaus bekannt sein – seine Stimme war es kaum. Die Form der Nachricht, von so eminenter Öffentlichkeit, so überraschend gekommen, nachdem der Marschall sich so sorgsam im Hintergrund gehalten hatte, verstärkte ihre Wirkung, indem sie ihr den Eindruck außergewöhnlicher Erhabenheit verlieh.«4
Pétain sprach nicht nur am 17. Juni zu den Franzosen. Diese Rede bildete den Auftakt zu weiteren Ansprachen, in denen er sich während der folgenden Tage an seine Landsleute wandte. Am 20. Juni griff er eine Frage auf, die fast alle Franzosen beschäftigte, auf die sie keine Antwort wussten, und von der sie lange Zeit angenommen hatten, sie sich auch niemals stellen zu müssen: Warum hatte Frankreich den Krieg verloren? Für Pétain war die Antwort klar. Vier Gründe hätten das Land in die Niederlage geführt: Frankreich habe wenige Freunde, zu wenige Kinder, zu wenige Waffen, zu wenige Verbündete. Die Antwort, die Pétain gab, war die erste – und kurzfristig wirkungsmächtigste – einer seitdem nicht mehr abreißenden Reihe von Erklärungen und Deutungen, die das schier Unbegreifliche verständlich und nachvollziehbar zu machen versuchten.
Pétain gab nicht nur die früheste Antwort auf die Frage der Niederlage. Er formulierte sie auch in Worten, deren Milde sich die späteren Kommentatoren zumeist nicht anschließen mochten. Die Franzosen, deutete der Marschall an, hätten sich nichts vorzuwerfen. Sie hätten im Grund alles – fast alles jedenfalls – richtig gemacht. Gescheitert seien sie an den äußeren Umständen, an Verhältnissen, an denen sie kaum etwas hätten ändern können. Das mochte angemessen sein in einem Moment, in dem sich die Franzosen, betäubt von der Niederlage, erst einmal fassen mussten. In Zeiten, in denen der Schock alle Analysefähigkeit außer Kraft setzt, ist für tiefergehende Diagnosen kein Raum, muss die intellektuelle Aufarbeitung hinter der psychologischen Verarbeitung zurückstehen – und mit ihr auch der politische Streit um die Verantwortung für die Niederlage. Denn die Frage, wer und was dazu geführt hatte, dass Frankreich dem deutschen Angriff von Anfang an nicht gewachsen gewesen war, dass sich eine der an Schlagkraft höchstgeschätzten Armeen der Welt dem Aggressor bereits wenige Wochen nach Beginn der Angriffe im Mai 1940 hatte geschlagen geben müssen, stand unweigerlich im Raum. Zahllos die Analysen, Gründe und Rechtfertigungen, die unmittelbar nach der Niederlage genannt wurden, zahllos auch die Positionen, Standpunkte und Argumente, die in den kommenden Tagen, Wochen und Jahren geäußert wurden, die eine Diskussion in Gang setzten, die auch heute, 80 Jahre später, noch nicht endgültig zu ihrem Ende gekommen ist. Klar war nur, dass sich viele von Pétains Zuhörern mit seinen Worten nicht zufrieden geben würden. Seine Erklärung mochte dem Schock der Stunde entsprechen. Aber als ernst zu nehmende Antwort wurde sie zurückgewiesen, kaum dass sie gehört worden war.
In der Tat endete die Rücksichtnahme auf die kollektive Depression sehr schnell. Pétains Rede traf umgehend Widerspruch – und zwar von ihm selbst. In einer weiteren Rede, dieses Mal vom 25. Juni, in der er seine Landsleute über die Bedingungen des Waffenstillstands unterrichtete, ließ er sie zugleich seine jüngste Deutung der französischen Niederlage wissen. »Unsere Niederlage kam von unserer Erschlaffung. Genusssucht zerstört, was unsere Opferbereitschaft errichtet hat. Ich rufe Sie zunächst zu einem intellektuellen und moralischen Neubeginn auf. Franzosen, Sie werden dies vollbringen und Sie werden – ich schwöre es Ihnen – aus Ihrer Glut ein neues Frankreich entstehen sehen.«5 Pétains Rede war trotz ihres aufmunternden Schlusses eine Abrechnung: Die Franzosen hatten sich seiner Einschätzung nach schlicht nicht hart genug geschlagen. Hätten sie mehr Einsatzfreude gezeigt, hätten sie den Krieg gewinnen können. Damit korrigierte er seinen früheren Eindruck: Die Niederlage hatte für ihn nun nicht nur angeblich unveränderliche strukturelle und materielle Gründe, sondern auch – vielleicht sogar vor allem – moralische. Sie gründete, so deutete er an, in mangelndem Kampfgeist.
Der Kampfgeist allerdings braucht Anleitung. Er muss wissen, gegen wen er sich wo und wann zu richten hat. Damit hängt er ganz wesentlich von den Kommandeuren, den Befehlshabern ab, und zwar bis in deren oberste Spitze. Genau die habe aber versagt, befand umgehend nach der Niederlage der Historiker Marc Bloch. Er schloss sich bald der Résistance an, dem französischen Widerstand, als dessen Mitglied er 1944 von der Gestapo verhaftet und zu Tode gefoltert wurde. Bloch, Jahrgang 1886 und trotz seines fortgeschrittenen Alters 1940 freiwillig als Offizier hinter der Front tätig, verortete die Gründe der Niederlage ganz anders als Pétain, nämlich im eigenen Land, genauer: bei den Generälen, die den Krieg gegen Hitler geführt hätten. Mit ihnen ging er in aller Härte zu Gericht: »Wir haben eine ungeheure Niederlage erlitten«, schrieb er in seiner 1946 posthum erschienen Analyse L’étrange défaite. »Wo liegen die Fehler? Beim parlamentarischen Regime, bei der Truppe, bei den Engländern, bei der fünften Kolonne, antworten unsere Generäle. Letztlich bei allen, außer bei ihnen.«6 Mit scharfem Sarkasmus wandte sich Bloch gegen die militärische Führung des Landes, die seiner Einschätzung nach das Desaster ganz wesentlich zu verantworten hatte. Die Soldaten, erklärte er, hätten ihre Pflicht erfüllt. Doch die Generäle hätten es versäumt, Pläne zu entwickeln, durch die sie den Mut der Soldaten in einen Sieg hätten ummünzen können. Diese Antwort ging ebenfalls gnädig mit den Rekruten um. Doch wie Pétain verortete auch Bloch die Verantwortung im eigenen Land: Dessen Führung sei unfähig gewesen, die Bedrohung durch einen Aggressor abzuwehren und diesem die verdiente Niederlage beizubringen. Zwischen diesen beiden Polen, der Macht kaum zu ändernder Umstände und dem Versagen der militärischen und – auch dieser Vorwurf wurde bald erhoben – politischen Elite, verläuft seitdem die Debatte über die Gründe dieser einzigartigen, in diesem Tempo und dieser Deutlichkeit kaum für möglich gehaltenen Niederlage. Und es war Bloch, der als Erster die umfassenden Gründe des Debakels erfasste, einer Katastrophe, deren Ursachen weit über militärische Unfähigkeit hinauswiesen. Die Vorgeschichte des Desasters gründete neben der militärischen auch in der politischen, ökonomischen und kulturellen Verfassung eines Landes, dessen Bürger während langer Jahre über seine Identität gestritten und sich über seinen politischen Kurs nicht hatten einigen können. Die Franzosen, stellte sich nach der Niederlage heraus, hatten sich auf eine Grundvoraussetzung eines funktionierenden Gemeinwesens, den Streit, in einer solchen Intensität eingelassen, dass sie sämtliche Gemeinsamkeiten darüber vergessen hatten. Die res publica, die gemeinsame Sache, gab es nicht. Stattdessen gab es verschiedene Fraktionen, die um die Deutungshoheit über diese Sache stritten. Ein Ende hatte dieser Streit über Jahre nicht gefunden – auch nicht zu einer Zeit, da die Notwendigkeit der Versöhnung angesichts eines immer lauter agierenden Polit-Rüpels im Nachbarland dringend geboten schien. Die unversöhnlichen Gegensätze im eigenen Land standen einer angemessenen, von allen Bürgern getragenen Antwort weiter im Weg. Für Nazi-Deutschland bot das eine wunderbare Gelegenheit, sich in Frankreich bereits Jahre vor dem Angriff als Akteur zu positionieren, an dem kaum jemand mehr vorbeikam. Als böser Geist schwebte Hitler seit Jahren über dem Land. Den Rest besorgte seine Propaganda, die nicht nur die Franzosen, sondern auch die anderen Nachbarn, allen voran die Briten, lange – allzu lange – hinzuhalten verstand. Als man erkannte, dass dieser Geist vor nichts zurückschreckte, hatte der seine Armeen schon losgeschickt. Und zwar, wie insbesondere das französische Militär erfahren musste, auf ausgesprochen listenreiche Weise.