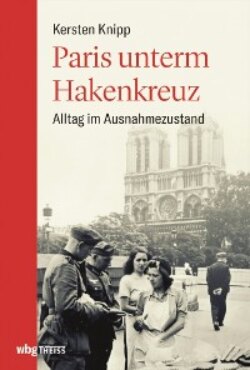Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Abgründe der Verständigung
ОглавлениеDie Kursbestimmung fiel auch darum schwer, weil das Regime in Berlin die Nachbarstaaten über seine Absichten konsequent im Unklaren ließ. »Der unerbittliche Todfeind des deutschen Volkes ist und bleibt Frankreich«, hatte Hitler in Mein Kampf geschrieben. Doch Äußerungen wie diese, erklärte er als Reichskanzler seinen französischen Gesprächspartnern, hätten sich überlebt, seien nicht mehr Grundlage seiner Politik. Er wünsche sich ein Ende des Wettrüstens, erklärte er 1934 gegenüber Vertretern der führenden französischen Veteranenverbände. Eine deutschfranzösische Aussöhnung, in ganz Europa als Ende eines Alpdrucks empfunden, würde Psyche und wirtschaftlichen Unternehmungsgeist der Völker beflügeln. »Von unseren beiden Völkern hängt es ab, dass dieser Traum verwirklicht wird.«25 Das Wort fiel wenige Wochen, bevor die Bürger des unter dem Mandat des Völkerbunds stehenden Saargebiets im Januar 1935 über die Zugehörigkeit der Region zu Frankreich oder Deutschland entschieden – Anlass für Hitler, die Bürger des Gebiets nicht durch martialische Töne zu verschrecken, sondern sie im Gegenteil durch die ausgestreckte Hand für sich – für das Dritte Reich – einzunehmen. Ein Vorgehen wie dieses war typisch für die Propagandavorstöße aus Berlin: Sie suchten die Franzosen nicht nur allgemein über die tatsächlichen Absichten rätseln zu lassen. Sie intensivierten sich immer dann, wenn die Lage besonders kritisch wurde, etwa vor der Remilitarisierung des Rheinlands oder der Annexion Österreichs. Die an die französische Bevölkerung gerichteten Appelle nahmen vorzugsweise den Weg über die Jugendverbände, aber auch über die Veteranenverbände. Frankreich hatte deren mehrere: zum einen die Union fédérale mit rund 900.000 und die etwas weiter rechts stehende Union nationale des combattants mit rund 860.000 Mitgliedern. Hinzu kamen weitere, etwa das faschistische Croix de feu (Feuerkreuz), nach eigenen Angaben mit rund 300.00 Mitgliedern. In einem stimmten diese Verbände überein: Ein Krieg wie der von 1914 bis 1918 sollte sich auf keinen Fall wiederholen. Der Europagedanke war insbesondere der Union fédérale nicht fremd: Sie war dem SPDnahen Reichsbund der Kriegsbeschädigten verbunden, doch als dieser sich 1933 auf Druck Hitlers der Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung eingliederte, brach der Kontakt ab. Aus Sicht der Nationalsozialisten waren sie das ideale Einfallstor, um in Frankreich die Mär vom deutschen Friedenswillen aufrechtzuerhalten. Bereits seit den frühen 1930er-Jahren umwarb der Kunstlehrer Otto Abetz, von August 1940 an deutscher Botschafter im besetzten Frankreich, die beiden großen Verbände.
So traf Anfang November 1934 eine Delegation ehemaliger Kämpfer in Berlin ein. Jean Goy, Vizevorsitzender der Union nationale, wurde noch am Tag der Anreise von Hitler empfangen. Er wünsche sich, erklärte er seinem Gast, ein dauerhaftes politisches Gleichgewicht zwischen den beiden Ländern.26 Wieder zurück in Frankreich, unterrichtete Goy die Öffentlichkeit von dem Treffen. Sein Bericht wurde unterschiedlich aufgenommen. Längst nicht alle Franzosen wollten Hitlers Worten Glauben schenken. Goys Kurswert aber stieg durch das Berliner Treffen: Bald rückte er von der Position des Vize- zu der des ersten Präsidenten seines Verbandes auf. Wenig später, im Frühjahr 1935, reiste Georges Scapini nach Berlin, der Vorsitzende der französischen Kriegsblinden. Auch ihm wurden warme Worte Hitlers zuteil. Er, Hitler, sei selbst eine Weile blind gewesen, erklärte dieser dem Besucher. Darum wisse er, welches Opfer Scarpini dem Vaterland gebracht habe. Anschließend unterbreitete er ihm den Vorschlag einer Waffenbegrenzung – kurz nachdem in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt worden war.
Auch Henri Pichot, der Vorsitzende der Union fédérale, wurde zu Gesprächen eingeladen. Im August 1934 traf er sich in Baden-Baden mit hochrangigen deutschen Veteranenvertretern. Er brachte durchaus gute Eindrücke von dem Treffen mit, doch nur wenige Wochen später, im Oktober, zog er nach einer Unterredung mit Vertretern des NS-Regimes in Paris ein anderes Fazit: »Ihre zentralen Sätze gleichen Stereotypen«, notierte er.27 Doch die Skepsis hielt nicht lange: Im Dezember traf Pichot im Beisein von Ribbentrop, Rudolf Heß, Hanns Oberlindober, dem Direktor der NS-Kriegsopferversorgung, und Abetz in der Reichskanzlei Adolf Hitler. Pichot, Volksschullehrer aus Orléans, genoss das Vertrauen nicht nur seiner Verbandsmitglieder, sondern sehr vieler Franzosen. Persönlich bescheiden und aufrichtig um Verständigung bemüht, sah er das Treffen als Versuch, zur deutsch-französischen Entspannung beizutragen. Und doch: Ein einfacher Mann des Volkes bei einem der in jener Zeit mächtigsten Männer Europas: Diese Konstellation mochte auch eine gewisse Eitelkeit wecken. »Vulkanismus«, »Orkan«, »Wetterleuchten« – das waren die Begriffe, mit denen er noch zehn Jahre später seine Eindrücke von Hitler beschrieb. Vor allem, berichtete er, sei ihm Hitlers Bekenntnis im Gedächtnis geblieben: »Ich will Frieden mit Frankreich.«28 Wie das Treffen Goys blieb auch das Pichots daheim nicht ohne Eindruck. »Auflockerung der französischen Öffentlichkeit zugunsten einer direkten Verständigung mit Deutschland«, berichtete der Korrespondent des Völkischen Beobachters. Allerdings fehlte es auch dieses Mal nicht an warnenden Stimmen. Scharfsichtig beschrieb der Journalist Pierre Bernus das grundsätzliche Dilemma, in dem die Gespräche stattfanden: auf der einen Seite die Franzosen, Direktoren zwar bedeutender, aber letztlich privater Verbände, die reden und argumentieren durften, wie es ihnen selbst angemessen schien – und auf der anderen Seite Repräsentanten eines straff geführten Regimes, die genaue Anweisungen erhielten, wie die Unterredungen zu verlaufen und welche Resultate sie zu erbringen hatten. Das Gespräch auf Augenhöhe, die durch keinerlei Zwänge und Repräsentationspflichten eingeschränkte Diskussion, gab Bernus zu verstehen, war eine Illusion.29 Bei diesen Gesprächen ging es nicht um Austausch, nicht darum, persönliche Beziehungen zu knüpfen und auf deren Grundlage zum Wohl beider Nationen beizutragen. Nein, diese Gespräche fanden zumindest auf deutscher Seite unter ganz anderen Voraussetzungen statt: Sie waren rein taktisch, dienten zu nichts anderem als der Manipulation und Steuerung des Gegenübers.
Bernus war nicht der Einzige, der sich über die deutsche Gesprächsbereitschaft keine Illusionen machte. Auch andere sahen den Dialog quer über den Rhein als Taktik. Hinter den so friedfertig wirkenden Gesprächen verberge sich ein Wille zur Aufrüstung, der sich durch nichts und niemanden aufhalten ließe, warnten sie. Überhaupt, warnte ebenfalls der Schriftsteller und Journalist Xavier de Hauteclocque, herrsche in Deutschland eine Atmosphäre, angesichts derer jeder Gedanke an Friedfertigkeit einer zu viel wäre. »Dieses Deutschland, aus dem das Dritte Reich den zivilisierten Staat per Exzellenz machen will, dieses ›Musterland‹ ist nichts als ein monströses, geöltes Geschoss, wie mit Wunderkraft hergestellt, wobei Millionen menschliche Wesen die Metallmoleküle ersetzen.« Und weiter: »Es ist ein Geschoss, das an diesem oder jenem Tag in der Geschichte unseres Planeten explodieren kann.«30
Ruhiger im Ton und präziser in der Sache umriss der an der Universität Straßburg lehrende Jurist René Capitant die massenpsychologischen Mechanismen, die er im Nachbarland am Werk sah. Präzise erfasste er die kunstvoll ausgelösten Erregungswellen, die die deutsche Gesellschaft durchliefen. Es liege auf der Hand, schrieb er 1935, dass sich das Regime von allen menschenrechtlichen Prinzipien verabschiedet habe. Diese definierten seit Immanuel Kant den Menschen nicht als Mittel, sondern als Ziel aller politischen Bemühungen. Seinem Wohlbefinden sei die Politik untergeordnet. »Der Nationalsozialismus vertritt die genau entgegengesetzte Position: Er entzieht dem Menschen seine Autonomie. Er löst ihn in der Gruppe auf. Er überlässt ihn dem Leviathan, dem kollektiven Wesen, dessen Mitglieder sein Fleisch bilden, dessen Geist und dessen Ziele ihm aber radikal fremd sind.«31 Sei der Mensch als Person einmal dem Kollektiv überantwortet, zähle er nicht mehr als Einzelner, sondern nur noch als Mitglied der Gruppe, warnte Capitant. Gebe er seine Rolle als Staatsbürger auf, um sich in einen Teil der Volksmasse zu verwandeln, sei es nicht nur um seine rechtliche Autonomie geschehen, sondern sehr schnell auch um seine intellektuelle und psychische. Der Bürger verabschiede sich aus seinem zivilen Status, er verzichte auf das Recht zum inneren Vorbehalt, lasse seine Distanz im Zweifel schmelzen, schließe sich der Weltsicht des Regimes an. Er müsse das nicht, aber es sei denkbar. Der Zweifel rette zwar seine Würde, strenge aber auch an und sei zudem gefährlich. Leichter sei es, den ideologischen Vorgaben des Regimes zu folgen. Identität gründe nicht mehr auf einem individuellen, sondern auf einem kollektiven Fundament. Damit, beobachtete Capitant zwei Jahre später, sei in Hitlers Staat der Weg für alles Weitere bereitet. »Der nationalsozialistische Staat wendet sich vom Individuum ab. Er stellt sich in den Dienst des Nationalismus – und kann sich nur in diesen stellen. Er erklärt – und kann nur erklären – das Primat der Außen- über die Innenpolitik. Er hat als Mission – und kann als Mission nur haben –, alle nationalen Kräfte zugunsten des Nationalismus zu stimulieren und zu bündeln.« Was daraus folge, so Capitant, liege auf der Hand: »Der nationalsozialistische Staat ist – und kann nur sein – die totale und andauernde Mobilisierung des deutschen Volks.«32
Doch was wäre eine angemessene Reaktion auf diese Mobilisierung? Der Diplomat und Schriftsteller Jean Mistler sah nach einer Deutschlandreise 1933 allen Anlass, auch über die französische Wehrhaftigkeit nachzudenken.
»Im Flugzeug zurück von Berlin nach Paris dachte ich über den tragischen Kontrast nach, der zwischen dem deutschen Fieber und der französischen Niedergeschlagenheit herrscht, zwischen der Erregung dieses Volkes, das schlecht isst, sich aber jung fühlt und stark sein will, und den Sorgen eines gut genährten Frankreichs, das aber nur an die Pensionsraten des letzten Krieges und den Pensionsausgleich denkt. Ich fragte mich, während wir gegen den Wind nur langsam vorankamen, aufgrund welcher Schicksalsfügung das französische Volk immer vergisst, dass es seine Gärten nicht nur pflegen, sondern auch verteidigen muss.«33
Es war die Naivität Pichots und Goys, solche Überlegungen nicht anstellen, ja nicht einmal zur Kenntnis nehmen zu wollen. Sie, die Männer guten Willens, verkannten, dass es bei ihren Gesprächspartnern – zumindest den entscheidenden – diesen guten Willen nicht gab. Für sie hatten die Gespräche von Anfang an rein taktischen Charakter, nicht der Verständigung dienlich, sondern der möglichst weitreichenden Einflussnahme auf die französische Meinungsbildung. Aus diesem Grund waren gerade die Vertreter der Vertriebenenverbände für die Nazis so begehrte Gesprächspartner: Sie verfügten mittels der zahllosen Ortsvereine, Zeitschriften und Vereinsblätter über weitreichende Kanäle. Zugleich galten sie ihren Landsleuten auch als unbestechliche, ausschließlich dem Wohl Frankreichs verpflichtete Patrioten. Solche waren sie in der Tat. Was die Franzosen unterschätzten, war die Naivität der Veteranen – oder umgekehrt, die zynische Gerissenheit von deren deutschen Gesprächspartnern. Die Veteranen, urteilte das Auswärtige Amt im Frühjahr 1935, besäßen »für uns und für Frankreich ein ganz anderes Gewicht, als das der sicherlich auch recht achtungswerten, aber einflusslosen Intellektuellen, die wir gelegentlich in Deutschland begrüßen durften.«34 Treffend sah es auch die nationalsozialistische Europäische Revue. Sie beschrieb die Veteranenverbände als »das riesenhafteste Interessensyndikat, … mit dem Parlament und Regierung in Frankreich zu tun haben; seine Wirkung ist umso gewaltiger, als es nationale Ideen wie Vaterlandsliebe, Heroismus usw. ins Treffen führt« – exakt jene Werte also, die sich seitens Hitlers Propagandisten trefflich ausbeuten ließen. Um die Botschaft eines angeblich friedliebenden Deutschlands noch breiter zu streuen, wurden von 1935 an Besuchsprogramme im ganz großen Stil organisiert. Tausende Veteranen – und nach ihnen auch jüngere Franzosen – reisten nach Deutschland, um sich, umhegt und in maximal angenehmer Atmosphäre von den guten Absichten ihrer Gastgeber zu überzeugen, genauer, überzeugen zu lassen. Der Wunsch nach guter Nachbarschaft war stark, und entsprechend massiv lenkte er die Wahrnehmung der Besucher. Besonders umschmeichelt wurden die führenden Vertreter der Verbände. Einmal mehr etwa Pichot, der im Frühjahr 1936 ein weiteres Mal von Hitler empfangen wurde – und wiederum die gewünschten Eindrücke verbreitete. »Der Kanzler hat nicht diese strenge und brutale Maske, unter der die Fotografen ihn darstellen«, unterrichtete er seine Landsleute. »Seine Augen sind gutmütig. Und um das zu sagen, was ich für die Wahrheit halte: Hitler macht mehr den Eindruck eines furchtsamen als eines gewalttätigen Menschen.«35 Von ihrem Vorsitzenden entsprechend geimpft, reisten im Juli 1936 tausende französischer Veteranen zu einer Gedenkfeier auf das Schlachtfeld von Verdun. Ansprachen, Aufmärsche, Kranzniederlegungen, verbunden mit tiefer und aufrichtig empfundener Trauer aufseiten der ehemaligen Kombattanten – eine große Geste der Verständigung, so schien es. »Niemals wird es eine edlere Geste auf erhabenerem Terrain gegeben haben«, urteilte Henri Pichot.36 Bald darauf, im August, sprach er im Berliner Olympiastadion vor über 100.000 deutschen Veteranen. Deren Anteilnahme war aufrichtig: Die Ehemaligen wussten, was Krieg bedeutet, und die meisten wollten, wie ihre ehemaligen Gegner auf der anderen Rheinseite, einen erneuten Waffengang vermeiden. Die Begegnungen und Programme blieben auch auf die akademische Welt nicht ohne Eindruck. Der Germanist Henri Lichtenberger, Professor an der Sorbonne, gab sich in seinem 1936 erschienenen Buch L’Allemagne nouvelle (»Das neue Deutschland«) überzeugt, dass von dem Nachbarland kein Krieg ausgehe.
»Hitlers Rassismus weist aus Prinzip jede Art von Eroberung und Annexion zurück, verweigert sich ausdrücklich jeder aggressiven Tendenz, erklärt in aller Deutlichkeit, dass ein Krieg, selbst wenn er siegreich wäre, den Ruin des Siegers ebenso wie den des Besiegten nach sich zöge. Insbesondere verweigert sich Hitlers Politik den cäsarenhaften Ambitionen, wie sie sich bei Spengler zeigen. Sie strebt nicht die Hegemonie über die Welt an, ist gleichgültig gegenüber der Mission des weißen Mannes oder der Vereinigung Europas. Was sie interessiert, ist das Schicksal ihrer Rasse.«37
Lange Zeit konnten sich solche Einschätzungen behaupten. Durch die Wirklichkeit widerlegen ließen sie sich nur ungern. Als Hitler im Frühjahr 1936 das Rheinland remilitarisierte, konnte die Redaktion des Canard enchaîné daran nichts Verwerfliches erkennen. »Die Deutschen kehren nach Deutschland zurück«, titelte die Zeitschrift lapidar.38 Und als Hitler zwei Jahre später Österreich in das Reich eingliederte, machte das Syndicat national des instituteurs, der Nationale Lehrerverband, dafür in Teilen auch die internationale Staatenwelt – insbesondere die demokratische – verantwortlich. »Hitler ist eine doppelte Strafe. In deutscher Hinsicht eine Strafe für die Demokraten und Sozialisten, die nicht in der Lage waren, eine sozialdemokratische Ordnung zu errichten. Und in internationaler Hinsicht eine Strafe für die Demokratien, die nicht in der Lage waren, den Frieden zu verwirklichen.«39 Die Illusionen hielten sich lange. Goy und Pichot wollten selbst im Münchener Abkommen vom September 1938 aufseiten Deutschlands noch ein aufrichtiges Bemühen um den Erhalt des Friedens erkennen. Hitler, glaubten sie, würde Richtung Westen nicht ausgreifen. Sie brauchten noch Monaten, um zu erkennen, dass es auf Hitlers Expansionskurs notfalls auch mit Gewalt zu antworten galt.