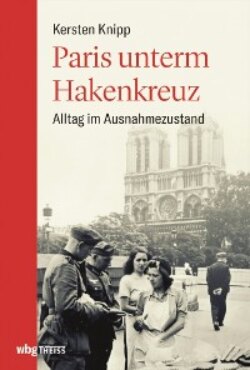Читать книгу Paris unterm Hakenkreuz - Kersten Knipp - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Evakuierung im Elsass
ОглавлениеDoch die Behörden sorgten sich nicht allein um die Kinder. Am Tag der allgemeinen Mobilmachung ordneten die Behörden die obligatorische Evakuierung von Teilen des Elsass und des Gebiets an der Mosel an. Betroffen waren alle Bewohner der sogenannten »Zone 1« – sie umfasste alle jene Orte, die näher als 15 Kilometer an der deutschen Grenze lagen. Deren Bewohner waren verpflichtet, sich in andere Landesteile zu begeben. Mitnehmen konnten sie nur das Allerwichtigste: warme Kleidung, eine Decke, Lebensmittel für drei Tage – das war es. Insgesamt durfte das Gewicht der mitgeführten Habseligkeiten 30 Kilo nicht überschreiten. Die Order betraf über eine halbe Million Menschen. Binnen weniger Tage verwandelten sich zahlreiche Orte in Geisterstädte. Straßburg, damals die Heimat von rund 190.000 Menschen, war binnen kürzester Zeit nahezu vollständig entvölkert. Eine gespenstische Stille herrschte in der vor Kurzem noch so belebten Stadt. Am 8. September hielten sich noch knapp 1000 Personen in der Stadt auf – einschließlich des Bürgermeisters und knapp 400 dort weiterhin arbeitender Beamter. Die Stadt selbst wurde unter Militärverwaltung gestellt. »Ein seltsamer, fast schockartiger Eindruck von Stille schlägt Ihnen in dieser großen, einst so belebten und nun leeren Stadt mit ihren verschlossenen Häusern entgegen«, erinnerte sich Georges R. Clément, ehemaliger Leiter der Straßburger Filiale der Banque de France. »Die Straßen sind leer, nur einige Polizisten und Beamte des Wachdienstes durchliefen sie, ebenso auch Rudel unruhig streunender Hunde, dazu traurig wirkende, hungrige Katzen und einige Hühnerscharen – eine Art Strandgut, dem der Auszug ihrer Herren die Freiheit zurückgegeben hat, mit der sie nichts anfangen können.«23 Noch deprimierender war die Situation auf dem Land: Die anstehende Ernte wurde nicht eingefahren, die Tiere wurden nicht versorgt. Mit breiten Beinen standen die Kühe auf der Wiese, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr gemolken wurden. Zwar wurde vorab auch die Einrichtung eines landwirtschaftlichen Notdienstes geplant. Der aber kam mit der Arbeit kaum nach. All dies ahnten die zu Evakuierenden, die sich mit der Abreise entsprechend schwer taten. »Man packt die 30 Kilo zusammen, dann die Matratzen und etwas Proviant (Schokolade, Biskuit, Konserven)«, berichtete Fernand Klethi, Jahrgang 1928. »Am späten Nachmittag binden die Bauern die Pferde vor die Karren. Alle treffen sich auf dem Dorfplatz. Das Herz drückt bei dem Gedanken, das Vieh, die Hunde und Katzen zurückzulassen, das gesamte Zuhause. Dann ertönt schon das Signal zum Aufbruch.«24
Trotz der großen Zahl der zu evakuierenden Menschen verlief die von langer Hand vorbereitete Aktion insgesamt reibungslos – wenn für die Betroffenen oft auch alles andere als angenehm. 500 Züge standen bereit, die Menschen in sichere Orte zu bringen. Allerdings hatten sie nicht nur Personen-, sondern auch Güter- und Viehwagen im Schlepp. Die Menschen ließen sich auf dem notdürftig mit etwas Stroh oder Decken gepolsterten Metallboden nieder. Da viele Wagen keine Fenster hatten, verbrachten sie die Reise ohne natürliches Licht.
Auch Fernand Klethi hatte nach einer achttägigen Reise auf dem Gespann einen Bahnhof in der Region Val-de-Villée erreicht, von wo aus es weiter in Richtung Süden ging.
»Ich werde niemals die Aufschrift auf den Wagons vergessen, die wir nehmen mussten: ›40 Personen, 8 Pferde‹. Die Reise dauert drei Tage und drei Nächte, unterbrochen von zahlreichen Stopps in Bahnhöfen oder der freien Natur. Während dieser Unterbrechungen kümmern sich verschiedene Organisationen um uns, etwa das Rote Kreuz, die Pfadfinder, der Ökumenische Dienst zur Unterstützung der Flüchtlinge. Diese Leute helfen uns mit Nahrungsmitteln und Hygiene. Was für eine physische, aber auch moralische Unterstützung! Als der Krieg ausbricht, sind wir weit weg von zu Hause. Dank der Helfer haben wir alles, was wir brauchen.«25
Drei Tage später kam Fernand Klethi mit seiner Gruppe in dem Örtchen Eymet im Département Dordogne an. Für das gesamte betroffene Gebiet hatten die Behörden eine Quote erlassen, die die Verträglichkeit der Aufnahme garantieren sollte: Die Flüchtlinge aus dem Elsass und von der Mosel sollten nicht mehr als 35 Prozent der einheimischen Bevölkerung betragen – eine Quote, die im Mai 1940, als nach dem deutschen Angriff weitere Flüchtlinge aus dem Nordosten eintreffen, kaum mehr zu halten war. Der junge Fernand Klethi fühlte sich insgesamt wohl in der neuen Umgebung.
»Aber es gibt auch Momente von Traurigkeit oder Unruhe. Dieses Jahr haben wir Weihnachten zwar in der Kirche von Eymet gefeiert, auch habe ich ein kleines Modellflugzeug geschenkt bekommen. Trotzdem ist es kein Tag der Freude. Eine positive Erinnerung aber bleibt mir: Der Pfarrer erzählt uns die Legende vom Weihnachtsbaum, die ihren Ursprung im Elsass hat.«
Die Flüchtlinge trugen das Elsass im Herzen – eben das machte sie in den Augen derer, die sie aufnehmen, verdächtig. Denn viele der Neuankömmlinge beherrschten das Französische nur bruchstückhaft. Stattdessen pflegten sie ihren merkwürdigen, ans Deutsche angelehnten, für Außenstehende komplett unverständlichen Dialekt. »Ya-ya« nannten die Südfranzosen die Elsässer, ihren seltsamen Brauch aufgreifend, statt des üblichen »oui« das deutsche »ja« zu gebrauchen. »D’Heim éch d’Heim« – »zu Hause ist zu Hause«, pflegten die Neuankömmlinge zu sagen und schufen damit ganz nebenbei und ohne es zu wollen eine psychologische und sprachliche Distanz. Auch war den Einheimischen, seit Langem dem republikanischen Laizismus verpflichtet, die Glaubensinbrunst ihrer Gäste nicht ganz geheuer. »Der Umstand, dass nun ein Religionslehrer eine Stunde des regulären Unterrichts übernimmt, stellt einen schweren Eingriff in den laizistischen Charakter des Schulwesens im Périgord dar«, erklärte im Januar 1940 der nationale Lehrerverband.26
Alles in allem waren da merkwürdige Landsleute zu ihnen gekommen, fanden die Südfranzosen. Schon die enorme Menge derer, die sich nun bei ihnen niederließ, bereitete ihnen Unbehagen. Verstärkt wurde es durch politische Vorbehalte. Die Elsässer, erinnerte man sich, waren schließlich noch gar nicht lange Franzosen – gerade etwas mehr als 20 Jahre. Davor, von 1871 bis 1918, gehörten sie zu Deutschland. Konnte man ihnen wirklich vertrauen? Waren sie wirklich überzeugte Franzosen? Oder nur, weil die Alliierten sie auf der Pariser Friedenskonferenz Frankreich zugeschlagen hatten? Bange Fragen, die noch durch die unterschiedlichen Gewohnheiten, etwa in der Landwirtschaft oder auch der Ernährung, verstärkt wurden. Eine mindestens reservierte, bisweilen sogar offen feindselige Haltung schlug den Flüchtlingen darum entgegen. Schon die Flucht selbst sei für viele Menschen eine traumatische Erfahrung gewesen, erinnerte sich Jeannine H., Jahrgang 1933. »Dies umso mehr, als einige Personen schlecht aufgenommen wurden, da die Einwohner die Elsässer nicht kannten. Sie hielten uns für Deutsche. In der Schule bezeichneten uns die Kinder als ›les boches‹ (diffamierende Bezeichnung für Deutsche, Anm. d. Aut.). Sie benutzten den Begriff, weil sie ihn zu Hause hörten. Es war nicht ihr Fehler.«27 Und doch: Die Menschen gewöhnten sich aneinander. Langsam zwar, aber unausweichlich. Und irgendwann hatten sie sich nicht nur aneinander gewöhnt – sie mochten sich sogar. »Wir haben dort fast besser gelebt als zur Zeit, als wir zurück nach Hause kehrten«, erinnerte sich Jeannine H. »Innerhalb eines Jahres ist das Département Dordogne zu meiner Heimat geworden, und zwar so sehr, dass ich nicht mehr zurück ins Elsass wollte. Ich hatte dort Freunde gefunden. Über mehrere Jahre hatten wir per Brief noch Kontakt mit den Leuten, die uns aufgenommen hatten.«