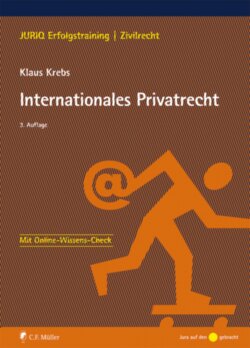Читать книгу Internationales Privatrecht - Klaus Krebs - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Rechtsfolge
Оглавление32
In der Rechtsfolge verweisen die meisten IPR-Normen auf die anzuwendende Rechtsordnung unter Verwendung sog. Anknüpfungsmomente (gleichbedeutend: Anknüpfungspunkte[7]),[8] wie die Staatsangehörigkeit, der Wohnsitz, der Handlungsort, der Belegenheitsort oder der gewöhnliche Aufenthalt. Wie diese Anknüpfungsmomente zu verstehen sind, ist nicht immer offensichtlich und bedarf daher der Erläuterung. Das zeigt folgendes
Beispiel
Der tschechische Lebensmittelhändler L beauftragt den belgischen Handwerker H mit der Dachsanierung seines im deutschen Breisach gelegenen Einkaufsmarktes. Bevor der H vor vier Wochen vorübergehend ins französische Mulhouse zog, hatte er jahrelang in Salzburg gelebt und gearbeitet. Zwei Monate nach Abschluss der Arbeiten tropft es im Einkaufsmarkt von der Decke. Daraufhin verklagt L den H auf Nachbesserung. Nach welchem Sachrecht würden deutsche bzw. französische Gerichte das Bestehen eines solchen Anspruchs beurteilen?
Der Fall spielt im Internationalen Vertragsrecht. Das Kollisionsrecht dafür ist europäisch einheitlich durch die Rom I-VO geregelt, die dem nationalen IPR Frankreichs und Deutschlands vorgeht. Sowohl deutsche wie auch französische Gerichte würden daher Art. 4 Abs. 1 lit. b Rom I-VO heranziehen. Danach unterliegen Dienstleistungsverträge (= Anknüpfungsgegenstand) dem Recht des Staates, in dem der Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt (= Anknüpfungsmoment) hat. Der Vertrag über die Dachsanierung ist zwar nach deutschem Recht ein Werk- und kein Dienstvertrag, doch ist der Begriff des Dienstleistungsvertrages wegen seines europarechtlichen Ursprungs europäisch autonom und in diesem Sinne – Art. 57 AEUV entsprechend – weit auszulegen. Auch die Erbringung von Werkleistungen wird davon erfasst.[9]
Auf Rechtsfolgenseite kommt es bei Art. 4 Abs. 1 lit. b Rom I-VO weder auf die tschechische Staatsangehörigkeit des L noch auf die belgische des H an (lassen Sie sich in der Klausur von solchen Angaben nicht verwirren). Allein der gewöhnliche Aufenthalt des H entscheidet über das anwendbare Recht. Als gewöhnlicher Aufenthalt des H kommt hier entweder das österreichische Salzburg oder das französische Mulhouse, wo der H seit vier Wochen lebt, in Frage. Doch wann kann von einem gewöhnlichen Aufenthalt gesprochen werden? Nach zwei Tagen? Nach zwei Jahren? Für Fragen dieser Art ist Wissen um die Auslegung der Anknüpfungsmomente erforderlich.