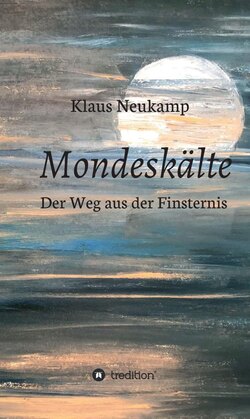Читать книгу Mondeskälte - Klaus Neukamp - Страница 14
Оглавление10. Der Flow
Als Peter die Station erreicht, erwarten ihn neben der Stationsschwester fünf der zehn Patienten, die er am Montag operiert hat.
Sie sind noch in seiner stationären belegärztlichen Behandlung. Nach den Untersuchungen und entsprechenden Hinweisen für den weiteren Heilungsverlauf, entlässt er sie heute und wird sie morgen in seiner Praxis wiedersehen.
Die Patienten schätzen die Belegarztbehandlung sehr, da sie ambulant wie stationär vom gleichen Arzt behandelt werden.
Peter bedauert, dass diese Form der optimalen Verflechtung von ambulanter und stationärer Behandlung in Deutschland zunehmend gefährdet ist, da es unter den jungen Ärzten nur noch wenige gibt, die die enormen Arbeitsbelastungen auf sich nehmen wollen. Er würde es auch sehr begrüßen, wenn sich die drei Fachkollegen der Stadt an der stationären Behandlung beteiligen würden. Leider besteht bei diesen kein Interesse.
Peter liebt gerade den klinisch-chirurgischen Teil seiner ärztlichen Tätigkeit sehr. Im Gegensatz zur ambulanten Arbeit in der Praxis erlebt er die Beschäftigung im Krankenhaus als weniger anstrengend, insbesondere den Operationstag am Montag genießt er buchstäblich.
Im geräuscharmen Operationssaal, wenn er durchs OP-Mikroskop nur noch die anatomischen Strukturen des Patienten sieht, fühlt er sich völlig entspannt. Diese Ruhe und der fehlende Druck, schnell arbeiten zu müssen, sind für Peter ein erholsamer Kontrast zum hektischen Praxisalltag.
Auch die Atmosphäre auf der Belegarztstation ist für ihn deutlich entspannter als in der Praxis. Während er dort oft drei Probleme auf einmal lösen muss, hat er wirklich hektische Situationen hier selten erlebt.
Nach der Visite, die Schwester hat sich schon verabschiedet, vervollständigt Peter zügig die Patientenakten, geht dann zum Auto und fährt zur Praxis. Als er den überfüllten Flur erreicht, kann er nur mit Mühe zur Eingangstür gelangen. Erst als ihn einige Patienten erkennen, wird ihm der Weg freigemacht.
Peter wünscht allen einen guten Morgen und schließt nach dem Eintreten sofort wieder die Tür ab. Am liebsten wären ihm die Patienten gleich gefolgt, aber dann ist es mit der Ruhe, die seine Mitarbeiter für die Vorbereitung der Sprechstunde benötigen, schlagartig vorbei.
Peter begrüßt seine Angestellten, die ihn freundlich anlächeln und den Gruß erwidern, verschwindet im Büro, kleidet sich um und überfliegt den Poststapel. Werbung wandert sofort in den Papierkorb, die restlichen fünf Briefe öffnet er, überfliegt sie und legt sie in die entsprechende Ablage.
Keine Hiobsbotschaften, erleichtert lehnt er sich im Schreibtischsessel zurück. Die Uhr zeigt an, dass er noch zehn Minuten Zeit hat.
Er durchblättert schnell und konzentriert das aktuelle Ärzteblatt. Erfahrungsgemäß enthalten die Fachzeitschriften nur wenige neue Erkenntnisse oder lesenswerte Artikel. Notwendig ist nur, wirklich wichtige Beiträge nicht zu übersehen. Er reißt einige interessante Seiten aus dem Ärzteblatt und legt sie in die Weiterbildungsablage, er wird sie später lesen. Der Rest der Zeitung verschwindet im Papierkorb.
Da er immer noch etwas Zeit hat, nimmt er sich eines der Schreiben, die er in eine besondere Ablage geschoben hat, eine Routineanfrage des Versorgungsamtes, heraus, füllt sie aus, unterschreibt, drückt seinen Stempel drauf und legt sie in die Postablage für seine Mitarbeiter.
Peter schafft es immer, den Poststapel möglichst klein zu halten. Bei einem seiner Studienfreunde, den er vor seiner Niederlassung besuchte, hat er einen riesigen Berg mit unbeantworteten Versorgungsamtsanfragen gesehen. Peter will so etwas bei sich nicht zulassen.
Plötzlich dringt lautes Stimmengewirr durch seine Bürotür, der Sturm beginnt. Peter geht sofort in das benachbarte Sprechzimmer, setzt sich auf den Rollhocker und öffnet die PC-Warteliste.
Diese Liste haben seine Mitarbeiter am Tresen mit den ersten Patienten gefüllt. Es kann losgehen. Er springt auf, öffnet die Sprechzimmertür und ruft mit kräftiger Stimme den ersten Patienten auf.
Es ist ein fünfundsiebzigjähriger Mann, den er vor Jahren wegen eines bösartigen Tumors operiert hat, Peter kontrolliert den Befund halbjährlich, Routine.
Er begrüßt ihn kurz und zieht ihn sanft auf den Patientenstuhl. Nach der einleitenden Befragung endoskopiert er die Nasenhöhlen und informiert den Patienten, dass es keinen Anhalt für einen neuen Tumor gibt. Abschließend ergreift er mit leichtem Druck die Hand des Patienten, verabschiedet sich und geleitet ihn zur Ausgangstür, immer freundlich lächelnd.
Diese Behandlung hat nur wenige Minuten gedauert. Die meisten Patienten schätzen es, dass sie in Peters Praxis nicht lange warten müssen. Es gibt natürlich auch Patienten, die die Dauer der Konsultation selbst bestimmen wollen. Wenn Peter die Zeit dazu hat, tut er ihnen den Gefallen. Oftmals muss er aber im Interesse der anderen Patienten diesen Drang eingrenzen, was nicht immer gut angenommen wird.
Es hat einige Jahre gedauert, bis er die Balance gefunden hat. In den ersten Jahren gab es ab und an Beschwerden von frustrierten Patienten bei der Ärztekammer, die Peter dann beantworten musste, eine lästige Pflicht.
Heute hat er gelernt, dass man es nicht allen recht machen kann und beendet mit freundlichen Worten sich abzeichnende Kontroversen. Schließlich ist er nicht der liebe Gott, kann nicht alle Wünsche erfüllen und jeder Patient hat ja die Möglichkeit, sich einen anderen Arzt zu suchen.
Die heutige Sprechstunde verläuft ohne Zwischenfälle und der letzte Patient verlässt zum Ende der Vormittagssprechstunde das Sprechzimmer. Diana ist eine super Kraft. Sie organisiert den Praxisablauf immer optimal und Peter dankt es ihr, in dem er schnell und effektiv arbeitet.
Auch die nächsten Tage vergehen ohne Besonderheiten, Peters Stimmung hat sich wieder stabilisiert, die Macht der Gewohnheit hat seine Dämonen verjagt.
Am kommenden, verlängerten Wochenende, Montag ist Feiertag, will Peter seinen Vater nebst Ehefrau in Dresden besuchen und sie über seine veränderte Situation informieren.