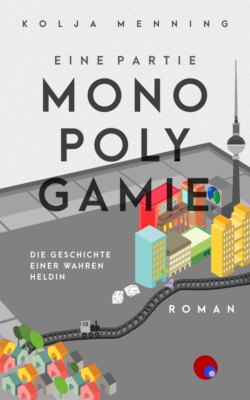Читать книгу Eine Partie Monopolygamie - Kolja Menning - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 10
Obwohl alle sehr nett sind, wird mir schon sehr bald klar, dass nicht nur zwischen der Welt von Fair^Made und meiner Welt Klassenunterschiede herrschen. Auch innerhalb von Fair^Made existieren sie. Das zeigt sich zum Beispiel beim Mittagessen. Die Leute auf den hohen Managementebenen gehen fast ausschließlich untereinander essen – wenn sie denn essen. Lena Persson scheint das selten zu tun. »Weil sie auf ihre Figur achtet«, erklärt mir Anna, Patrick Landsbergers Assistentin.
Unterhalb des Topmanagements identifiziere ich noch zwei weitere Klassen. Einerseits die breite Masse der Mitarbeiter in den Marketing-, Finance- oder Category Management-Teams und andererseits jene, die in unterstützenden Funktionen tätig sind: Leute wie Oli aus dem IT Support, Franzi und Pierre, das deutsch-französische Duo vom Empfang – und uns Assistenten. Selbstverständlich benimmt sich jeder uns gegenüber ausgesprochen höflich. Doch die Mittagszeit zeigt, dass es eine unsichtbare Linie gibt. Viktorias Rat, Fair^Made-intern zu netzwerken, stellt sich als schwieriger heraus, als ich im ersten Moment angenommen habe. Es gibt nicht viele, die mit uns zu Mittag essen wollen. Natürlich wird das so direkt nicht gesagt. Wenn man zum Beispiel eine Gruppe junger Marketingkollegen fragt, ob man sich ihnen anschließen könnte, wird die Antwort immer sein: »Selbstverständlich! Gern!« Doch wirklich gelebt wird das nicht. Als Assistentin muss man sich aufdrängen. Gefragt wird man eigentlich nie. Zweimal wage ich es in meiner ersten Woche, mich so einer Gruppe junger Kollegen aufzudrängen – und habe nicht das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Am Anfang stellt mir jemand eine Frage. »Und woher kommst du?« Aber schon meine Antwort langweilt. Vielleicht will dann noch jemand wissen, in welchem Stadtteil von Berlin ich wohne. Genauso wie jedoch Brandenburg nicht Portugal, Pakistan oder Panama ist, ist Moabit weder Prenzlauer Berg noch Friedrichshain noch Kreuzberg. Entsprechend macht auch meine zweite Antwort mich nicht interessanter. Spätestens da bekomme ich als Antwort ein oberflächliches »Oh, ich mag Moabit. Ich war mal da und hab’ in einem türkischen Supermarkt eingekauft. Das Gemüse da war echt billig.« Und dann sagt jemand anderes: »Aber ich bin nicht sicher, dass das da alles Bio ist.« Und dann kehren sie zu ihnen vertrauten Themen zurück. Fröhlich und unbeschwert wird im Marketing-Team über Klimawandel oder Nachhaltigkeit diskutiert. Oder Mode. Oder Werbekampagnen, die diese Themen raffiniert im Namen Fair^Mades verbinden. Oder das neue iPhone.
Im Finance-Team redet man auch über das iPhone, jedoch weniger über Mode und stattdessen mehr über Aktien. Amazon und Apple werden gern genannt. Wenn man sich von denen vor ein paar Jahren nur tausend oder so zugelegt hätte, dann könnte man jetzt sein Geld fast nicht mehr zählen. Zumindest nicht ohne Microsoft Excel.
Gern wird auch von einer coolen Urlaubsreise berichtet. Nepal oder Neuseeland oder so. Wie das zu Nachhaltigkeit passt, erschließt sich mir nicht. Da bin ich wahrscheinlich vorbildlicher, wenn ich am kommenden Wochenende mit dem Zug nach Nordbrandenburg fahre, um dort die Kinder bei meiner Mutter abzuliefern. Doch ich schweige. Und je länger ich schweige, desto weniger scheine ich für mein Umfeld zu existieren. Eigentlich ist es mir ganz recht. Wovon soll ich auch berichten? Von der Angst, krank zu werden und so nicht putzen zu können, obwohl man doch das Geld dringend braucht? Oder schlimmer noch: Wenn eines der Kinder krank ist, zu Hause bleiben muss, was es erst recht unmöglich macht, putzen zu gehen? Denn wenn man selbst krank ist, dann putzt man eben mit Fieber. Aber einen Fünfjährigen mit Fieber lässt keine halbwegs vernünftige Mutter mehr als vier Stunden am Stück allein zu Hause. Und zu den Eichners, den Bauers, den Kramers und so weiter schleppt man den auch nicht mit.
Trotz der allgemeinen Nettigkeit fast aller, weiß ich also schon nach der ersten Woche, dass es mir schwerfallen wird, bei Fair^Made soziale Kontakte zu knüpfen. Zum Glück gibt es zwei Ausnahmen: Oli, den echten Berliner IT-Kollegen, – und Anna. Anna scheint sehr froh, mich an Bord zu haben. Wir essen zusammen, sie erklärt mir ein paar Besonderheiten des Unternehmens. Vor allem arbeitet sie mich in alle möglichen Tools ein, die die Arbeit einer ExAs, wie sie uns hier nennen, enorm erleichtern. Anna beweist viel Geduld mit mir und fragt immer wieder, wie ich mich fühle, wie sie mir helfen kann und wie’s mit Viktoria läuft.
Mit Viktoria läuft es ausgezeichnet. Am Mittwochmorgen im Marketing-Team-Meeting bemerke ich, dass niemand sich Notizen macht. Unbeachtet von allen öffne ich meinen Computer und schreibe das, was mir am wichtigsten zu sein scheint, mit. Nach dem Meeting verarbeite ich das Ganze zu einem kurzen Protokoll, wobei ich der recht simplen Struktur des Meetings folge: Highlights of the week, lowlights of the week, open questions, next steps. Dann schicke ich es Viktoria mit der Bitte um Verbesserungsvorschläge. Durchaus möglich, dass ich einiges nicht richtig verstanden habe.
»Wow, Clara!«, ruft sie plötzlich aus und dreht sich mir zu. »Das sind die besten Meeting Minutes, die ich je gelesen habe! Kurz, knackig und klar. Bravo!«
»Danke«, erwidere ich geschmeichelt.
»Ich hab’ fast Lust, Peter mal zu fragen, ob du nächste Woche mit ins ELM kommen kannst. Solche Zusammenfassungen würden uns da echt weiterhelfen«, sagt Viktoria. »Ich sag’ dir Bescheid.«
Wow!, denke ich. Das ELM? Das Executive Leadership Meeting? Und allein bei dem Gedanken, beginne ich vor Nervosität zu schwitzen. Dennoch – eindeutig mein Highlight der Woche.
Weniger begeistert bin ich, als ich am Abend nach Hause komme.
»Was ist denn mit dir passiert?«, frage ich Gwenael, nachdem Melanie sich verabschiedet hat.
»Wir haben nach der Schule noch Fußball gespielt, und ich habe den Ball ins Gesicht bekommen«, antwortet er.
Seine Nase weist noch die Spuren von Blut auf und er hat Kratzer im Gesicht.
»Die Kratzer sind von einem Fußball?«
»Nein, von meiner Brille«, entgegnet er.
»Wo ist sie denn?« Mir fällt erst jetzt auf, dass er sie nicht trägt.
»Die ist dabei kaputtgegangen. Sie liegt in unserem Zimmer«, sagt er so gelassen, dass es mich trotz meiner vor ein paar Minuten noch ausgezeichneten Stimmung fast wütend macht.
»Gwenael, wann wirst du endlich lernen, deine Brille beim Fußball abzusetzen? So schlecht sind deine Augen nicht! Der Arzt hat klar und deutlich gesagt, dass du problemlos ohne Brille Sport machen kannst.«
»Ich hab’ sie schon wieder geklebt«, entgegnet Gwenael, als wenn das Thema damit vom Tisch wäre.
Ich atme tief durch und entscheide, es dabei zu belassen.
»Wieso hast du überhaupt Fußball gespielt? Ihr solltet doch sofort nach der Schule nach Hause kommen, damit Emil nicht allein mit Melanie ist.«
»Wir hatten doch heute nur ein paar Stunden«, entgegnet Gwenael. »Wir wären viel zu früh da gewesen.«
»Wieso?«, frage ich.
»Weil heut’ der letzte Schultag war«, kommt Désirée ihrem Bruder zu Hilfe und rollt mit den Augen, als wäre ich dämlich.
»Ach, das hatte ich ganz vergessen.« Hatte ich wirklich. Sofort habe ich ein schlechtes Gewissen.
Dann fällt mir etwas ein.
»Dann habt ihr ja auch eure Zeugnisse bekommen!«
»Nur Gwen«, widerspricht Désirée. »Ich hab’ nur so Kuchen.«
Das stimmt. Ich war zwar nicht auf dem Elternabend am Anfang des Schuljahres, doch ich habe im Protokoll des Elternabends gelesen, dass die Eltern wählen durften, ob es richtige Schulnoten geben sollte oder nicht. Diese Wahl fiel zuungunsten von Noten aus. Daher bekommt Désirée statt Noten Kreise, die entweder gar nicht, zu einem Viertel, zur Hälfte, zu drei Vierteln oder ganz ausgemalt sind. In ihrem Sprachgebrauch Kuchen.
»Und?«
»Ich hoffe, du hast Hunger«, sagt Désirée fröhlich.
»Wieso?«
»Du verstehst ja heute gar nichts«, meint Gwenael. »Sie hat viele ganze Kuchen.«
»Fünf«, präzisiert Désirée. »Und zwei halbe. Bei den anderen fehlt ein Stück.«
Drei Viertel also, denke ich. »Und wie viele sind das?«
»Oh, viele. So zwanzig oder dreißig.«
Das sind erfreuliche Nachrichten. Ich wende mich an Gwenael. »Und bei dir?«
»Keine Kuchen«, entgegnet er.
Ich verdrehe meinerseits die Augen, muss aber nichts sagen.
»Hier«, sagt er und reicht mir ein Blatt in einer Klarsichthülle.
Ich nehme es und starre auf das Zeugnis. Zweien in Sachunterricht, Ethik und Sport. Eine Drei in Mathe. Tja, das war wohl nach der letzten Klassenarbeit nicht anders zu erwarten gewesen. In Deutsch, Englisch, Musik und Kunst Einsen.
»Das ... ist ziemlich gut, oder?«, frage ich.
Er zuckt mit den Schultern, doch ich sehe ihm an, dass er stolz ist.
»Bravo, ihr zwei«, sage ich und lächele. »Und du, Emil? Wo ist dein Zeugnis?«
Er zieht die Nase kraus. »In der Kita gibt’s kein Zeugnis.«
Das weiß ich natürlich.
Leider gibt es nicht nur gute Neuigkeiten. Wenig später erlebe ich das Lowlight meiner Woche, als wir ein letztes Mal vor dem Urlaub der Kinder gemeinsam auf den Matratzen im Kinderzimmer liegen und auf dem tollen Bildschirm meines neuen MacBooks ein Video auf YouTube ansehen.
»Der Computer ist wirklich cool«, meint Emil plötzlich. »Aber deine neue Arbeit mag ich nich’. Kannst du nich’ den Computer ohne die Arbeit haben?«
»Wieso magst du meine Arbeit nicht?«, frage ich überrascht.
»Weil du jetzt immer erst viel später nach Hause kommst und immer nur die blöde Melanie da ist«, entgegnet Emil, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen. Ein schneller Blick auf Gwenael und Désirée sagt mir, dass sie das so zwar niemals gesagt hätten, aber genauso empfinden wie Emil. Und mein Herz wird schwer.