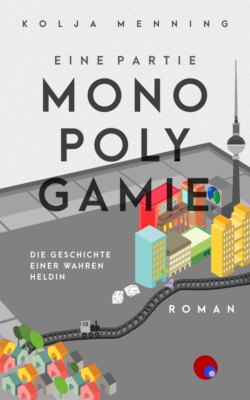Читать книгу Eine Partie Monopolygamie - Kolja Menning - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 11
Als wir Samstagmittag bei meiner Mutter ankommen, fällt mir auf, wie alt sie geworden ist. Die Kinder scheint das nicht zu stören, sie begrüßen ihre Großmutter überschwänglich und sind bald darauf verschwunden, um in einem nahen Bach einen Staudamm zu bauen. Die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter ist schon seit Jahren nicht mehr die beste. Spätestens seit Guillaume. Sie mochte nichts an ihm. Dass er so gut wie kein Deutsch sprach, sich auch nicht bemühte, dass er nicht Deutscher war, wie er sich mir gegenüber benahm. Im Nachhinein hatte sie in dem letzten Punkt wahrscheinlich recht – nur war ich zu verliebt, um es zu sehen. Dass ich dann auch noch mit einem ausländischen Taugenichts eine Familie gründete, trieb sie zur Weißglut, und sie ließ uns darüber auch nicht im Unklaren. Immerhin hat sie ihren Ärger über mich und Guillaume nie an den Kindern ausgelassen, im Gegenteil.
»Das Essen ist in einer halben Stunde fertig«, kündigt meine Mutter an, nachdem auch wir uns begrüßt haben. Mit diesen Worten verschwindet sie in die alte Küche. Ich seufze, obwohl ich es nicht anders gewohnt bin. Dann bringe ich das Gepäck der Kinder in den ersten Stock. Der Zustand des Hauses verschlechtert sich kontinuierlich. Seit mein Vater vor knapp zwanzig Jahren gestorben ist, lebt meine Mutter allein hier und in den letzten Jahren hat sie sich immer weniger um Sauberkeit bemüht. Es steht im krassen Gegensatz zu der Wohnung des Grafen und der Gräfin oder der der Kramers. Hier bei meiner Mutter würde es mich nicht vier Stunden, sondern wahrscheinlich weit mehr als vier Tage kosten, wenn ich alles mal wieder auf Vordermann bringen wollte. Doch das würde meine Mutter nie wollen. Sie will auf keinen Fall, dass ihr Haus aussieht wie die Wohnungen »dieser hochnäsigen neureichen Berliner«, die sie mit einer fast noch größeren Leidenschaft verabscheut als Ausländer.
Während des Mittagessens herrscht dank der Kinder eine ausgelassene Stimmung. Sie diskutieren lebhaft ihren Staudamm und haben sogar schon einen Frosch gefangen, ihn aber dann wieder freigelassen. Am Nachmittag wollen sie gucken, ob Doreen und Ronny, zwei Kinder in Gwenaels und Désirées Alter, zu Hause sind.
»Nele, hast du auch einen Nachtisch gemacht?«, fragt Emil, nachdem er seinen Teller zweimal geleert hat.
»Natürlich, mein Süßer«, erwidert meine Mutter. Emil ist ihr Liebling. »Ich habe für dich und deine Geschwister einen großen Schokopudding gemacht. Magst du so was?«
Ich verdrehe die Augen, was jedoch niemandem auffällt. Meine Mutter weiß ganz genau, dass die Kinder ihren Schokoladenpudding lieben. Ich auch – aber für mich scheint der nicht zu sein.
Nach dem Essen verschwinden die Kinder wieder nach draußen und ich helfe meiner Mutter beim Abwasch. Schweigend teilen wir uns die Arbeit, wie wir es schon seit dreißig Jahren tun. Anschließend setzt sie sich neben die Heizung und zündet sich eine Zigarette an. Ich öffne schnell das Küchenfenster und setze mich auf die andere Seite des Tisches.
»Es wäre nett, wenn du vielleicht nicht rauchen könntest, wenn die Kinder im Raum sind«, sage ich.
»Ach, was. Bisschen Rauch hat noch niemandem geschadet«, tut sie meine Bitte ab.
»Außer Vater«, kann ich mir nicht verkneifen.
»Dein Vater war ein vorbildlicher Mann«, sagt meine Mutter, als wenn das etwas damit zu tun hätte, »ganz im Gegenteil zu diesem nichtsnutzigen Franzosen, den du hattest. Und wenn er nicht von so einem Wessi-Pfuscher operiert worden wäre, wäre er jetzt noch da.«
Womit sie natürlich meinen Vater meint. Wie konnte ich so töricht sein, mit diesem Thema anzufangen? Es ist immer das Gleiche. Und ein hoffnungsloser Fall. Ich muss an Lena Perssons Vortrag vor ein paar Tagen denken. Wie war das? Fehler werden verziehen? Meine Mutter wird mir Guillaume nie verzeihen. Die Geschichte mit meinem Vater zeigt aber auch, dass die Fair^Made-Gründerin nicht in allen Fällen recht hat. Der »Wessi-Pfuscher«, wie meine Mutter den Arzt nennt, der meinen Vater operiert hat, hat bei der OP etwas Neues probiert. Dummerweise hat das nicht so gut geklappt. Zwei Wochen später ist mein Vater auf der Intensivstation gestorben. Was Lena Persson wohl zu dieser Form des Risk Takings sagen würde?
»Ich habe eine neue Arbeit«, wechsle ich das Thema.
»So?«, fragt meine Mutter zwischen zwei Zügen.
»Ich arbeite bei Fair^Made«. Vielleicht hat sie irgendwo schon mal eine Werbung gesehen.
»Bei wem?«, fragt sie jedoch.
»Fair^Made«, wiederhole ich. »Wir machen Kleidung. Wir achten besonders auf Nachhaltigkeit.«
»Nachhaltigkeit?«, fragt meine Mutter. »Das ist doch so ‘n olles Modewort. Hört man jetzt überall. Im Radio. Im Fernsehen. Überall. Ich hab’ noch nie verstanden, was das heißen soll.«
»Wir achten zum Beispiel darauf, dass die Produkte von nicht zu weit weg kommen. Je kürzer die Transportwege, desto weniger Treibhausgase«, erkläre ich. Ich könnte nicht behaupten, dass ich nach meiner ersten Woche bei Fair^Made schon wirklich verstanden hätte, wie das alles funktioniert.
»So wie früher«, stellt meine Mutter fest. »Früher kam alles aus der Region.«
Sogar die gute alte DDR-Baumwolle, denke ich. Ich frage mich nur, wo ihr die angebaut habt.
Früher war alles besser – das Mantra meiner Mutter. Ich weiß, dass sie da nicht allein ist. Viele Menschen denken so. Menschen, die sich noch mehr von den jungen, hochgebildeten Idealisten bei Fair^Made unterscheiden als ich. Menschen wie meine Mutter. Während der typische Fair^Maker Schwachstellen im Heute erkennt und überlegt, wie diese fürs Morgen beseitigt werden können, damit die Zukunft besser als die Gegenwart ist, war für meine Mutter und Ihresgleichen die Vergangenheit die goldene Zeit und wir blicken in eine düstere Zukunft. Und ich stehe irgendwo in der Mitte.
»Und was machste da?«, zeigt meine Mutter dann doch etwas Interesse. »Hemden nähen?«
Wenn Melanie mir diese Frage so gestellt hätte, wüsste ich, dass sie sich einen Scherz mit mir erlaubt. Doch aus dem Mund meiner Mutter ist das eine ernste Frage.
»Nein, ich ...«, arbeite im Marketing, würde nur zu unangenehmen Diskussionen führen. Natürlich weiß meine Mutter, was Marketing ist. Oder zumindest glaubt sie das. Werbung und so. Leuten Zeug andrehen, das sie eigentlich gar nicht wollen. Diese Diskussion möchte ich mir gern ersparen.
»Ich arbeite als Assistentin fürs Management«, erkläre ich.
»So was wie ‘ne Sekretärin?«
»So in der Art«, bestätige ich. Vielleicht hat sie jetzt Miss Moneypenny vor Augen.
»Und biste ganz ordentlich bezahlt?«, fragt sie weiter.
»Es geht«, sage ich ausweichend. Wenn ich ihr von fünfzigtausend Euro brutto pro Jahr plus leistungsabhängigem Bonus erzählen würde, würde sie mich sofort in die Schublade der verhassten neureichen Berliner stecken. Ich will unsere Beziehung nicht unnötig belasten.
»Dann pass nur auf, dass du dir nicht noch so ‘n Gör einhandelst«, meint sie zwischen zwei Zügen von ihrer Zigarette.
Ich bin sprachlos, als ich erkenne, welches Bild meine eigene Mutter offenbar von meiner Rolle als Sekretärin des Managements hat.
Wenn man von den Gesprächen mit meiner Mutter absieht, verbringe ich ein sehr angenehmes Wochenende. Die Kinder spielen ausgelassen, das Wetter ist so gut, dass wir tagsüber fast die ganze Zeit draußen sind. Am Abend spielen wir mit meiner Mutter eine Partie Monopoly, bei der es hoch hergeht. So sehr meine Mutter den kapitalistischen westlichen Lebensstil verabscheut, der »sämtlichen Anstand im Menschen zerstört«, wie sie es nennt, so leidenschaftlich ist sie doch bei diesem Klassiker der kapitalistischen Brettspiele. Die gewieftesten Manager könnten es meiner Mutter an Skrupellosigkeit nicht gleichtun, wenn sie in eine Partie vertieft ist. Sie trickst beim Würfeln, scheut nicht davor zurück, dem armen Emil sein Wasserwerk im Tausch gegen eine der billigsten Straßen, durch die er keinerlei nennenswerten Vorteil erhält, abzuschwatzen, und hat uns alle nach zwei Stunden Spielzeit und viel Geschrei und Gelächter, aus dem nur ich mich heraushalte, in den Ruin getrieben.
Während des Wochenendes beobachte ich besonders Gwenael, die Worte seiner Klassenlehrerin immer noch im Ohr. Er ist so ausgelassen wie eh und je, lacht, macht mit Doreen, dem gleichaltrigen Mädchen aus dem Dorf, Quatsch und geht so geschickt mit meiner Mutter um, wie ich es niemals könnte.
So bin ich, als ich am Sonntagnachmittag zum Bahnhof gehe, erholt und unbesorgt – ein Zustand, in dem ich seit Jahren nicht mehr war. Ich fühle mich frei. Nicht, weil die Kinder nicht da sind. Frei, weil ich mir keinerlei Sorgen machen muss. Nicht um die Kinder, nicht um unsere gemeinsame finanzielle Zukunft, nicht um mich selbst, denn ich spüre, dass ich seit Langem wieder eine Perspektive habe.