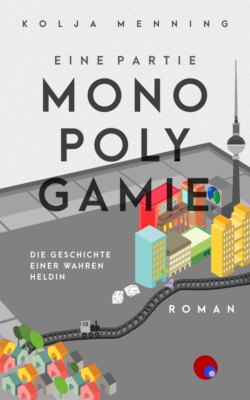Читать книгу Eine Partie Monopolygamie - Kolja Menning - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 1
Ich stehe noch eine Weile vor dem Fair^Made-Bürogebäude. Keine Ahnung, woran ich denke. Ich starre auf das Logo über dem Eingang: ein unvollständiger Kreis, der von einem gelben Blitz – der, wie ich jetzt weiß, kein Blitz, sondern ein S ist – in zwei Teile geteilt wird; die eine Seite ist blau, die andere grün. Unten ist der Kreis offen. Unser aus Wasser und Land bestehender Planet, der auf der Kippe steht. Immerhin habe ich das heute gelernt.
Schließlich gebe ich mir einen Ruck. Es ist höchste Zeit, dass ich in meine Welt zurückkehre. Es ist kurz nach elf, und eigentlich sollte ich schon seit zehn bei den Grafs putzen. Glücklicherweise ist es nicht weit. Als ich um die erste Straßenecke gebogen bin, ersetze ich die Schuhe mit dem Absatz durch ein paar billige Laufschuhe von Decathlon und marschiere los.
Die Wohnung der Grafs ist wie immer verlassen. Die fünfzig Euro für die vier Stunden, die ich hier putzen soll, liegen wie immer auf der kleinen Kommode im Flur. Nachdem ich meine Schuhe ausgezogen habe, laufe ich kurz durch die Wohnung, um mir ein Bild von der Situation zu machen. Erleichtert stelle ich fest, dass die übliche Ordnung herrscht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich es vielleicht in drei Stunden. Länger kann ich nicht bleiben, denn heute Nachmittag gebe ich einen meiner wenigen Yogakurse.
Gut kenne ich die Grafs nicht. Oder den Grafen und die Gräfin, wie ich sie nenne. Als sie mich vor drei Jahren eingestellt haben, um bei ihnen einmal pro Woche zu putzen, habe ich die Gräfin kennengelernt. Ich vermute, dass sie ungefähr in meinem Alter ist. Der Graf ist mir ein paar mal über den Weg gelaufen, weil er etwas zu Hause vergessen hatte. Ich schätze ihn auf Mitte vierzig. Ich habe keine Ahnung, was genau sie tun; sie haben jedoch keine Kinder, und ich bin mir recht sicher, dass sie beide leitende Angestellte in irgendwelchen Unternehmen sind. Die Kommunikation mit ihnen läuft fast ausschließlich per WhatsApp, sie zahlen verlässlich, und ihre Wohnung ist nie übermäßig schmutzig. Sie ist groß, vielleicht hundertfünfzig Quadratmeter, verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und ein großes Wohnzimmer mit eleganter offener Küche und natürlich einem großen Balkon. Über die Jahre habe ich mir ein Bild von den Grafs gemacht. Ich bin mir sicher, dass sie beide deutlich mehr verdienen als die fünfzigtausend Euro, die Fair^Made einer Executive Assistentin im Marketing bezahlt. Sie können sich alles leisten, was sie wollen, davon zeugt ihre Wohnung, doch richtig reich sind sie nicht. Am Schlüsselbrett hängt ein Schlüssel zu einem BMW. Ein recht neuer 5er, wie ich von einem Abstecher in ihre Garage vor ein paar Monaten weiß. Manchmal frage ich mich, in welcher Lebenssituation die Grafs sind. Ob sie wie Viktoria König voll und ganz in ihrer Arbeit aufgehen? Genießen sie ihren relativen Wohlstand? Sind sie glücklich miteinander? Oder befinden sie sich in einer Midlife-Crisis? Wenn ich Veränderungen in ihrer Wohnung entdecke, frage ich mich manchmal, was diese wohl bedeuten. Vor gut einem Jahr hat der Graf sich ein Paar neue Laufschuhe der Marke Asics zugelegt, etwa zeitgleich tauchte im Gästezimmer ein Hometrainer auf. Vielleicht haben die Grafs den Beschluss gefasst, mehr Sport zu treiben. Oder hatte die Gräfin den Grafen darauf hingewiesen, dass er etwas zu viel Bauch bekam? Oder trainierte der Graf für einen Marathon? Letzteres hat sich als unwahrscheinlich herausgestellt, denn die Laufschuhe werden nur selten genutzt. Einmal habe ich sogar die Schnürsenkel der beiden Schuhe aneinandergebunden – und nach vier Wochen hatte sich das nicht geändert. Ein andermal habe ich einen ziemlich großen Dildo in einem Karton unter dem Ehebett gefunden, der eine Woche zuvor mit Sicherheit noch nicht dort gewesen war. Hatte der Graf ihn der Gräfin geschenkt? Ich gestattete mir einen einminütigen imaginären Abstecher in das Leben der Grafs. Mehr nicht. Meine letzte sexuelle Beziehung war die mit Guillaume. Als wir Emil vor sechs Jahren gezeugt haben, hatten wir das letzte Mal Sex. Dass Emil dabei passieren würde, war nicht geplant. Als sich die Schwangerschaft kurz darauf offenbarte, riss Guillaume aus.
»Trois, c’est trop!«, schrie er. »J’en peux plus!« Und dann war er weg. Ich glaube nicht, dass es viel geändert hat. Die Ankündigung, dass Emil auf dem Weg war, mag die Dinge beschleunigt haben. Doch auch mit Gwenael und Désirée war Guillaume bereits überfordert. Es war ihm nie gelungen, eine väterliche Beziehung zu ihnen aufzubauen. Er hatte es auch nie wirklich versucht. Ob drei für mich allein nicht möglicherweise auch zu viel sein könnte, hat ihn nie interessiert.
Nach knapp drei Stunden ist die Wohnung der Grafs sauber. OK, die Schlafzimmerfenster habe ich nicht mehr geschafft.
Als ich vor der Kommode im Flur stehe, zögere ich einen Moment. Eigentlich stehen mir die fünfzig Euro nicht zu. Fünfzig Euro für vier Stunden. Das ist die Vereinbarung, an die ich mich auch fast immer halte. Ich frage mich, was Viktoria König tun würde. Würde sie den Schein nehmen, dann aber zwölf Euro fünfzig als Wechselgeld hinlegen? Mit einer entschuldigenden Notiz? Oder würde sie beim nächsten Mal eine Stunde früher kommen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine dieser Optionen wählen würde. Andererseits würde Viktoria König nie die Wohnung anderer Leute putzen. Und ich bin nicht sie. Ich bin ich. Ich kann mir diese Ehrlichkeit nicht leisten. Also stecke ich das Geld ein und eile los.
Der Yogakurs, den ich freitagnachmittags gebe, dauert neunzig Minuten und findet jede Woche statt. Ich unterrichte drei Mütter Mitte vierzig mit ihren Töchtern, die zwischen zwölf und vierzehn sind. Die drei Frauen gehören zu jenen Müttern, die sehr viel für ihre Kinder geopfert haben. Eine der drei arbeitet halbtags, eine andere freiberuflich als Übersetzerin, die Dritte arbeitet nicht. Alle drei sind für ihren Lebensstil auf die Gehälter ihrer Ehemänner angewiesen. Sie achten auf ihre Ernährung, kaufen fast ausschließlich Bio und machen Yoga mit ihren Töchtern, weil sie fest davon überzeugt sind, dass dies gut für die Mädchen ist. Wahrscheinlich haben sie recht. Sie nehmen das Training ernst, sind immer pünktlich und zahlen sechzig Euro für neunzig Minuten. Brutto. Denn von meiner Tätigkeit als Yogalehrerin weiß das Finanzamt, während es sich mit dem Putzen etwas anders verhält. Da die Stimmung mit den sechs Mädels, wie ich sie gern anspreche, immer gut ist, ist es mein Lieblingskurs. Hier kann sogar ich mich entspannen.
Der Kurs mit ihnen ist vor gut einem Jahr zustande gekommen, was ich meinem älteren Sohn Gwenael zu verdanken habe. Gwenael ist zehn, und einer seiner Klassenkameraden ist der Sohn einer der drei Frauen – und entsprechend der kleine Bruder eines der Mädchen.
Meist treffen wir uns bei einer der Familien zu Hause, wo sich ein riesiges Wohnzimmer ideal für Yoga eignet. Doch heute ist gutes Wetter, daher treffen wir uns im Volkspark Friedrichshain auf einer großen Wiese.
Nach dem Kurs bleiben die sechs Mädels im Park. Sie haben ein kleines Picknick vorbereitet, mit dem sie sich für ihre sportliche Leistung belohnen wollen. Sie laden mich ein, bei ihnen zu bleiben, doch ich lehne dankend ab. Wenn ich nicht spätestens in vierzig Minuten bei Emils Kita bin, wird er traurig. Normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad. Doch heute bin ich wegen des Interviews bei Fair^Made mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Also haste ich zur nächsten Tram-Haltestelle und begebe mich auf den Weg quer durch Berlin.
Als ich bei der Kita ankomme, empfängt Emil mich mit vorwurfsvollem Blick.
»Du bist zu spät«, sagt er trotzig.
Ich gucke auf eine große Wanduhr. Er hat recht. Ich bin zehn Minuten später da als üblich. Eigentlich gibt es keine festen Abholzeiten, doch ab dem Moment, wo sein Freund Andy abgeholt wird, sitzt er vor der Uhr und zählt die Minuten. Andy wird von seinem Vater immer pünktlich um halb fünf abgeholt. Fünfzehn Minuten später darf ich kommen. Darauf haben Emil und ich uns geeinigt. Ich habe ihm erklärt, warum ich es früher nicht immer schaffen kann, und er hat das eingesehen. Aber fünfundzwanzig Minuten sind nicht OK.
»Es tut mir leid«, sage ich. Er ist in einer Phase, in der er sehr auf Vereinbarungen achtet. Deswegen versuche ich weder, mich herauszureden, noch weise ich darauf hin, dass ich ihn gestern eine halbe Stunde vor Andy abgeholt habe, was nur möglich war, weil die Eichners mir kurzfristig mitgeteilt hatten, dass ich diese Woche nicht zu putzen bräuchte, wodurch ich fünfzig Euro weniger im Portemonnaie habe.
Vor der Kita sieht er sich um.
»Wo ist denn dein Fahrrad?«, fragt er.
»Ich bin heute nicht mit dem Fahrrad gekommen«, antworte ich, und seine Miene verfinstert sich.
»Ich will nicht laufen«, erklärt Emil. »Ich will in den Kindersitz.«
»Es ist doch nicht weit«, versuche ich es mit Geduld. »Nur zehn Minuten.«
»Zehn Minuten ist nicht nur. Zehn Minuten ist viel. Du bist zehn Minuten zu spät gekommen, und ich hab’ gewartet. Jetzt bin ich müde.«
Ich blicke ihm in die Augen.
»Und was schlägst du vor?«, frage ich ihn und warte.
Er überlegt.
»Du läufst nach Hause und holst dein Fahrrad«, sagt er dann. »Ich warte hier.«
»Oder ich laufe nach Hause und bleibe da«, sage ich. »Du kannst gern hier warten, bis die Kita morgen wieder aufmacht.«
»Morgen ist keine Kita, morgen ist Wochenende«, entgegnet er. »Außerdem darfst du das nicht.«
»Und wieso nicht?«
»Weil du meine Mama bist und du auf mich aufpassen musst«, erklärt er.
Wenn er so was sagt, erweicht es mir immer das Herz. Ich strecke meine Hand aus.
»Komm!«, sage ich sanft.
Er blickt einen Moment lang auf meine Hand. Schließlich ergreift er sie und stapft ohne ein weiteres Wort los.
Als wir nach Hause kommen, sind Gwenael und Désirée bereits da.
»Mama!«, ruft Désirée freudig, als sie die Wohnungstür hört, und kommt auf mich zugestürmt.
»Hallo, mein Schatz«, sage ich und schließe sie in die Arme. »Wie war’s in der Schule?«
»Frau Bauer hat gesagt, du musst das Geld für die Klassenkasse noch bezahlen.«
Ach, ja. »Mach’ ich.«
»Aber heute.«
»Versprochen.«
»Wo ist denn dein Bruder?«, frage ich sie, nachdem ich meine Schuhe ausgezogen und meine Tasche abgelegt habe.
»In seinem Sessel.« Désirée hüpft fröhlich von einem Bein aufs andere.
»Er liest«, fügt sie hinzu und rollt mit den Augen, als wäre unverständlich, wie jemand freiwillig so etwas tun könnte.
Wie die Grafs haben auch wir eine Wohnküche. Kleiner. Älter. Weniger aufgeräumt und vor allen Dingen mit deutlich weniger hochwertigem Mobiliar ausgestattet. Das neueste Möbelstück in unserer bunten Sammlung ist ein ziemlich siffiger Sessel, den Gwenael und Désirée vor ein paar Wochen auf dem Schulweg auf der Straße aufgegabelt haben. Er ist nicht nur siffig, sondern auch hässlich, was Gwenael nicht stört, denn er ist bequem.
»Alles klar?«, frage ich ihn, die Wohnküche betretend.
»Ja«, sagt er, ohne von seinem Buch aufzublicken.
»Gwen hat in Mathe eine Sechs«, verkündet Désirée.
»Was?!«, rufe ich aus. »Das kann nicht sein. Wirklich, Gwenael?«
Er reagiert nicht, sondern starrt nur auf sein Buch.
»Gwenael? Stimmt das?«
Langsam wendet er den Kopf mir zu.
»Was?«, fragt er, obwohl er genau weiß, worum es geht.
»Stimmt es, dass du in Mathe eine Sechs bekommen hast?«
Er zuckt nur mit den Schultern.
»Ich war nicht so gut drauf«, sagt er gleichgültig.
»Nicht so gut drauf??«, bricht es aus mir heraus, bevor ich mich kontrollieren kann, »und dann schreibst du eine SECHS???«
Er zuckt etwas zusammen, und im selben Moment tut mir mein Ausbruch leid. Aber ich habe schon zu viele Sorgen. Gwenaels Mathenoten gehörten bis vor zwei Minuten nicht dazu.
»Das war die letzte Klassenarbeit des Schuljahres, Gwenael. Wie konnte das passieren?«
»Weiß nicht«, erwidert er defensiv.
»Kann ich das mal sehen?«
Er weiß, dass das keine wirkliche Frage ist. Langsam erhebt er sich aus seinem Sessel, schlurft zu seinem Schulranzen und kommt schließlich mit einem Heft zu mir. Ich schlage es auf und starre auf das, was da in roter Tinte unter der letzten Klassenarbeit steht:
2 von 52 Punkten. Ungenügend. Note: 6.
Und dann die Unterschrift des Lehrers.
Ich sehe ein paar der Rechnungen an. Schriftliche Division und Multiplikation. Ein paar Textaufgaben, bei denen ich auch überlegen muss. Rechnen mit Distanzen in Metern und Kilometern und mit Zeiten. Gwenael hat überall in sehr sauberer Handschrift Ergebnisse hingeschrieben. Und sie sind tatsächlich bis auf die zwei ersten Aufgaben, die recht einfach sind, alle falsch.
»Du musst das unterschreiben«, sagt Gwenael.
So was unterschreibe ich nicht!, will ich ihn anbrüllen. Dann atme ich tief durch und halte meine Hand auf. Wortlos reicht er mir einen Stift, und widerstrebend setze ich meine Unterschrift unter die Klassenarbeit.
»Wie war’s sonst so in der Schule?«, frage ich ihn und bemühe mich um einen versöhnlichen Tonfall.
»Frau Wagner will, dass du Montagmittag in die Schule kommst«, antwortet Gwenael.
»Du meinst, Herr Stein.« Der ist nämlich der Mathelehrer. Frau Wagner ist Gwenaels Klassenlehrerin.
»Nein, Frau Wagner. Hier.« Er reicht mir einen Zettel. Darauf steht:
Sehr geehrte Frau Nussbaum,
Gwenael gibt mir in letzter Zeit Grund zur Sorge. Ich möchte das gern mit Ihnen besprechen und bitte Sie, mich am Montag um 12.30 Uhr in der Schule zu treffen.
Mit freundlichem Gruß
Elisabeth Wagner
Ich blicke von dem Blatt zu Gwenael und dann wieder auf das Blatt. Am Montag um 12.30 Uhr kann ich nicht. Da putze ich bei den Kramers.
»Gwenael, kannst du mir bitte sagen, was das bedeutet?«, frage ich.
»Ich weiß es nicht«, sagt er.
Ich weiß, dass das nicht stimmt. Er weiß genau, worum es geht. Und er weiß, dass ich das weiß. Dass er sich trotzdem dumm stellt, muss einen Grund haben. Da ich spüre, wie auch Emil und selbst Désirée mich etwas eingeschüchtert ansehen, lasse ich die Sache vorerst auf sich beruhen.
»Habt ihr Hausaufgaben auf?«, wechsele ich das Thema.
»Schon gemacht«, antwortet Gwenael.
»Und du, Désirée?«
»Ich nicht«, singt sie. Sie ist schon wieder fröhlich.
»Du hast keine auf oder du hast sie noch nicht gemacht?«
»Hab’ sie nicht gemacht«, sagt sie sorglos, während sie einen Kopfstand auf Gwenaels nun freiem Sessel probiert.
»Und wieso nicht?«, frage ich.
»Weil morgen Wochenende ist!«, antwortet sie, jedes Wort betonend, mit dem Kopf nach unten, sodass ihr Gesicht rot anläuft. Sie ist dabei so unverschämt fröhlich, dass ich lachen muss. Désirée ist unser Sonnenschein.
Später mache ich Spaghetti mit einer einfachen Tomatensoße aus dem Glas. Das Lieblingsgericht aller drei Kinder. Alle sind wieder frohen Mutes; Emil scheint seine angebliche Müdigkeit vergessen zu haben und Gwenael seine Sechs in Mathe auch.
»Wer liest heute Abend die Geschichte vor?«, frage ich, als wir den Tisch gemeinsam abgeräumt haben.
»Du!«, rufen alle drei wie aus einem Munde.
»Na gut«, erwidere ich, »aber ich suche das Buch aus.«
»OK, aber nich’ wieder das mit den komischen Namen«, sagt Emil.
»Ja, genau, nicht die griechische Melodie«, stimmt Désirée zu.
»Griechische Mythologie«, korrigiert Gwenael indigniert. »Ich würde sie gern hören. Ich mag Hermes und Apollon.«
»Ich mag Aphrodite«, flötet Désirée und grinst, als verstünde sie mit ihren sieben Jahren genau, wofür die Göttin der Liebe steht.
»Und ich, ich mag Cristiano Ronaldo«, verkündet Emil.
Gwenael und ich sehen uns an und rollen gleichzeitig mit den Augen.
»Wisst ihr was? Heute erzähle ich euch eine Geschichte vom Zauberer Fridolin«, entscheide ich, und drei Augenpaare beginnen zu leuchten.
Da wir außer der Wohnküche nur zwei Zimmer haben, schlafen die Kinder gemeinsam in einem Zimmer und ich in dem anderen. Hin und wieder will Emil bei mir schlafen. Und manchmal kommt Désirée mich nachts besuchen. Freitags jedoch schlafen wir immer zusammen im Zimmer der Kinder. Ihre Betten sind zwei alte Doppelmatratzen, die wir schon vor Jahren in den Straßen Berlins gefunden haben. Tagsüber legen wir sie übereinander, sodass mehr Platz ist, für die Nächte legen wir sie auf den alten Holzdielen nebeneinander.
Als die drei später schlafen, Emil zu meiner Rechten, Désirée und Gwenael zu meiner Linken, und ich noch im Dunkeln sitze und an das Interview heute Morgen denke, klingelt mein Handy. Es gelingt mir, es zu ergreifen, ohne aufzustehen.
Melanie Lange, kündigt das Display an.
»Hallo Mel«, melde ich mich.
»Was bist du denn für eine Freundin?«, sind ihre ersten Worte. »Rufst mich noch nicht mal an, um mir zu sagen, wie’s gelaufen ist! Wie war das Interview?«
Ich seufze.
»Ich weiß nicht«, sage ich zögernd. »Es war ganz OK, aber ich glaube, das wird nichts.«
»Clara, könntest du bitte etwas konkreter werden?«
»Ich pass’ bei denen gar nicht rein«, sage ich.
»Clara, du redest in Rätseln. Erzähl doch einfach, wie es war! Wie war sie, diese Viktoria König, Chief Marketing Officer of Fair^Made?«
Ich muss lachen bei dem Tonfall, den Melanie annimmt, als sie Viktorias Titel ausspricht.
»Sie ist vermutlich um die dreißig, sehr gut aussehend, nett, intelligent und ein guter Mensch.«
»Genau wie du!«, ruft Melanie aus.
»Sie ist das genaue Gegenteil von mir«, widerspreche ich. »Ich bin vierzig!«
Und ein guter Mensch bin ich auch nicht, füge ich in Gedanken hinzu und denke an die fünfzig Euro, die ich bei den Grafs genommen habe, obwohl mir nur siebenunddreißig Euro fünfzig zustanden. Die Welt verbessern will ich auch nicht – einfach nur über die Runden kommen.
»Aber trotz deiner drei Kinder siehst du mit deinem Yogakörper aus wie dreißig«, insistiert Melanie. »Höchstens fünfunddreißig. Dein Alter spielt auch keine Rolle! Du bist gebildet und intelligent – und siehst mit deiner Brille auch so aus. Sexy und intelligent. Du hast studiert und liest deinen Kindern griechische Sagen vor.«
»Und ich putze die Wohnungen anderer Leute.«
»Weißt du, was ich an dir mag, Clara Magdalena Nussbaum?«, fragt Melanie. »Deinen unbändigen Optimismus. Der ist schon wirklich erfrischend.«
Wir schweigen einen Moment. Dann nimmt Melanie das Gespräch wieder auf.
»Und wie war das tatsächliche Interview?«
»Eigentlich nicht schlecht«, gebe ich zu. »Du hast mich wirklich gut vorbereitet.«
Ich erzähle ihr von dem Gespräch.
»Das hört sich doch super an«, findet Melanie. »Und wieso meinst du dann, dass das nichts wird?«
»Die wollen nur die Besten«, wiederhole ich Viktorias Worte. »Die Besten – da gehöre ich einfach nicht dazu.«
»Woher willst du das wissen?«, fragt Melanie.
In diesem Moment bewegt sich etwas zu meiner Linken.
»Du bist die beste Mama«, sagt Gwenael im Schlaf, wälzt sich auf den Bauch und legt sein Bein quer über seine Schwester. Dies sind die Momente, die das Leben dann doch lebenswert machen. Ich blicke einen Moment auf meine drei schlafenden Kinder. Dann muss ich wieder daran denken, dass Frau Wagner Gwenaels Verhalten merkwürdig findet. Was mag da wohl passiert sein? Mir ist nichts aufgefallen.
»Clara, bist du noch da?«, reißt mich Melanie aus meinen Gedanken.
»Was? Ja, ja. Was hast du gesagt?«, frage ich etwas leiser.
»Du wolltest mir erklären, wieso du nicht zu den Besten gehörst«, erinnert mich Melanie.
»Ich habe im Leben noch nie zu den Besten gehört«, erkläre ich.
»Aber du hast dein Bestes gegeben.«
»Ja«, stimme ich zu. Nur dass mein Bestes nicht gut genug gewesen sein wird.
»Und wann geben sie dir Bescheid?«
»Bis nächsten Freitag«, antworte ich.
»Ich drück’ die Daumen«, sagt Melanie. »Clara, ich muss jetzt los. Ich gehe mit Anton essen.«
Ich nehme kurz das Handy vom Ohr und blicke auf das Display. 22.05 Uhr. Melanie ist neununddreißig. Im Unterschied zu mir hat sie keine Kinder. Stattdessen hat sie seit ein paar Wochen Anton. Ende vierzig, geschieden, zwei Kinder, die mit ihrer Mutter irgendwo in Bayern wohnen. Was genau Melanie an ihm findet, weiß ich nicht, doch es ist mir auch egal, solange sie glücklich ist.
»Sehen wir uns dieses Wochenende?«, frage ich.
»Dieses Wochenende geht nicht«, erwidert Melanie. »Anton und ich fliegen nach Rom!«
»Viel Spaß!«, wünsche ich ihr zum Abschied.
Nicht nur Viktoria Königs Leben ist ganz anders als meins. Auch das meiner besten Freundin hat nur wenig mit meinem gemein. Sie reist übers Wochenende mal eben nach Rom. Ich hingegen werde ein recht gewöhnliches Wochenende haben. Einkaufen, mit den Kindern auf Spielplätze gehen, darauf achten, dass auch Désirée ihre Hausaufgaben macht. Vielleicht gelingt es mir, spontan einen Yogakurs zu geben und mir so ein paar Euro dazuzuverdienen. Und zur Abwechslung werde ich mal unsere Wohnung putzen. Und während Melanie sich am Freitagabend fertigmacht, um mit ihrem neuen Freund auszugehen, liege ich erschöpft im Bett in dem Bewusstsein, dass mir in spätestens fünf Minuten die Augen zufallen werden.