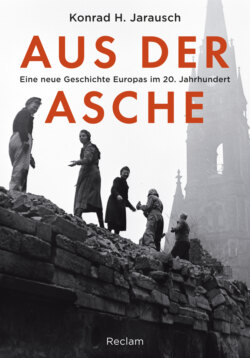Читать книгу Aus der Asche. Eine neue Geschichte Europas im 20. Jahrhundert - Konrad H. Jarausch - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Koloniale Prägekraft
ОглавлениеDer Imperialismus bewirkte in den Kolonien eine tiefgreifende Transformation, da er unwilligen Untertanen eine einseitige und destruktive Form von Modernisierung aufdrängte. Binnen einer einzigen Generation nach der Ankunft der weißen Kolonisatoren änderte sich das äußere Erscheinungsbild des öffentlichen Lebens in Afrika von Grund auf. Der Wandel reichte von der Verbreitung westlicher Kleidung bis zum stark vermehrten Auftauchen christlicher Symbole. Wie weit das ging, hing natürlich ab vom Entwicklungsstand der lokalen Kultur und jeweils gegebenen Möglichkeiten europäischer Machtausübung. Entsprechend kam es im Großteil Afrikas zu drastischen Veränderungen, während die Einwirkung in Asien, wo der Widerstand stärker war, schon weniger deutlich ausfiel. Mochten einige Neuerungen das Ergebnis formalen Zwanges gewesen sein, den die neuen Herren anwandten, entwickelten sich andere durch informelle Kontakte zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten. Die Umformung begann allmählich in den kolonialen Zentren, expandierte aber dann über das gesamte Territorium, sodass ein instabiles Hybridgebilde aus alten Gebräuchen und neuen Gepflogenheiten entstand. Da eine krasse Ungleichheit die Beziehung kennzeichnete, waren auch die Resultate höchst gemischt; reichlich brutale Unterdrückung gab es ebenso wie einige humanitäre Verbesserungen.
Ein problematischer Punkt der erzwungenen Modernität war die Arbeitswelt. Statt ihrer traditionellen Tätigkeiten in Landwirtschaft oder Handwerk mussten die Einheimischen, vorwiegend die männlichen, nun harte Fron auf Plantagen oder im Bergbau verrichten. Gewöhnlich wurden sie mit Gewalt verpflichtet und gezwungen, ihr knochenbrechendes Tagewerk ohne die Hilfe von Maschinen zu erledigen. So ließen sich die einschlägigen Ressourcen wesentlich besser ausbeuten. Die Kolonisierten durften nicht mehr dem Rhythmus der Sonne oder der Jahreszeiten folgen, sondern sie mussten westliche Zeitbegriffe internalisieren; nun gab die Uhr oder die Sirene die Länge ihres Arbeitstages vor. Außerdem bläute man ihnen europäische Vorstellungen von Arbeitsdisziplin ein: Sie mussten unermüdlich schaffen, bis das zugewiesene Werk getan war, statt Pausen einzulegen, wann immer sie spürten, dass sie welche brauchten. Für ihre Mühen wurden sie in Naturalien oder in Geld entlohnt, aber es reichte kaum zum Leben. Sobald sie in ihrem Eifer nachließen oder sich beschwerten, wurden sie brutal geschlagen von meist weißen Aufsehern, welche die Rassenhierarchie verschärften, weil sie willkürlich strafen durften. Der Übergang vom traditionellen Leben zur kapitalistischen Arbeitswelt fand ja auch anderswo statt, aber in den Kolonien wurde er besonders prekär durch die noch rücksichtslosere Ausbeutung von Natur und Mensch.1
Die Heimstätten der Kolonisten, wo die meisten einheimischen Frauen arbeiteten, waren ein weiterer Schauplatz Ungleichheit produzierender Modernisierung. Der exquisite koloniale Lebensstil erforderte zahlreiche Dienstboten, die kochten, putzten, die Wäsche wuschen, die Gärten versorgten und die Kinder betreuten; schließlich sollte die weiße Hausherrin ein Leben in Müßiggang führen können. Damit sie effizient funktionierten, hatten die indigenen Frauen rasch bestimmte Tugenden der europäischen Mittelschicht zu verinnerlichen, wie etwa Ordentlichkeit, Sauberkeit, Sparsamkeit, Fleiß und Pünktlichkeit. Gleichzeitig mussten sie sich, um ihre Pflichten auch erfüllen zu können, hinreichend Kenntnisse europäischer Standards in Sachen Kleidung und Essenszubereitung aneignen. Im Haushalt gab es zwar weniger körperliche Misshandlungen als auf den Feldern, doch machte der koloniale Paternalismus dem Personal auch hier unmissverständlich klar, wo oben und unten sei, und die Herrinnen konnten sich höchst anspruchsvoll und kapriziös gebärden. Ein permanentes Problem stellte der Geschlechtstrieb dar, denn es standen einfach nicht genug weiße Frauen zur Verfügung; und so schwängerten denn weiße Kolonialherren häufig einheimische Mädchen. Auf diese Weise schufen sie eine Mischlingskaste, die Mulatten, die dann quasi zwischen zwei Rassen feststeckten. Die weißen Frauen dagegen waren durch den sozialen Druck gehalten, auch auf ihre Art die Rassentrennung innerhalb der Kolonialgesellschaft aufrechtzuerhalten.2
Die Handelsstationen waren ein weiterer Schauplatz der Modernisierung, denn dort wurden nun die Indigenen in den monetären Tauschverkehr einbezogen, allerdings unter häufig ungerechten Bedingungen. Auch die weißen Siedler im Hinterland sollten mit ihren gewohnten Waren versorgt werden, und dabei kam diesen Außenposten eine zentrale Bedeutung zu. Gleichzeitig lehrten sie die Einheimischen, ihre traditionellen Formen des Warentauschs aufzugeben und stattdessen gegen Geld zu kaufen bzw. zu verkaufen. Während in relativ weit entwickelten Ökonomien Münzsysteme bereits existierten und sogar überlebten, wurde anderswo die Währung des kolonisierenden Landes das wichtigste Tauschmittel. Der westliche Händler bot seinen einheimischen Kunden Alltagsgeräte wie metallene Kochtöpfe und Messer feil, ebenso Gewürze wie Salz, daneben Baumwollstoff und Nippes. Umgekehrt erwarb er lokale Produkte wie Kakaobohnen, Teeblätter und überhaupt alles, was sich in Europa als »Kolonialwaren« verkaufen ließ. Manchmal übernahmen andere Mittelsmänner die Rolle des westlichen Händlers – etwa Inder in SüdafrikaSüdafrika, Chinesen in weiten Teilen Asiens. Aber generell erwies sich dieser Handel als zutiefst unfair, denn die Indigenen waren dem Preisdiktat der weißen Geschäftsbetreiber hilflos ausgeliefert.3
Von der Begegnung mit der europäischen Kultur in den Schulen konnten sich die Kolonisierten schon mehr versprechen; immerhin gab man vor, moderne Aufklärung unter den »unwissenden Ureinwohnern« zu verbreiten. Zweifellos hatte die Initiation ins Lesen, Schreiben und Rechnen einen befreienden Effekt auf die oft noch analphabetischen Kinder, denn sie erschloss ihnen den Zugang zur großen Welt des Lernens und der Bildung. So rückten sie dem Ziel näher, mit den Weißen von Gleich zu Gleich zu verkehren. Aber der Unterricht fand in fremder Zunge statt, in der Sprache des kolonialen Lehrers, besonders in den höheren Schulen. Außerdem glorifizierten die Lektionen in der Regel Vergangenheit und Gegenwart des »Mutterlandes«. Den Errungenschaften der lokalen Kultur wurde dagegen kaum Beachtung geschenkt; stattdessen schuf man eine künstliche Welt, die die mère patrie nachstellte. Zudem gaben die oft strikt säkularistischen Lehrer traditionelle Gebräuche der Einheimischen als ›Aberglauben‹ der Lächerlichkeit preis und zerstörten so die alte Religion, ohne etwas Gleichwertiges an ihre Stelle zu setzen. Zwar eröffneten geschriebene Texte den Indigenen wahre Reiche des Wissens, aber sie drängten eben auch über lange Zeit gewachsene orale Traditionen in den Hintergrund. Es wundert kaum, dass Intellektuelle der Kolonialvölker oft beklagten, sie seien ihrem eigenen Erbe entfremdet worden, ohne dass sie sich in der westlichen Welt gänzlich heimisch fühlen könnten.4
Auch die Missionierung geschah mit dem Anspruch, den Indigenen Gutes zu bescheren, wollte man ihnen doch eine seligmachende Botschaft vermitteln. Man verfolge altruistische Absichten, hieß es, schließlich bringe man den Heiden die Segnungen des Christentums. Nicht selten unter Gefährdung des eigenen Lebens mühten sich Missionare verschiedener Konfessionen ab, um lokale Formen des Aberglaubens, etwa Voodoo oder Animismus, zu vertreiben und sie zu ersetzen durch die Hoffnung auf Erlösung nach dem Tode. Effektiver als ihre Lektionen waren handfestere Werke der Wohltätigkeit, etwa Albert SchweitzersSchweitzer, Albert Hospital in Lambarene, das lokale Seuchen bekämpfte und Arme vor dem Hungertod rettete. Die Taufe von Konvertiten war oft ein freudenreiches Ereignis, denn es führte die neuen Anhänger in die Gemeinschaft eines freundlicheren Glaubens. Aber wenn sich das Christentum hochentwickelten Religionen gegenüberfand, etwa dem Islam, dem Buddhismus oder dem Konfuzianismus, kam es nur schwer voran, denn es hatte kaum Spiritualität zu bieten, die diese Richtungen nicht schon besaßen.5 Die Missionare zeichneten indigene Sprachen auf, sicherlich ein Verdienst – und doch war die Mission im Grunde eine herablassende Veranstaltung, die zur Voraussetzung nahm, dass man den überlegenen religiösen Durchblick besaß. Zudem erschraken die frisch Konvertierten nicht selten darüber, dass die Europäer sich selbst kaum an ihre christlichen Prinzipien hielten.
Das entscheidende Instrument der bürokratischen Modernisierung war das Kolonialamt, das die europäische Herrschaft über eine unruhige lokale Bevölkerung aufrechtzuerhalten hatte. Verwaltungsbüros, Gerichte, Polizeistationen und Zollhäuser mussten das Verhältnis zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten dahingehend organisieren, dass ein reibungsloses Funktionieren der regierten Gebiete garantiert werden konnte. Wenn sie in der Welt der Weißen überleben wollten, mussten die Kolonisierten allerlei lernen: ungewohnte bürokratische Vorschriften, fremde Rechtsvorstellungen, seltsam erscheinende Verhaltensmuster und neue ökonomische Regularien. Besonders dort, wo nur wenige europäische Verwaltungskräfte vor Ort waren, bedurfte die Kontrolle über große Territorien und Bevölkerungen der Unterstützung durch ausgebildete Einheimische, niederrangige Beamte, die man zu Büroangestellten, Gerichtshelfern, Polizisten und Zöllnern ernannte. Während ihrer Arbeit bemerkten diese Subalternen mehr und mehr, dass sie ihre Kenntnis der europäischen Gesetze und Verfahrensweisen auch für ihre eigenen Interessen nutzen konnten.6 Paradoxerweise mussten sie, die im Kolonialjargon bald »verwestlichte orientalische Herren« (westernized oriental gentlemen) hießen, gerade um sich dieses Wissen anzueignen, die europäische Dominanz mit aufrechterhalten und gerieten so zwischen die kulturellen Fronten.
Die Reaktion der Kolonisierten auf diese ausbeuterische Modernisierung war daher höchst ambivalent, was aber nur die Doppelnatur und Widersprüchlichkeit der kolonialistischen Einwirkung reflektierte. Als ihnen klar wurde, wie destabilisierend die Kolonialisierung wirkte, versammelten sich die lokalen Eliten hinter ihren eigenen Traditionen, um sie zu verteidigen. Dies geschah manchmal in blutigen Erhebungen, etwa dem Sepoy-Aufstand 1857, die mit großer Brutalität niedergeschlagen wurden. Eine erfolgreichere Taktik war die der Anpassung: Man lernte gemeinschaftlich die europäischen Gebräuche und Methoden, um sie für die eigenen Zwecke zu nutzen. Denen, die dies versuchten, kam zugute, dass liberale Kolonisatoren den Söhnen der einheimischen Elite erlaubten, an britischen und französischen Universitäten zu studieren, um sich die technischen Fähigkeiten, das Feinwissen und die Kultiviertheit der Europäer anzueignen – Kompetenzen, die sie brauchten, um nach ihrer Rückkehr bei der Transformation ihrer Heimatländer mitzuhelfen.7 In den autokratischeren Landimperien zog dieser Prozess unweigerlich die totale Assimilation an die herrschende Ethnie nach sich, etwa an die Türken, die Russen, die Deutschen oder die Ungarn. Gleichermaßen willkommen geheißen und zurückgestoßen, beschlossen jene kolonialen Intellektuellen, die sich nicht mit ihrer untergeordneten Rolle abfinden mochten, folgende Strategie: Sie wollten ebenjene attraktiven Ideologeme, bewährten Organisationsverfahren und schlagkräftigen militärischen Techniken, die sie von den Europäern gelernt hatten, verwenden, um die koloniale Herrschaft abzuschütteln.