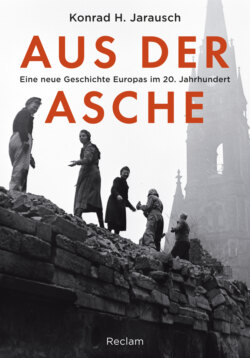Читать книгу Aus der Asche. Eine neue Geschichte Europas im 20. Jahrhundert - Konrad H. Jarausch - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Imperiale Kultur
ОглавлениеZwar wird dieser Aspekt oft übersehen, doch der Imperialismus hatte durchaus eine beträchtliche Prägewirkung auch auf die europäischen Länder, deren eigene Entwicklung er teils beschleunigte, teils behinderte. Einige Wissenschaftler meinen, dass sich in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts eine »imperiale Kultur« herausbildete, welche die Notwendigkeit, ein Imperium zu haben, propagierte und dessen Nutzen für die gesamte Gesellschaft pries. Dann hätte der Imperialismus aber viel umfassender als Lehrstoff in den Schulen auftauchen müssen, tatsächlich spielte er dort kaum eine Rolle. Andere Historiker vertreten deshalb die These von den »geistesabwesenden Imperialisten«: Zwar seien sie welche gewesen, aber es sei ihnen nicht recht zu Bewusstsein gekommen. Denn die Einwirkung des Imperiums auf das Leben der Durchschnittsmenschen in Europa sei tatsächlich minimal gewesen.1 Betrachtet man die Belege und Befunde näher, drängt sich der Schluss auf, beide Lesarten könnten teilweise korrekt sein. Eine stark engagierte Minderheit enthusiastischer Imperialisten war direkt ins Betreiben der Kolonien involviert, von denen sie profitierten, weswegen sie ihnen hohe Bedeutung zumaßen. Die passive Mehrheit kam mit der Angelegenheit hingegen kaum in Berührung. Sie nahm die Existenz ihres Imperiums schlicht hin, solange es sie nicht belastete. Doch eine kleine, aber wachsende Schar von Kritikern begann allmählich Einsprüche zu erheben gegen die finanziellen Kosten des Imperialismus und gegen seine ethischen Verstöße.
Unter jenen, die das Thema Imperium als verlockend empfanden, bildeten europäische Wissenschaftler, die sich in weite Ferne begaben, um neue Dinge zu entdecken, eine bedeutsame Gruppe. Eine ganze Phalanx von Disziplinen war beteiligt: Geografen verkarteten bisher »unbekannte« Territorien; Geologen prüften diese auf Erzlagerstätten; Biologen katalogisierten neue Tier- und Pflanzenarten; Ethnologen beobachteten die Sitten und Gebräuche der »primitiven Kulturen«; Linguisten transkribierten die Dialekte vor Ort; Mediziner studierten die Ursachen tropischer Krankheiten. Zuerst fügten diese Erkundungen nur bereits existierenden Forschungsbereichen neue hinzu, nämlich Nichteuropäisches betreffende Spezialgebiete. Schließlich aber fasste man diese verschiedenen Sujets in Kolonialinstituten zusammen, in denen künftige Imperialisten ausgebildet werden sollten. Wie der postkoloniale Literaturtheoretiker Edward SaidSaid, Edward zu Recht vermerkt, war die Perspektive, die man dort einnahm, ein paternalistischer Blick, der das fremde »Andere« zum Studienobjekt reduzierte. Außerdem zog die exotische Differenz das allgemeine Publikum in den Kolonialausstellungen und den frisch eröffneten Völkerkundemuseen an. Während viele der Funde und Ergebnisse das Bewusstsein rassischer Überlegenheit festigten, trugen andere Forschungen zu wissenschaftlichen Entdeckungen bei, von denen auch die kolonisierten Völker etwas hatten – etwa indem sie ihnen ermöglichten, tropische Krankheiten zu bekämpfen.2
Einen weiteren einflussreichen Block der Imperialismusbefürworter bildeten die Geschäftsleute, die vom Handel mit den Kolonien profitierten. Einige besaßen Schifffahrts- oder Eisenbahnlinien, die Waren und Post transportierten; dadurch stellten sie Verbindungen und Verkehr zwischen der Heimat und den Kolonien sicher. Auch die Betreiber von Gewürz-, Kaffee- oder Obstplantagen schätzten das Imperium, ebenso die Einzelhändler in Europa, die sie belieferten und die auf eine nicht abreißende Versorgung mit solchen Kolonialwaren angewiesen waren. Viele Kompanien ließen nach wertvollen Mineralien suchen, etwa Diamanten, oder nach Rohstoffen wie Kupfer. Die Materialien wurden dann veredelt und in zahllose Produkte eingearbeitet, die man an Kunden in den Metropolen verkaufte. Imperiumsgewinnler waren ferner die Fabrikanten massengefertigter Textilien und Küchengeräte wie Kochtöpfe; sie brauchten die kolonialen Märkte, damit sie ihre Produktion über das hinaus steigern konnten, was sie zu Hause absetzten.3 Und sogar einige einfache Leute bauten aufs Imperium: Entweder wollten sie sich im Kolonialhandel ein Vermögen erarbeiten oder aber sich dauerhaft in einem dieser Gebiete niederlassen. Zwar meinten liberale Skeptiker, die ökonomischen Ziele, um derentwillen man Kolonialismus treibe, ließen sich billiger durch Freihandel erreichen. Doch die Imperialisten beharrten, politische Kontrolle sei unverzichtbar.
Staatsbedienstete, die auf eine raschere Karriere hoffen konnten, wenn sie sich in die Auslandsterritorien versetzen ließen, bildeten eine weitere imperiumsfreundliche Interessengruppe. Besonders Armee- und Marineoffiziere lockten die Abenteuer in der Fremde; zudem durften sie damit rechnen, dort schneller befördert zu werden als daheim. In den Kolonien konnten sie ferner neue Waffen wie Kanonenboote und Artillerie an unglücklichen Einheimischen ausprobieren. Wurden in Europa schon zivilisiertere Formen der Kriegsführung verlangt, mussten Militärs sich bei der Niederschlagung von Aufständen wie dem der Hereros an keine Rücksichten halten. Auch bot das Imperium Beamten, die daheim irgendwo in der Mitte ihrer Laufbahn stagnierten, die Möglichkeit eines großen Sprunges nach oben. In den Auslandsgebieten war ihre Autorität weniger eingeschränkt; dort konnten sie die Kolonisierten herumkommandieren. Hatte jemand seine Familie durch einen Skandal kompromittiert, wurde er bisweilen zur Strafe nach Übersee exiliert. Nach einer gewissen Schamfrist durfte er zurückkehren, sofern er nicht erneut Schande auf die Seinen lud. Je nachdem, wo man hinkam, drohten an manchen Versetzungszielorten zweifellos Krankheit oder Tod; aber der noble Lebensstil, den man als Europäer dort pflegen konnte, tröstete über solche Gefahren doch leicht hinweg. Während wissenschaftliche Entdeckungen und ökonomische Entwicklungen dazu beitrugen, Europa zu modernisieren, verstärkte die militärische und bürokratische Seite des Imperialismus eher konservative Machtstrukturen.4
Und noch eine Gruppe unter den Pro-Imperialisten müssen wir erwähnen: Altruisten, die in die Kolonien gingen, weil sie den indigenen Völkern helfen wollten, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Viele Missionare, ausgesandt von verschiedenen Konfessionen, beseelte der Wunsch, der einheimischen Bevölkerung den spirituellen Trost des Christentums zu bringen und sie moralisch zu läutern. Ähnlich lagen die Dinge bei Ärzten und Schwestern, die an kolonialen Hospitälern tätig waren und ebenfalls versuchten, den Schmerz und das Leid jener zu mildern, denen oft die wissenschaftlichen Kenntnisse und die pharmazeutischen Mittel zur Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen fehlten. Des Weiteren zeigten einige Lehrer Bereitschaft, an Schulen in den Auslandsgebieten zu arbeiten. Sie wollten nicht nur der Langeweile ihres kontinentalen Lebens entfliehen, sondern auch das Licht der Aufklärung unter den »illiteraten und abergläubischen« Indigenen verbreiten. Zwar glaubten diese humanitär Gesinnten nicht minder als andere Befürworter des Kolonialismus an die Überlegenheit der europäischen Zivilisation, aber sie nahmen erhebliche Entbehrungen auf sich, um deren Segnungen mit jenen Bedürftigen zu teilen. Im Gegensatz zu den Geschäfts- und Verwaltungsleuten, die doch vorwiegend als Ausbeuter agierten, gaben diese Altruisten dem Imperialismus ein menschlicheres Gesicht, was die Kritik an ihm weniger harsch ausfallen ließ.5
Europäer, die wenig direkten Kontakt zum Imperium hatten, nahmen es meist bereitwillig hin, solange es mehr Nutzen als Kosten versprach. In den Metropolen gingen Wissbegierige schon einmal zu einem wissenschaftlichen Vortrag, lauschten einer Abenteuergeschichte oder bestaunten ausgestellte Exotika. Wesentlich höher war die Zahl derer, die Kolonialwaren für den täglichen Bedarf kauften, ohne sich groß um deren Herkunft zu kümmern. Wieder andere hörten sich politische Reden an, die neue einschlägige Erwerbungen und Errungenschaften priesen, oder lasen in der Zeitung Artikel über koloniale Themen – die Kolonien schienen ihnen durchaus interessant, aber weit weg. Oder sie wurden in der Kirche während eines Gottesdienstes um eine Spende für einen Missionsfonds gebeten. Generell produzierten diese geringfügigen Kontakte wohl die Empfindung, dass man zu etwas gehörte, das über den Nationalstaat hinausging, etwas Imperialem eben. Die Bereitschaft, für dieses Große auch Opfer zu bringen, schufen sie hingegen kaum. Die Europäer waren möglicherweise schon stolz, dass ihre Fahnen über ausländischen Besitztümern wehten, etwa über Frankreichs Überseegebieten (la France d’outre mer). Aber um sie davon zu überzeugen, dass die ganze Unternehmung aller Mühen wert sei, mussten Imperialenthusiasten einiges tun. Immerhin konnten selbst skeptische »Unterschichtler« daheim sich einreden, sie gehörten zu jener »Herrscherklasse«, die in den Kolonien das Sagen hatte.6
Um die Jahrhundertwende wurden die kritischen Stimmen dann doch lauter, bis sie gar das gesamte koloniale Projekt in Frage stellten. Gewöhnlich lösten eklatante Vorfälle ökonomischer Spekulation und militärischer Brutalität sowie Korruptionsskandale in der Verwaltung solche Rügen aus. Befürworter des Freihandels fragten sich, ob der Handel nicht auch ohne politischen Gebietsbesitz zu florieren vermöge. Internationale Kommentatoren äußerten die Besorgnis, dass Interessenkonflikte zwischen imperialen Mächten – wie sie sich etwa bei der Konfrontation zwischen Sir Herbert KitchenerKitchener, Herbert und Major Jean-Baptiste MarchandMarchand, Jean-Baptiste manifestierten – zu einem Krieg innerhalb Europas führen könnten. Sprecher der aufstrebenden Arbeiterbewegung geißelten den imperialistischen Hurrapatriotismus, der nur von den Problemen daheim ablenke und von der Notwendigkeit, sich ihrer anzunehmen. Moralisten agitierten gegen gesundheitsschädliche Laster, die man aus den Kolonien importiert habe, wie den Konsum von Opium. Mitfühlende Beobachter wie Sir Roger CasementCasement, Roger prangerten die unmenschliche Behandlung der Eingeborenen im KongoKongo an – Klagen, die schließlich immerhin dazu führten, dass das Land dem belgischen König weggenommen wurde. Ferner hoben koloniale Intellektuelle die eklatante Diskrepanz zwischen den Bekenntnissen der Europäer zur Zivilität und ihrer Praxis hervor, die von rassistischen Vorurteilen und ökonomischer Ausbeutung gekennzeichnet war. Nach und nach kam das Imperium in Verruf.7
Während seiner Glanzzeit war die »Kultur des Imperiums« nichtsdestoweniger stark genug, solche Attacken abzuwehren und sogar einen populären Imperialismus zu verbreiten, der in den Kolonien eine Belohnung sah, die den Europäern aufgrund ihrer Überlegenheit von Natur aus zukam. Um der Kritik entgegenzuwirken, erzeugten die imperialistischen Interessenverbände – namentlich die Ligen der Flotten, der Armeen und der Kolonisten – wahre Fluten von Propaganda. Plakate, Pamphlete und Reden priesen in rauen Mengen die Verdienste und Segnungen des Imperiums. Es bedurfte schon einer konzertierten Anstrengung, um der Kolonisierung des KongoKongo im Mutterland Popularität zu verschaffen, doch am Ende wurden die Belgier – außer den Sozialisten – tatsächlich stolze Imperialisten.8 Nicht minder zeigte sich das kulturelle Establishment von imperialistischen Ideen durchdrungen. Kinderbuchautoren spannen Abenteuergeschichten, Dramatiker ließen ihre Stücke in kolonialer Szenerie spielen, und Journalisten schrieben packende Reportagen. Dass sich die Organisation der Boy Scouts (Pfadfinder), gegründet 1907 von General Robert Baden-PowellBaden-Powell, Robert, so rasch international verbreitete, beweist, dass die Idee, Jungen imperialen Zwecken zuliebe ein quasi-militärisches Training angedeihen zu lassen, überall Anklang fand. Imperialistische Geisteshaltungen infizierten weite Kreise mit jener fatalen Mischung aus Nationalismus, Militarismus und Rassismus, die bald Europa selbst zerreißen sollte.